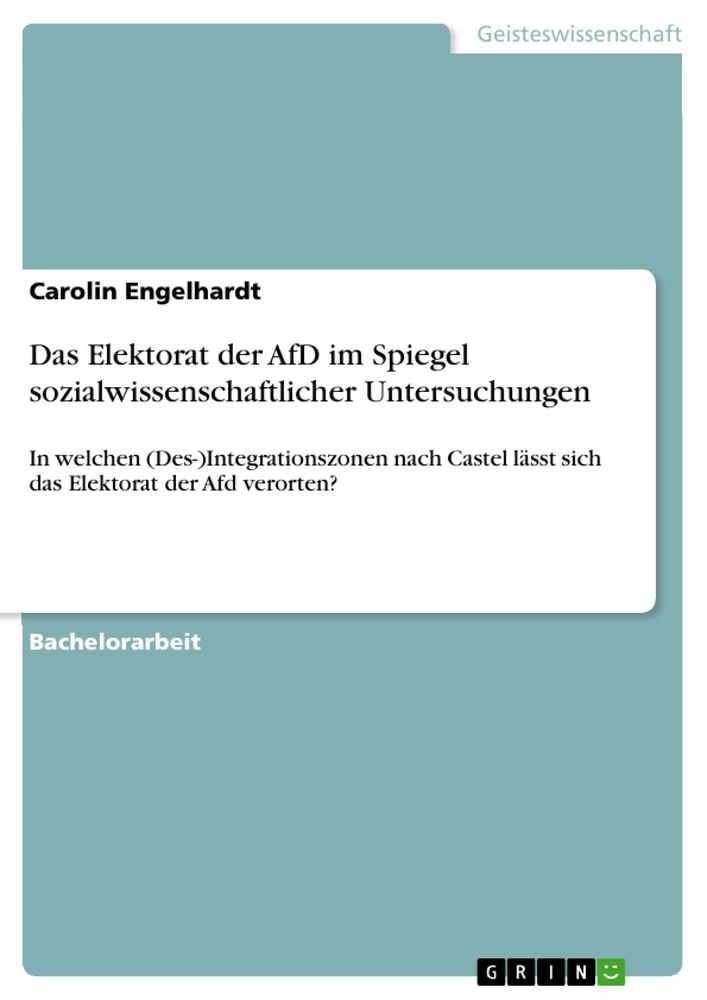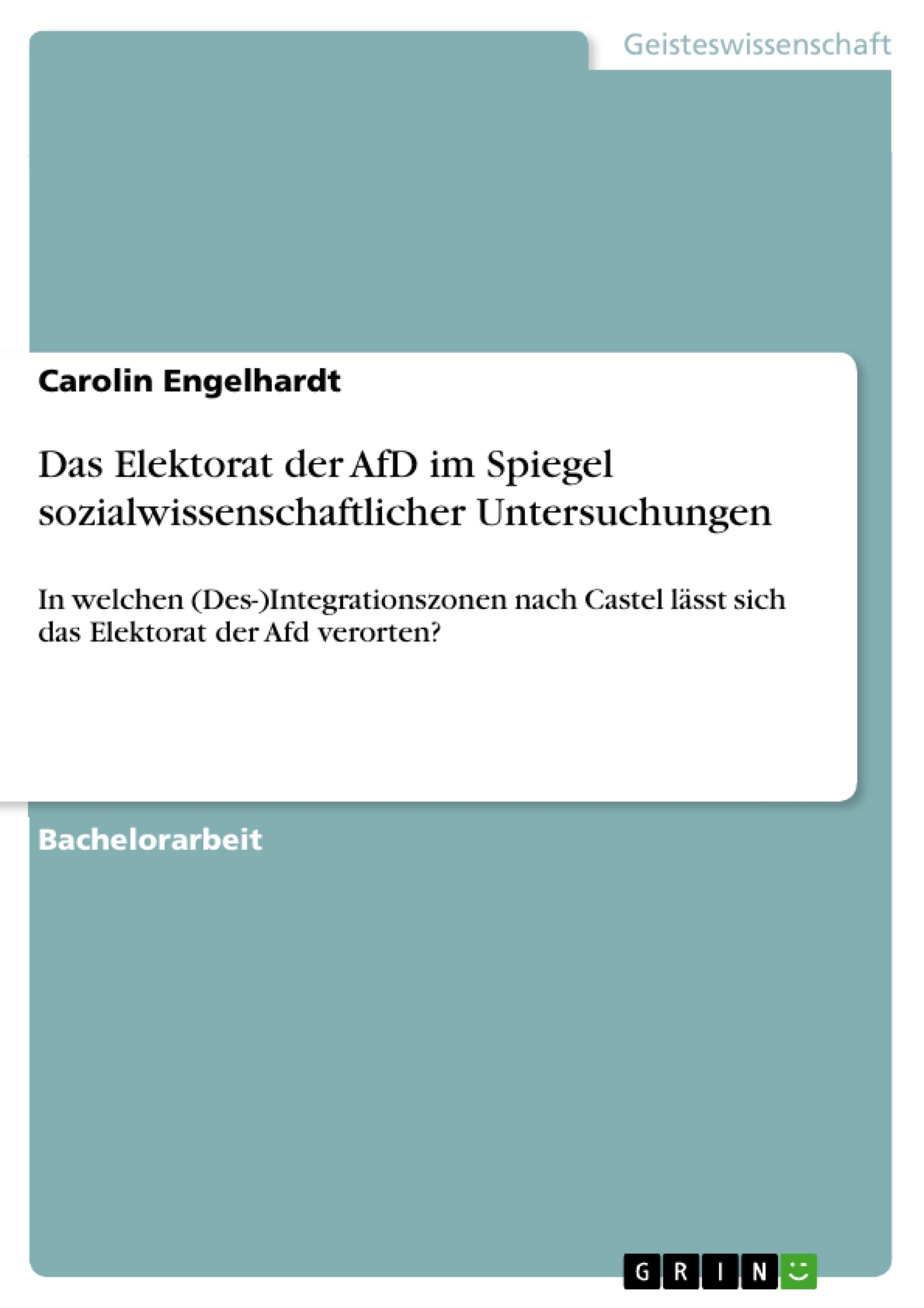Die Arbeit untersucht die gesellschaftlichen und politischen Transformationen in Bezug auf Erwerbsarbeit, die sich in den letzten Jahren in Deutschland vollzogen haben. Es wird dabei konkret die "Alternative für Deutschland" und ihre Wählerschaft analysiert um herauszufinden, was mögliche Gründe für das Erstarken der Partei sind. Theoretische Grundlagen der Arbeit sind Castels Modell der (Des-)Integrationszonen sowie Überlegungen zum "neuen" Rechtspopulismus. Konkret geht die Arbeit der Fragestellung nach: In welchen (Des-)Integrationszonen nach Castel lässt sich das Elektorat der „Alternative für Deutschland“ verorten?
Bei den jüngsten Wahlen in Bayern und Hessen im Oktober 2018 schaffte es die „Alternative für Deutschland“ (AfD) mit 10,2% (Bayern) bzw. 13,1% (Hessen) in den Landtag einzuziehen. Somit ist sie nicht nur stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, sondern auch in jedem Landtag der Bundesrepublik vertreten (Statista 2018). Dieser Trend lässt sich als bemerkenswert erachten, gründete sich die Partei erst im Jahr 2013 und scheiterte damals noch knapp an der 5%-Hürde. Nicht verwunderlich scheint unter Berücksichtigung der derzeitigen politischen Situation, dass sich zunehmend auch die Soziologie dem „Phänomen AfD“ annimmt.
In bekannten Fachzeitschriften (z.B. Zeitschrift für Soziologie, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie) sind in den letzten Jahren zunehmend Beiträge von Soziolog*innen zu finden, die sich mit der Frage auseinandersetzen, weshalb es ausgerechnet die AfD in den letzten Jahren geschafft hat, einen so erheblichen Teil der deutschen Bevölkerung zu mobilisieren, ihre Stimme für sie abzugeben. Ist es der Wandel der AfD von einer „Professoren- zur Prekariatspartei“, wie es die WELT (2016) in einem Artikel schreibt, oder aber besitzen Personen, die einen niedrigen Bildungs-, Einkommens- und Arbeitsstatus aufwei-sen, keine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit die AfD zu wählen, wie es Lengfeld im Juni 2017 zu belegen scheint?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Ausgangslage
- 1.2. Ziel der Arbeit
- 2. Grundlagen
- 2.1. Gesellschaftliche Transformationen im postmodernen Zeitalter
- 2.1.1. Sozio-ökonomische Dimension: Gewandelte Erwerbsarbeit
- 2.1.2. Sozio-kulturelle Dimension: Die Bedrohung der kulturellen Identität
- 2.1.3. Sozio-politische Dimension: Die „Krise politischer Repräsentation“
- 2.2. Der neue Rechtspopulismus
- 2.2.1. Die „Alternative für Deutschland“
- 2.2.2. Politisch-ideologische Einordnung der AfD
- 2.2.3. Wahlprogramm: Was sagt die AfD zur sozialen Frage?
- 3. Wissenschaftliche Debatte: Wer sind die Wähler*innen der AfD?
- 4. Analyse des AfD-Elektorats
- 4.1. Sozialstruktur und Einstellung
- 4.2. Weitere Forschungsergebnisse
- 4.3. Auswertung: Aus welchen (Des-)Integrationszonen der Arbeitsgesellschaft rekrutiert sich das Elektorat der AfD?
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Ursachen für die wachsende Zustimmung zur Alternative für Deutschland (AfD). Die zentrale These besagt, dass gesellschaftliche Desintegrationsprozesse, die aus zunehmend prekären Erwerbssituationen resultieren, zu einer steigenden Zustimmung für rechtspopulistische Parteien, insbesondere die AfD, führen. Die Arbeit nutzt das Modell der (Des-)Integrationszonen nach Robert Castel, um die Wählerschaft der AfD zu analysieren.
- Der Einfluss prekären Beschäftigungsverhältnissen auf die Wahlentscheidung.
- Die Rolle gesellschaftlicher Desintegrationsprozesse bei der Unterstützung rechtspopulistischer Parteien.
- Analyse der AfD-Wählerschaft anhand sozialstruktureller Daten und Meinungsbilder.
- Anwendung des (Des-)Integrationszonen-Modells zur Einordnung des AfD-Elektorats.
- Vergleich der Ergebnisse mit bestehenden wissenschaftlichen Debatten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufstieg der AfD und ihre wachsende Präsenz in deutschen Landesparlamenten. Sie stellt die Frage nach den soziologischen Ursachen dieses Phänomens und hebt den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Wandel, prekären Arbeitsbedingungen und der Unterstützung rechtspopulistischer Parteien hervor. Die Arbeit fokussiert auf die These, dass Desintegrationsprozesse, die aus prekären Erwerbssituationen resultieren, zu einer wachsenden Zustimmung für die AfD führen.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet gesellschaftliche Transformationen im postmodernen Zeitalter. Es analysiert sozio-ökonomische Veränderungen wie die Flexibilisierung der Arbeitswelt und die damit verbundene Zunahme prekär Beschäftigter. Weiterhin werden sozio-kulturelle Umbrüche (z.B. Multikulturalismus) und eine „Krise der politischen Repräsentation“ als weitere Faktoren diskutiert, die die Akzeptanz für Rechtspopulismus beeinflussen können. Abschließend wird die AfD als Partei des neuen Rechtspopulismus eingeordnet und ihr Wahlprogramm im Hinblick auf soziale Fragen untersucht.
3. Wissenschaftliche Debatte: Wer sind die Wähler*innen der AfD?: Dieses Kapitel präsentiert die divergierenden Ergebnisse und Meinungen aus der wissenschaftlichen Diskussion über das AfD-Elektorat. Es beleuchtet verschiedene Forschungsansätze und Schlussfolgerungen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, welche sozio-ökonomischen und demografischen Gruppen die AfD wählen und welche Motive dahinter stehen. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ergebnissen und der damit verbundenen Unsicherheit in der wissenschaftlichen Interpretation.
4. Analyse des AfD-Elektorats: Kapitel 4 analysiert das AfD-Elektorat anhand sozialstruktureller Daten und empirischer Forschungsergebnisse zu Meinungsbildern. Es untersucht die soziale Zusammensetzung der Wählerschaft und deren Einstellungen zu relevanten politischen und gesellschaftlichen Themen. Die Ergebnisse werden im Kontext des (Des-)Integrationszonen-Modells nach Castel interpretiert, um die Positionierung der Wählerschaft zu bestimmen.
Schlüsselwörter
Alternative für Deutschland (AfD), Rechtspopulismus, Prekarisierung, gesellschaftliche Desintegration, (Des-)Integrationszonen (Castel), soziale Ungleichheit, Erwerbsarbeit, politische Repräsentation, Wahlverhalten, sozio-ökonomische Faktoren, sozio-kulturelle Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Analyse des AfD-Elektorats
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Ursachen für die steigende Zustimmung zur Alternative für Deutschland (AfD). Die zentrale These ist, dass gesellschaftliche Desintegrationsprozesse, insbesondere durch prekären Beschäftigungsverhältnisse, zu einer höheren Zustimmung für rechtspopulistische Parteien führen.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit nutzt das Modell der (Des-)Integrationszonen nach Robert Castel, um das AfD-Elektorat zu analysieren. Sie stützt sich auf sozialstrukturelle Daten und empirische Forschungsergebnisse zu Meinungsbildern der AfD-Wählerschaft.
Welche Aspekte gesellschaftlicher Transformationen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert sozio-ökonomische Veränderungen (z.B. Flexibilisierung der Arbeitswelt, Zunahme prekär Beschäftigter), sozio-kulturelle Umbrüche (z.B. Multikulturalismus) und eine „Krise der politischen Repräsentation“ als Faktoren, die die Akzeptanz von Rechtspopulismus beeinflussen.
Wie wird das AfD-Elektorat beschrieben?
Die Arbeit analysiert die soziale Zusammensetzung der AfD-Wählerschaft und deren Einstellungen zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Sie untersucht, aus welchen (Des-)Integrationszonen der Arbeitsgesellschaft sich das Elektorat rekrutiert.
Welche Rolle spielt die prekären Beschäftigung?
Die Arbeit untersucht den Einfluss prekären Beschäftigungsverhältnissen auf die Wahlentscheidung und die Rolle gesellschaftlicher Desintegrationsprozesse bei der Unterstützung rechtspopulistischer Parteien.
Wie werden die Ergebnisse der Arbeit eingeordnet?
Die Ergebnisse werden im Kontext des (Des-)Integrationszonen-Modells nach Castel interpretiert und mit bestehenden wissenschaftlichen Debatten verglichen. Die Arbeit beleuchtet die divergierenden Ergebnisse und Meinungen aus der wissenschaftlichen Diskussion über das AfD-Elektorat.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Grundlagenkapitel, ein Kapitel zur wissenschaftlichen Debatte über das AfD-Elektorat, ein Kapitel zur Analyse des AfD-Elektorats, sowie ein Fazit und Ausblick. Die Einleitung beschreibt den Aufstieg der AfD und stellt die Forschungsfrage. Das Grundlagenkapitel beleuchtet gesellschaftliche Transformationen und die AfD als Partei des neuen Rechtspopulismus. Das Kapitel zur wissenschaftlichen Debatte präsentiert divergierende Meinungen zum AfD-Elektorat. Das Analysekapitel untersucht die soziale Zusammensetzung und Einstellungen der Wählerschaft. Schließlich fasst das Fazit die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alternative für Deutschland (AfD), Rechtspopulismus, Prekarisierung, gesellschaftliche Desintegration, (Des-)Integrationszonen (Castel), soziale Ungleichheit, Erwerbsarbeit, politische Repräsentation, Wahlverhalten, sozio-ökonomische Faktoren, sozio-kulturelle Veränderungen.
- Quote paper
- Carolin Engelhardt (Author), 2019, Das Elektorat der AfD im Spiegel sozialwissenschaftlicher Untersuchungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/520462