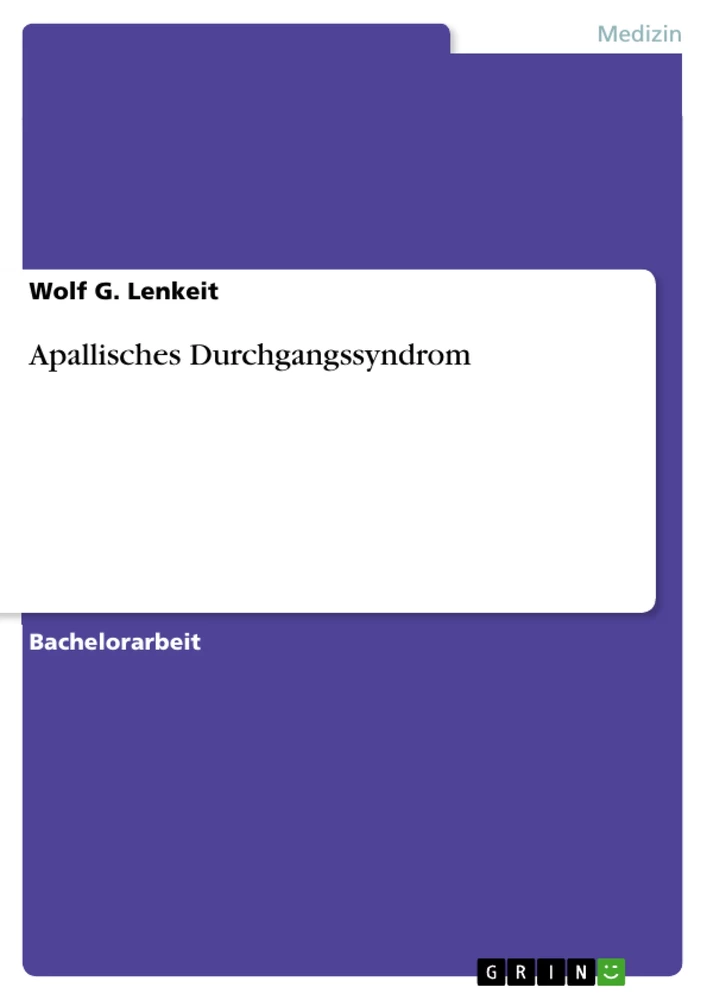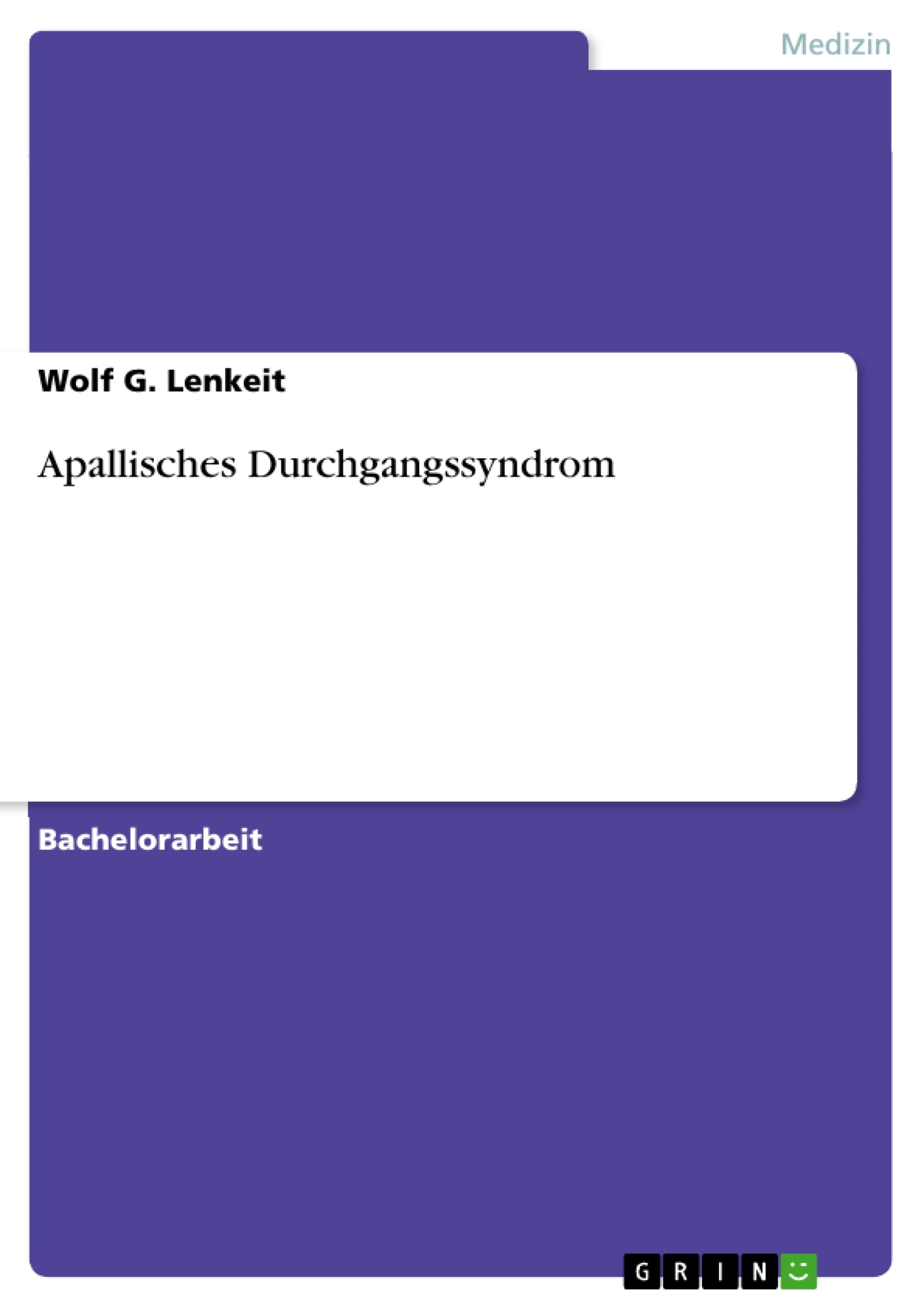Die Möglichkeit mit Menschen im Wachkoma zu arbeiten ist für mich eine neue therapeutische Herausforderung. Es stellt sich eine völlig neue Patienten-Therapeuten-Beziehung dar, da wenig konkretes Feedback und vor allem wenig Möglichkeiten zur Ergebnismessung vorhanden sind.
Während meines Studiums an der Hogeschool van Amsterdam waren es insbesondere neurologische Studienmodule, die mir methodologische Interventionsstrategien in der Physiotherapie näher brachten. Aus meinem praktischen Zugang zu den Patienten ließen sich folgende relevante Hypothesen aufstellen:
- Lassen sich Menschen mit Apallischem Durchgangssyndrom in der Phase F professioneller mit neurologischen Verlaufsdokumentationen beschreiben als mit anderen Dokumentationsmöglichkeiten?
- Was soll mit ihnen in medizinischen Systemen passieren, die sich zunehmend über Kosten-Nutzen Rechnungen definieren?
- Warum wird weiterhin viermal die Woche Ergo-, Logo- und Physiotherapie verschrieben?
- Gibt es noch konkrete Therapiezieldefinitionen?
- Ist es möglich mit Rehabilitationsskalen Therapieziele klarer zu definieren?
- Phase F als Lebensform am Ende der Rehabilitationskette in Deutschland.
An einer exemplarischen Arbeitsituation werde ich diesen Fragen nachgehen.In einem Pflegewohnheim mit einer auf Wachkoma spezialisierten Station mit sehr unterschiedlichen Wachkomapatienten, einem Grossteil der Patientengruppe mit SHT Grad III. Die Therapeuten sind alle extern. Das Pflegefachpersonal ist angestellt. Ärzte kommen sporadisch zu Untersuchungen.
Ich habe bei vier meiner Patienten mit gängigen neurologischen Skalen (Glasgow Coma Scale, Edinbourgh 2Coma Scale, Koma Remissions-Skala und Glasgow Ooutcome Scale) eine Verlaufsdokumentation über acht Wochen mit sechs zeitlichen Messpunkten erstellt. Die Auswahl der Patientenpopulation ist realistisch heterogen SHT III°, Hypoxien und Ischiamischer Insult (Locked-In-Syndrom). Es wird berücksichtigt, dass die Aussage der Ergebnisse in Rehabilitationsphase F einen geringeren Aussagewert hat, als in der Frührehabilitation.
Ich möchte mit dieser Arbeit erreichen, die Diskussion über die physiotherapeutische Behandlung von Wachkomapatienten anzuregen. Viele der Fragen haben sich erst im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Thema ergeben, so zum Beispiel die Entwicklung in der Medizin von rein biomedizinischen zu eher gemischten, biomedizinisch psychosozialen Denkmodellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das Apallische Syndrom
- 1.1 Ätiologie und Pathogene
- 1.2 Differentialdiagnostische Abgrenzung
- 1.3 Ursachen, Inzidenz, Prävalenz und Verlauf
- 1.4 Wahrnehmung im Wachkoma: Defektorientierte vs. Beziehungsmedizin
- 1.5 Patientenautonomie und Selbstbestimmungsrecht
- 2. Scores und Messinstrumente für physiotherapeutische Interventionen in der Neurologie
- 2.1 Bio-medizinische und Psycho-soziale Modelle
- 2.2 ICF-Behinderungs- und Beeinträchtigungsmodell der WHO
- 2.3 Rehabilitationsskalen in der Neurologie
- 2.4 Anwendbarkeit von Rehabilitationsskalen bei Apallikern in Phase F
- 2.5 Sensitivität der angewendeten Messinstrumente
- 2.6 Objektivierbarkeit von Therapieerfolgen
- 3. Die Rehabilitationskette in Deutschland
- 3.1 Neurologische Rehabilitations-Phasen A bis G
- 3.2 Schnittstelle intensiv Medizin und Frührehabilitation
- 3.3 Interdisziplinäres Arbeiten in Phase F
- 3.4 Eigene Erfahrungen mit Rehabilitationsskalen
- 3.5 Ergebnisse und Interpretationen
- 4. Diskussion
- 5. Konklusion
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Anwendung neurologischer Verlaufsdokumentationen bei Menschen im Wachkoma der Phase F, insbesondere im Kontext des apallischen Durchgangssyndroms. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob diese Dokumentationen eine professionelle Beschreibung ermöglichen und wie Therapieziele in einem kostensensiblen Gesundheitssystem klarer definiert werden können.
- Anwendung neurologischer Skalen und Scores bei Patienten im Wachkoma (Phase F).
- Analyse der Effektivität von Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie im Kontext des Apallischen Durchgangssyndroms.
- Bewertung der Patientenautonomie und des Selbstbestimmungsrechts bei Menschen im Wachkoma.
- Die Rolle der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Rehabilitation von Patienten mit Apallischem Durchgangssyndrom.
- Die Rehabilitationskette in Deutschland und die Positionierung der Phase F.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Apallische Syndrom: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in das apallische Syndrom (AS), einschließlich seiner Ätiologie, Pathogenese, Differentialdiagnose, Ursachen, Inzidenz, Prävalenz und Verlauf. Es beleuchtet kritisch die unterschiedlichen Perspektiven der defektorientierten Medizin und der Beziehungsmedizin in der Wahrnehmung von Wachkoma-Patienten und diskutiert die Herausforderungen bezüglich Patientenautonomie und Selbstbestimmungsrecht in diesem Kontext. Die Diskussion der verschiedenen medizinischen Modelle und ihre Implikationen für die therapeutische Praxis bildet den Kern dieses einführenden Kapitels.
2. Scores und Messinstrumente für physiotherapeutische Interventionen in der Neurologie: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den verschiedenen Scores und Messinstrumenten, die in der neurologischen Physiotherapie eingesetzt werden. Es werden biomedizinische und psychosoziale Modelle vorgestellt und das ICF-Modell der WHO als Grundlage für die Bewertung von Beeinträchtigungen und Behinderungen erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendbarkeit dieser Skalen bei Apallikern in Phase F, der Sensitivität der Messinstrumente und der Möglichkeit, Therapieerfolge objektiv zu messen. Die kritische Auseinandersetzung mit den Limitationen der verschiedenen Methoden und deren Auswirkungen auf die Therapieplanung ist zentral.
3. Die Rehabilitationskette in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Rehabilitationskette in Deutschland, insbesondere die neurologischen Rehabilitationsphasen A bis G. Der Fokus liegt auf der Schnittstelle zwischen Intensivmedizin und Frührehabilitation sowie dem interdisziplinären Arbeiten in Phase F. Es werden die eigenen Erfahrungen des Autors mit Rehabilitationsskalen detailliert dargestellt und die Ergebnisse interpretiert. Der Text beleuchtet die Herausforderungen der Rehabilitation von Patienten in Phase F und die spezifischen Bedürfnisse dieser Patientengruppe.
Schlüsselwörter
Apallisches Syndrom, Wachkoma, Phase F, Neurologische Rehabilitation, Rehabilitationsskalen, ICF-Modell, Patientenautonomie, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Therapieziele, Kosten-Nutzen-Rechnung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Anwendung neurologischer Verlaufsdokumentationen bei Menschen im Wachkoma der Phase F
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendung neurologischer Verlaufsdokumentationen (Scores und Messinstrumente) bei Patienten im Wachkoma, speziell in der Phase F, im Kontext des apallischen Durchgangssyndroms. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob diese Dokumentationen eine adäquate Beschreibung ermöglichen und wie Therapieziele im Hinblick auf ein kostensensibles Gesundheitssystem klarer definiert werden können.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Anwendung neurologischer Skalen und Scores bei Wachkoma-Patienten (Phase F), Analyse der Effektivität von Physio-, Ergo- und Logopädie beim apallischen Durchgangssyndrom, Bewertung der Patientenautonomie und des Selbstbestimmungsrechts bei Wachkoma-Patienten, die Rolle der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Rehabilitation, die Rehabilitationskette in Deutschland und die Positionierung der Phase F.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 beschreibt das apallische Syndrom (Ätiologie, Pathogenese, Differentialdiagnose, Verlauf etc.), Kapitel 2 behandelt Scores und Messinstrumente für neurologische Physiotherapie (inkl. ICF-Modell), Kapitel 3 beschreibt die deutsche Rehabilitationskette mit Fokus auf Phase F und interdisziplinärer Zusammenarbeit, Kapitel 4 beinhaltet die Diskussion der Ergebnisse und Kapitel 5 die Schlussfolgerung. Zusätzlich enthält die Arbeit ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Methoden werden in der Arbeit eingesetzt?
Die Arbeit verwendet eine Literaturrecherche und Analyse bestehender neurologischer Skalen und Scores. Die eigenen Erfahrungen des Autors mit Rehabilitationsskalen in der Phase F werden ebenfalls detailliert dargestellt und interpretiert. Es findet eine kritische Auseinandersetzung mit den Limitationen der verschiedenen Methoden und deren Auswirkungen auf die Therapieplanung statt.
Welche zentralen Fragen werden in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit versucht zu beantworten, ob und wie neurologische Verlaufsdokumentationen die Therapie bei Wachkoma-Patienten in Phase F verbessern können, wie Therapieziele präziser definiert werden können und wie die Patientenautonomie in diesem Kontext gewahrt werden kann. Weiterhin wird die Effektivität interdisziplinärer Zusammenarbeit und die Rolle der verschiedenen Rehabilitationsphasen beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Apallisches Syndrom, Wachkoma, Phase F, Neurologische Rehabilitation, Rehabilitationsskalen, ICF-Modell, Patientenautonomie, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Therapieziele, Kosten-Nutzen-Rechnung.
Welche Bedeutung hat das apallische Syndrom in dieser Arbeit?
Das apallische Syndrom bildet den zentralen Kontext der Arbeit. Es wird umfassend beschrieben und dient als Grundlage für die Analyse der Anwendung und des Nutzens neurologischer Verlaufsdokumentationen in der Rehabilitation von betroffenen Patienten.
Welche Rolle spielt das ICF-Modell in der Arbeit?
Das ICF-Modell der WHO dient als Rahmenmodell zur Bewertung von Beeinträchtigungen und Behinderungen und unterstützt die Analyse der Anwendbarkeit und Effektivität der verschiedenen Rehabilitationsskalen und Scores.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind im Kapitel 5 (Konklusion) zusammengefasst und sollten im Kontext der gesamten Arbeit gelesen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeit Empfehlungen für die Verbesserung der neurologischen Verlaufsdokumentation und Therapieplanung bei Wachkoma-Patienten in Phase F gibt.
- Quote paper
- B.Sc. Wolf G. Lenkeit (Author), 2006, Apallisches Durchgangssyndrom, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52033