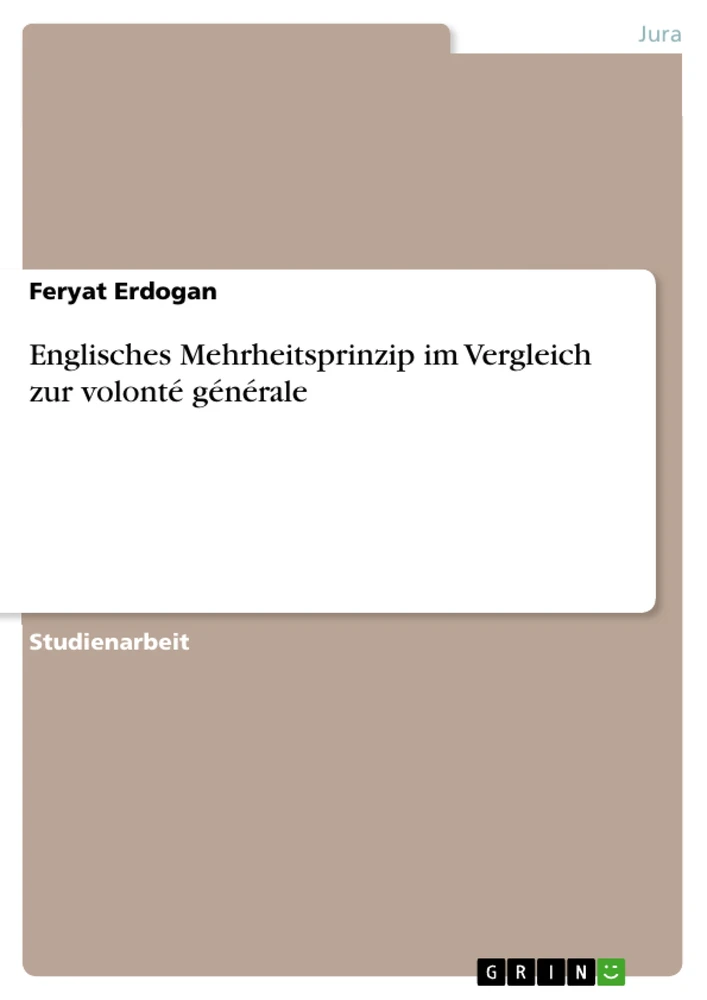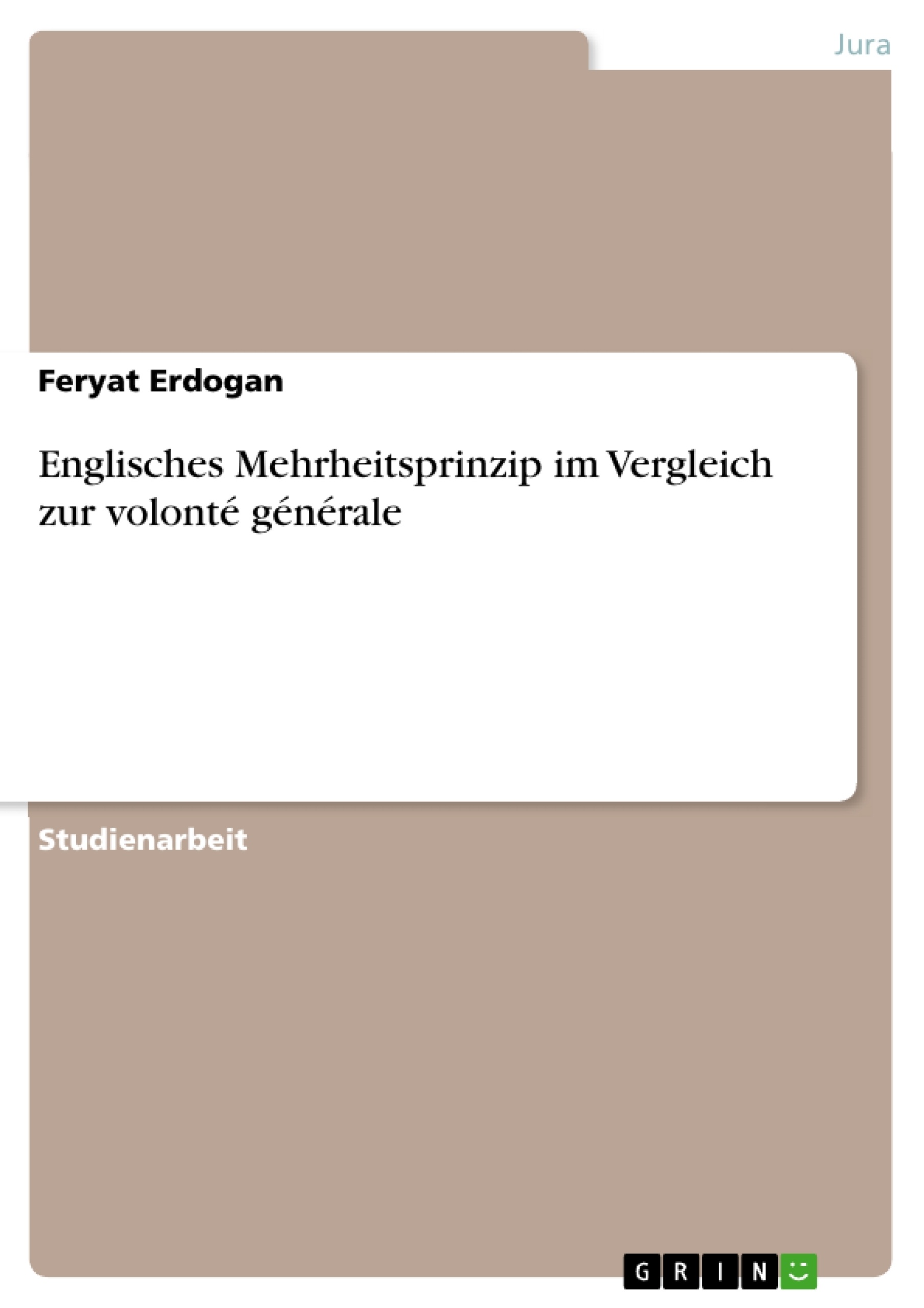Diese Arbeit vergleicht das englische Mehrheitsprinzip mit dem volonté générale, also dem Gemeinwillen des Volkes. Die Demokratie bedeutet zwar im Kern, dass die tatsächliche Herrschaft durch das Volk ausgeht, doch sie unterscheidet sich in seinen verschiedensten Formen. Dabei kommen die direkte und repräsentative Demokratie am meisten vor. Während beim ersteren vor jeder politischen Entscheidung das Volk gefragt wird, wählt beim letzteren das Volk ein Parlament, wo dann die politischen Entscheidungen durch Abgeordnete getroffen werden; d.h. die sog. Volkvertreter repräsentieren im Parlament die Interessen des Volkes. Für den Bürger bedeutet also die Demokratie die gleiche politische Freiheit für jedermann.
Es stellt sich auch die Frage, ob die Meinung der Mehrheit auch die der Minderheit sein kann, wenn vor allem die Mehrheit gerade mit knappen 51 % zu 49 % regiert. Fraglich ist auch an dieser Stelle, inwiefern Rousseau auf diese Problematik eine Antwort liefert.
Rousseaus Gesellschaftsvertrag ist eines der wichtigsten politischen Theorien der Neuzeit. Mit dem Gesellschaftsvertrag wird das Volk in eine politische Körperschaft geformt. Dies lässt politische und rechtliche Fragen aufkommen. Wer soll herrschen? Wie soll geherrscht werden? Und vor allem in welchem Umfang soll geherrscht werden? Diese Fragen stellen sich bis heute noch vielen Wissenschaftlern bzw. Philosophen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Das parlamentarische Mehrheitsprinzip
- I. Parlamentarismus
- II. Das Mehrheitsprinzip
- 1. Geschichtliche Entwicklung
- 2. Formen des Mehrheitsprinzips
- 3. Rechtfertigung des Mehrheitsprinzips
- 4. Die parlamentarische Minderheit
- III. Rousseaus Gesellschaftsvertrag
- 1. Bedeutung des volonté générale
- 2. Vereinbarkeit des volonté générale und Parlamentarismus
- 3. Das volonté générale, die Stimme der Mehrheit?
- 4. Kritik an Rousseaus Lehre
- IV. Englisches Mehrheitsprinzip
- 1. Wahl und Aufgabe des House of Commons
- 2. Wirkung des Mehrheitsprinzips auf das Parteiensystem
- 3. Vereinbarkeit mit dem volonté générale
- C. Kritik am Mehrheitsprinzip
- D. Gesamtwürdigung des Themas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem parlamentarischen Mehrheitsprinzip und dessen Bedeutung für die Demokratie. Ziel ist es, die Funktionsweise und die historische Entwicklung dieses Prinzips darzustellen, sowie kritische Aspekte zu beleuchten. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, inwiefern das Mehrheitsprinzip mit dem Willen der Mehrheit, dem "volonté générale" im Sinne Rousseaus, übereinstimmt und welche Rolle die Minderheit in diesem Kontext spielt.
- Die Bedeutung des parlamentarischen Mehrheitsprinzips für demokratische Prozesse
- Die historische Entwicklung des Mehrheitsprinzips
- Die unterschiedlichen Formen des Mehrheitsprinzips
- Der Konflikt zwischen Mehrheit und Minderheit in der Demokratie
- Die Relevanz des "volonté générale" im Zusammenhang mit dem Mehrheitsprinzip
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Demokratie und des Mehrheitsprinzips in der heutigen Zeit heraus. Sie führt in die Thematik ein und zeigt die Problematik des Mehrheitsprinzips hinsichtlich der Interessenvertretung der Minderheit auf.
B. Das parlamentarische Mehrheitsprinzip: Dieses Kapitel erläutert die Funktionsweise des parlamentarischen Mehrheitsprinzips. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Parlamentarismus und die verschiedenen Formen des Mehrheitsprinzips.
I. Parlamentarismus: Dieser Abschnitt beschreibt die Bedeutung und Funktion des Parlamentarismus als Regierungsform in der Demokratie. Er untersucht die Entwicklung des Parlamentarismus von einem Ort der Beratung zu einem Ort der politischen Entscheidungsfindung.
II. Das Mehrheitsprinzip: Dieser Abschnitt definiert das Mehrheitsprinzip und erläutert seine Anwendung im Wahlsystem und bei parlamentarischen Abstimmungen. Es werden die unterschiedlichen Formen des Mehrheitsprinzips (relative, einfache, absolute und qualifizierte Mehrheit) vorgestellt.
1. Geschichtliche Entwicklung: Dieser Abschnitt verfolgt die historische Entwicklung des Mehrheitsprinzips von der Antike bis zur Gegenwart. Er beschreibt die unterschiedlichen Formen der Stimmabgabe und die Entstehung des modernen Verständnisses des Mehrheitsprinzips.
2. Formen des Mehrheitsprinzips: In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Formen des Mehrheitsprinzips im Detail betrachtet. Es wird auf die Unterschiede zwischen relativer, einfacher, absoluter und qualifizierter Mehrheit eingegangen und deren Anwendung im Kontext von Wahlen und Abstimmungen erklärt.
3. Rechtfertigung des Mehrheitsprinzips: Dieser Abschnitt beleuchtet die Gründe für die Anwendung des Mehrheitsprinzips in der Demokratie.
4. Die parlamentarische Minderheit: Dieser Abschnitt geht auf die Situation der Minderheit im Parlament ein und untersucht, welche Möglichkeiten und Herausforderungen sich für die Minderheit in einem System des Mehrheitsprinzips ergeben.
III. Rousseaus Gesellschaftsvertrag: Dieser Abschnitt untersucht Rousseaus Konzept des "volonté générale" (Gemeinwillen) und dessen Relevanz für das parlamentarische Mehrheitsprinzip.
1. Bedeutung des volonté générale: Dieser Abschnitt erläutert die Bedeutung des "volonté générale" in Rousseaus politischer Philosophie.
2. Vereinbarkeit des volonté générale und Parlamentarismus: Dieser Abschnitt untersucht, inwiefern sich Rousseaus Konzept des "volonté générale" mit der Funktionsweise des Parlamentarismus vereinbaren lässt.
3. Das volonté générale, die Stimme der Mehrheit?: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, ob der "volonté générale" durch die Mehrheitsstimme repräsentiert wird.
4. Kritik an Rousseaus Lehre: Dieser Abschnitt behandelt kritische Einwände gegen Rousseaus Lehre vom "volonté générale".
IV. Englisches Mehrheitsprinzip: Dieser Abschnitt widmet sich dem englischen Mehrheitsprinzip und dessen Auswirkungen auf das politische System.
1. Wahl und Aufgabe des House of Commons: Dieser Abschnitt erläutert die Funktionsweise des House of Commons als dem wichtigsten Teil des englischen Parlaments.
2. Wirkung des Mehrheitsprinzips auf das Parteiensystem: Dieser Abschnitt untersucht den Einfluss des Mehrheitsprinzips auf das Parteiensystem im Vereinigten Königreich.
3. Vereinbarkeit mit dem volonté générale: Dieser Abschnitt betrachtet die Frage, inwiefern das englische Mehrheitsprinzip mit dem "volonté générale" vereinbar ist.
C. Kritik am Mehrheitsprinzip: Dieser Abschnitt beleuchtet kritische Aspekte des Mehrheitsprinzips und untersucht seine Grenzen und Schwächen.
Schlüsselwörter
Parlamentarismus, Mehrheitsprinzip, Demokratie, Volkssouveränität, volonté générale, Minderheit, Interessenvertretung, Wahlsystem, Abstimmungen, politische Entscheidungsfindung, Rechtsstaatlichkeit, politische Partizipation, Kritik, Grenzen, Schwächen.
- Quote paper
- Feryat Erdogan (Author), 2020, Englisches Mehrheitsprinzip im Vergleich zur volonté générale, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/519925