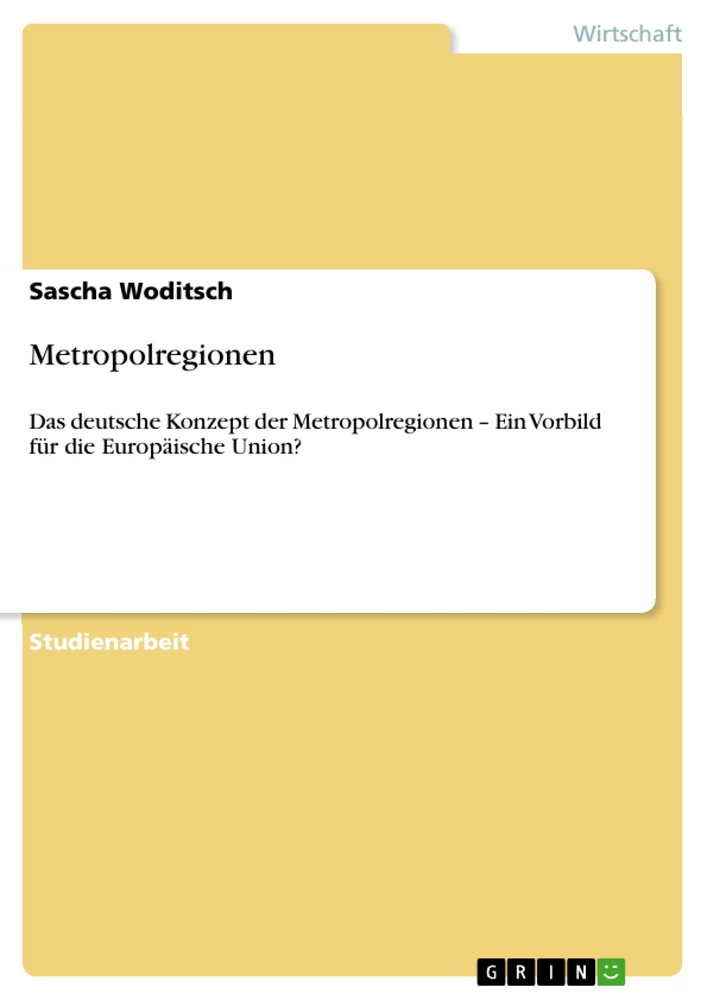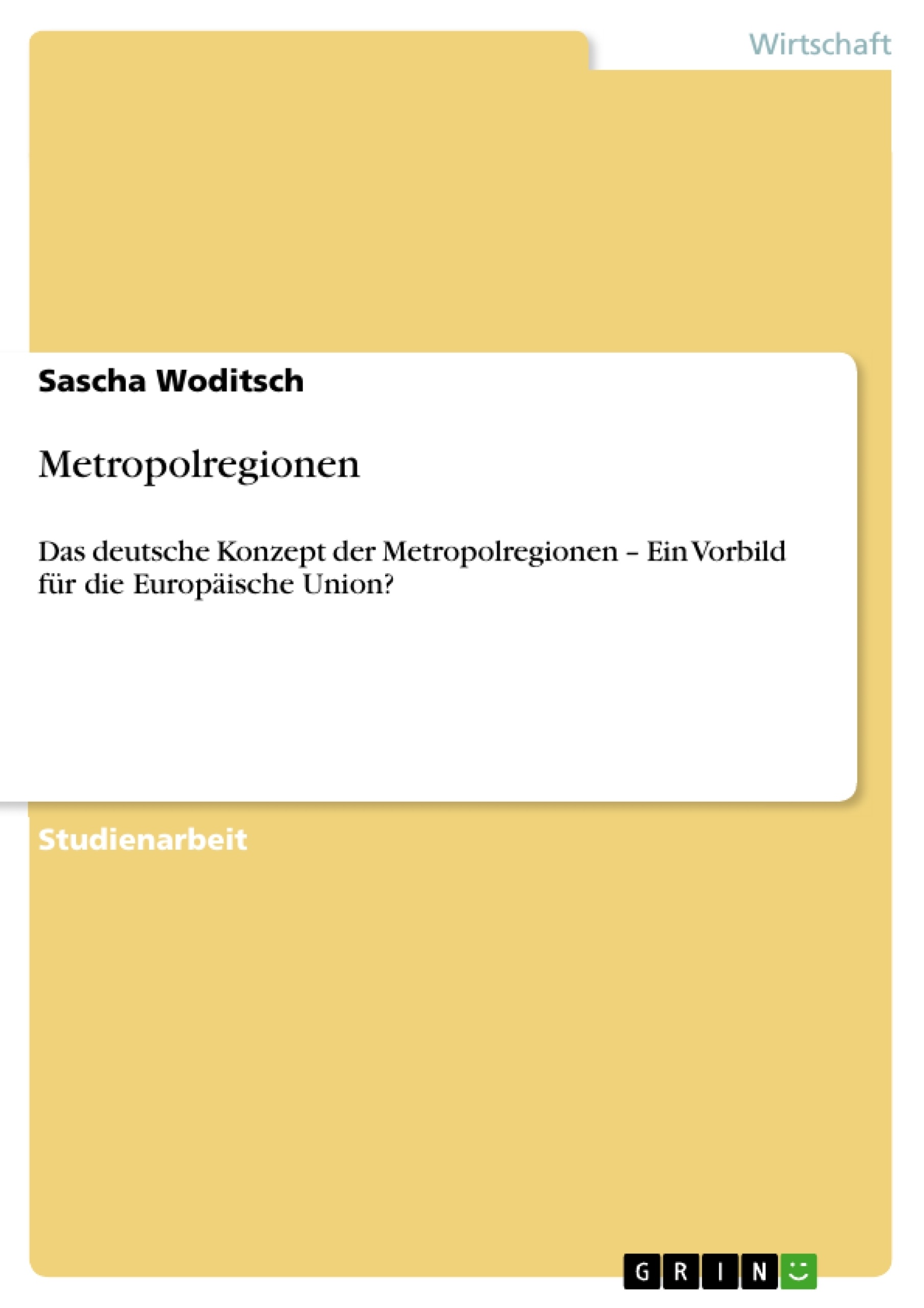Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Metropolisierung zu einem weltweiten Phänomen, vor allem in den Entwicklungsländern begannen die Bevölkerungszahlen der Städte zu explodieren. In den Industrieländern, hingegen wuchsen die Metropolen ab dieser Zeit eher langsam oder es kam sogar zu einer Bevölkerungsstagnation. Mit der rasant voranschreitenden Globalisierung wurde jedoch deutlich, dass die Bevölkerungszahl nicht der ausschlaggebende Faktor ist, der eine Stadt zu einer Weltmetropole macht. So entwickelte Mitte der 80er Jahre Friedmann seine „World City-Hypothese“, nach der die Bedeutung von Städten vor allem nach dem Grad ihrer Integration in das weltwirtschaftliche System gemessen wird, wobei nicht das Produzieren von Gütern entscheidend ist, sondern die Kontrolle von Produktion und Märkten. Obwohl es keine allgemeingültigen und eindeutigen Indikatoren gibt nach denen dies gemessen werden kann, haben sich einige überzeugend und brauchbare Indikatoren herausgebildet, nach denen unterschieden wird zu welchem Rang eine Stadt gehört, so z.B. :
- „Headquarter“-Funktion: Anzahl der Hauptsitze der weltweit größten Unternehmen und Banken in einer Stadt
- Anzahl von „Advanced Producer Services“ wie Werbe- und Consultingagenturen
- Umsatzvolumen der internationalen Börsenplätze
- Bedeutung der Stadt als Verkehrsknotenpunkt
Die Suburbanisierung und der infolgedessen einsetzende relative Bedeutungsverlust des Stadtzentrums und der direkten Stadtbezirke im Verhältnis zum Suburbanen Raum führte mehr und mehr zu einem Zusammenwachsen von Stadt und Umland. Die Ausweitung der Transport- und Informationssysteme führte zu einer dichten Vernetzung von Region und Metropole. Aus dieser Verflechtung von Großstadt und Region, entwickelte sich schließlich der Begriff „Metropolregion“
Um im Folgenden die Frage, ob das deutsche Konzept der Metropolregionen nun ein Vorbild für die EU sein kann, beantworten zu können, muss zunächst geklärt werden: In welche Richtung sollen sich die Metropolregionen Europas entwickeln?. Dabei gehe ich von einer Zielvorstellung aus, die eine nachhaltige Entwicklung in den Blick nehmen soll, d.h. eine Balance zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt, wie es auch im Europäischen Raumentwicklungskonzept angegeben ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition: Metropolregion
- Theorie der Metropolregionen
- Das deutsche Konzept der Metropolregionen
- Entstehung und Besonderheit der Metropolregionen
- Akteure der Europäischen Metropolregionen
- Die Situation der „Europäischen Metropolregionen“
- Die Entwicklung der Metropolregionen in Deutschland
- Das deutsche Konzept der Metropolregionen - ein Vorbild für die EU?
- Ökonomische Vorteile eines polyzentrischen Systems und ökonomische Nachteile eines monozentrischen Systems
- Ökologische Vorteile eines polyzentrischen Systems und ökologische Nachteile eines monozentrischen Systems
- Soziale Vorteile eines polyzentrischen Systems und soziale Nachteile eines monozentrischen Systems
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das deutsche Konzept der Metropolregionen und bewertet dessen Vorbildfunktion für die Europäische Union. Der Fokus liegt auf einer nachhaltigen Entwicklung, die ökonomische, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt.
- Definition und Theorie der Metropolregionen
- Entstehung und Entwicklung des deutschen Metropolregionen-Konzepts
- Ökonomische Vorteile eines polyzentrischen Systems
- Ökologische und soziale Aspekte von Metropolregionen
- Bewertung des deutschen Modells als Vorbild für die EU
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Metropolisierung, beginnend mit der industriellen Revolution und der daraus resultierenden Agglomeration von Unternehmen und Bevölkerung in Städten mit guter Verkehrsanbindung. Sie beleuchtet die Entwicklung von der Konzentration in westlichen Industrieländern hin zu einem weltweiten Phänomen und führt die „World City-Hypothese“ Friedmanns ein, die die Bedeutung von Städten an ihrem Grad der Integration in das weltwirtschaftliche System misst. Die Einleitung führt in die Fragestellung ein, ob das deutsche Konzept der Metropolregionen ein Vorbild für die EU sein kann, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Definition: Metropolregion: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Metropolregion", der in Deutschland 1995 formell eingeführt wurde. Es zerlegt den Begriff in seine Bestandteile "Metropole" und "Region" und erläutert deren Bedeutung. Die Definition betont die Rolle von Metropolregionen als Motoren gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklung.
Das deutsche Konzept der Metropolregionen: Dieser Abschnitt analysiert das deutsche Konzept der Metropolregionen. Es beleuchtet die Entstehung und Besonderheiten des Konzepts, die Akteure, die aktuelle Situation der europäischen Metropolregionen in Deutschland und deren Entwicklung. Es werden spezifische Merkmale und Charakteristika des deutschen Ansatzes hervorgehoben, die als potentielle Vorbilder für andere europäische Länder in Betracht gezogen werden können.
Das deutsche Konzept der Metropolregionen - ein Vorbild für die EU?: Dieses Kapitel untersucht die ökonomischen, ökologischen und sozialen Vorteile eines polyzentrischen Systems (wie es durch Metropolregionen repräsentiert wird) im Vergleich zu den Nachteilen eines monozentrischen Systems. Es werden konkrete Beispiele und Argumente präsentiert, um die Vorzüge des deutschen Modells für eine nachhaltige Entwicklung in der EU zu belegen. Die Kapitel analysiert die jeweiligen Vor- und Nachteile detailliert und bewertet diese im Kontext einer nachhaltigen Raumentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deutsches Metropolregionen-Konzept - Ein Vorbild für die EU?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das deutsche Konzept der Metropolregionen und bewertet dessen Vorbildfunktion für die Europäische Union. Der Fokus liegt dabei auf einer nachhaltigen Entwicklung unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Theorie der Metropolregionen, die Entstehung und Entwicklung des deutschen Konzepts, die ökonomischen Vorteile eines polyzentrischen Systems (wie es durch Metropolregionen repräsentiert wird), ökologische und soziale Aspekte von Metropolregionen und eine abschließende Bewertung des deutschen Modells als Vorbild für die EU.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition des Begriffs "Metropolregion", Analyse des deutschen Konzepts der Metropolregionen (inklusive Entstehung, Akteure und Entwicklung), und eine abschließende Bewertung des deutschen Modells als Vorbild für die EU, wobei ökonomische, ökologische und soziale Vorteile eines polyzentrischen Systems im Vergleich zu einem monozentrischen System analysiert werden.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Metropolisierung, beginnend mit der industriellen Revolution. Sie beleuchtet die Entwicklung von der Konzentration in westlichen Industrieländern hin zu einem weltweiten Phänomen und führt die „World City-Hypothese“ Friedmanns ein. Sie führt in die Fragestellung ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Wie wird der Begriff "Metropolregion" definiert?
Das Kapitel "Definition: Metropolregion" definiert den Begriff "Metropolregion", der in Deutschland 1995 formell eingeführt wurde. Es zerlegt den Begriff in seine Bestandteile "Metropole" und "Region" und erläutert deren Bedeutung. Die Definition betont die Rolle von Metropolregionen als Motoren gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklung.
Welche Aspekte des deutschen Konzepts werden analysiert?
Der Abschnitt zum deutschen Konzept der Metropolregionen analysiert die Entstehung und Besonderheiten des Konzepts, die beteiligten Akteure, die aktuelle Situation der europäischen Metropolregionen in Deutschland und deren Entwicklung. Spezifische Merkmale und Charakteristika des deutschen Ansatzes, die als potentielle Vorbilder für andere europäische Länder in Betracht gezogen werden können, werden hervorgehoben.
Wie wird das deutsche Modell im Vergleich zur EU bewertet?
Das Kapitel zur Bewertung des deutschen Modells untersucht die ökonomischen, ökologischen und sozialen Vorteile eines polyzentrischen Systems (repräsentiert durch Metropolregionen) im Vergleich zu den Nachteilen eines monozentrischen Systems. Konkrete Beispiele und Argumente belegen die Vorzüge des deutschen Modells für eine nachhaltige Entwicklung in der EU. Die Vor- und Nachteile werden detailliert analysiert und im Kontext einer nachhaltigen Raumentwicklung bewertet.
Welche Vorteile eines polyzentrischen Systems werden hervorgehoben?
Die Arbeit hebt die ökonomischen, ökologischen und sozialen Vorteile eines polyzentrischen Systems (wie es durch Metropolregionen repräsentiert wird) im Vergleich zu den Nachteilen eines monozentrischen Systems hervor. Diese Vorteile werden detailliert im Kontext der nachhaltigen Raumentwicklung analysiert und mit konkreten Beispielen belegt.
- Quote paper
- Sascha Woditsch (Author), 2006, Metropolregionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51954