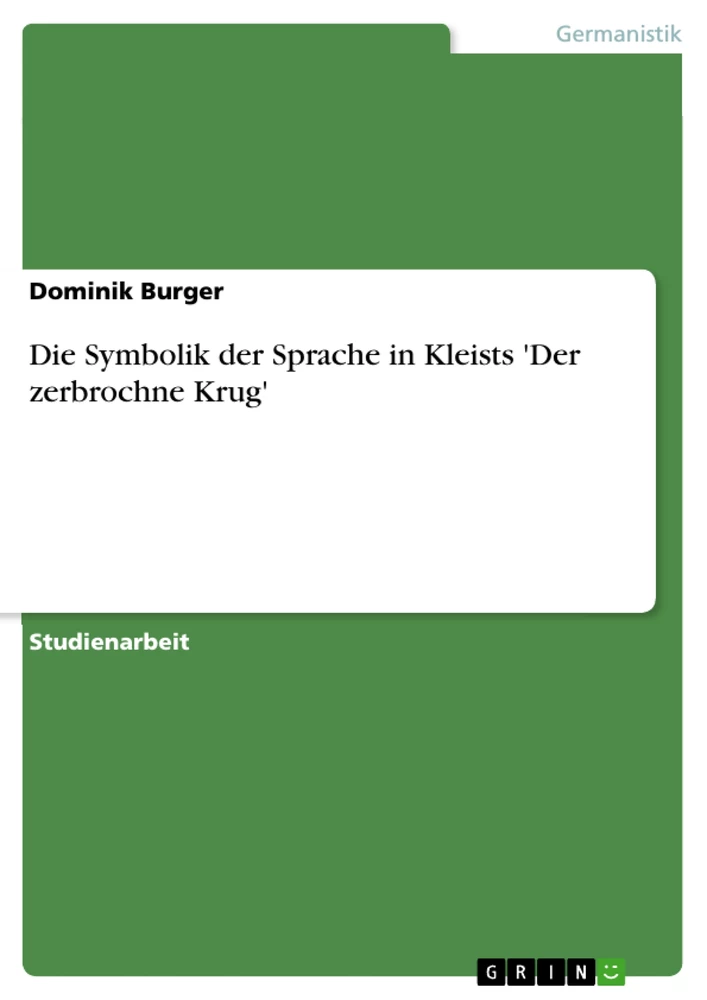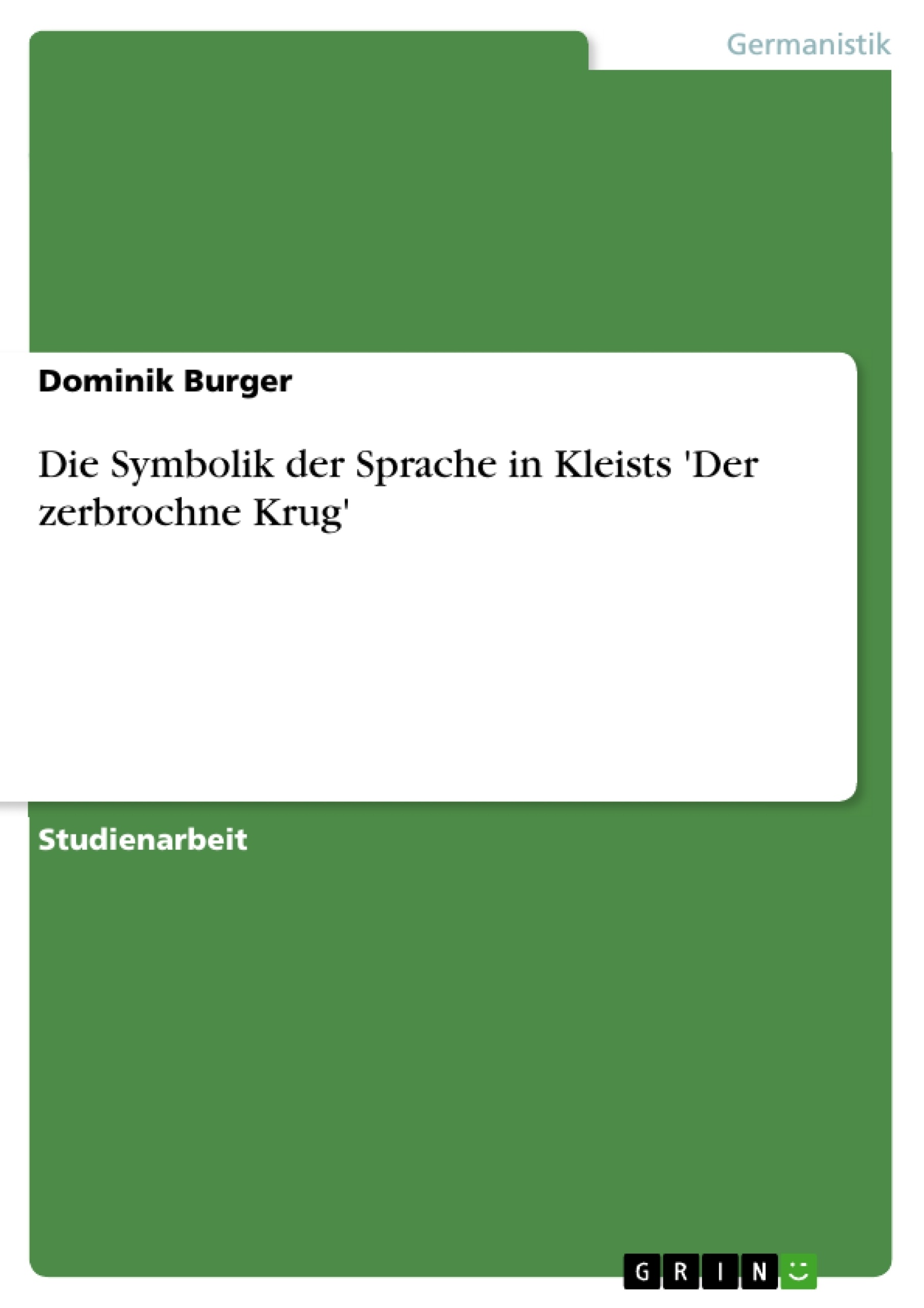Erzählt wird in Heinrich von Kleists „der zerbrochne Krug“ die Geschichte von Adam und Eve, die im Gerichtssaal eines niederländischen Dorfes bei Utrecht spielt. Dreh und Angelpunkt der Handlung bildet ein zerbrochener Krug. Dorfrichter Adam soll in einer Gerichtsverhandlung den Schuldigen finden, der den Krug zerbrochen hat. Mit der Untersuchung des Tathergangs offenbart sich Stück um Stück ein Sündenfall der besonderen Art. Kleist verwendet im „zerbrochnen Krug“, wie in wohl keinem zweiten seiner Werke, eine Sprache, die geradezu gespickt ist von Ausdrücken symbolischen Charakters. Die oft subtile Wortwahl sowie etliche Formulierungen und Phrasen, die zum Teil geradezu plakativ verwendet werden, manchmal aber auch nur indirekt angedeutet oder beim „zwischen den Zeilen lesen“ zu erkennen sind, transponieren das Lustsiel auf eine viel weitere, höhere Ebene als lediglich die Lösung eines Gerichtsverfahrens. Angefangen bei der Namensgebung der beteiligten Akteure und Schauplätze, über die Verwendung von angeführten Beweismitteln der ganz besonderen Art, bis hin zu allerorts gegenwärtigen Anspielungen auf die Bibel, im Besonderen auf das Alte Testament, überträgt Kleist das Geschehen von einem kleinen niederländischen Dörfchen auf das Format der „Weltbühne“, auf der sowohl die Politik und das Herrschaftssystem seiner Zeit sowie auch die Gesellschaft und nicht zuletzt die Religion kritisch vorgeführt werden. Der „zerbrochne Krug“ kann daher auch als ein „semiotisches Stück“ bezeichnet werden, ist doch eines der Hauptthemen der Unterschied oder aber auch die Gemeinsamkeit zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten, zwischen Signifikat und Signifikant. Die sprachlichen Mittel führen zu einer spannenden Dialektik von Verdeckung und Entdeckung. Diese Hausarbeit befasst sich mit der Symbolik der sprachlichen Mittel, die Kleist zu diesem Zweck im „zerbrochnen Krug“ verwendet und versucht aufzuzeigen, unter welchen Gesichtspunkten man die Handlung vom Dorfgerichtssaal auf die Geschehnisse der „Weltbühne“ übertragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik
- Die sinntragenden Namen
- Die Bedeutung des „Krugs“
- Die biblischen Motive im „zerbrochnen Krug“
- Die Symbolik der Sprache - ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Symbolik der Sprache in Heinrich von Kleists „Der zerbrochne Krug“, um aufzuzeigen, wie Kleist durch die Verwendung sprachlicher Mittel eine vielschichtige Ebene in das Stück einbringt. Die Arbeit untersucht, wie Kleist die Handlung des Dorfgerichtssaals auf die „Weltbühne“ überträgt und Themen wie Politik, Herrschaftssystem, Gesellschaft und Religion kritisch beleuchtet.
- Die sinntragenden Namen der Figuren
- Die Bedeutung des „zerbrochenen Krugs“ als Symbol
- Die biblischen Motive und ihre Funktion in der Handlung
- Die sprachliche Dialektik von Verdeckung und Entdeckung
- Die Übertragung der Handlung auf die „Weltbühne“
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in die Thematik
Das Stück „Der zerbrochne Krug“ erzählt die Geschichte von Adam und Eve in einem niederländischen Dorf. Der zerbrochene Krug bildet den zentralen Konfliktpunkt, der im Verlauf der Gerichtsverhandlung zu einem „Sündenfall der besonderen Art“ führt. Kleists Verwendung von sprachlichen Symbolen trägt dazu bei, das Lustspiel auf eine höhere Ebene zu heben.
Die sinntragenden Namen
Die Namen der Figuren im „zerbrochnen Krug“ sind sinntragend und charakterisieren die Personen und ihre Rolle im Stück. Besonders die biblischen Namen Adam und Eve verweisen auf den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Garten Eden. Die Namen wie Ruprecht Tümpel und Schreiber Licht sind charakteristisch für das Verhalten und die Bedeutung der Figuren.
Die Bedeutung des „Krugs“
Die Bedeutung des „Krugs“ wird im Text noch nicht näher erläutert. Es wird lediglich auf seine zentrale Rolle im Konflikt hinweisen, der im Verlauf des Stückes immer deutlicher wird.
Die biblischen Motive im „zerbrochnen Krug“
Die biblischen Motive, besonders aus dem Alten Testament, spielen eine wichtige Rolle im Stück. Kleist stellt Parallelen zwischen der biblischen Geschichte von Adam und Eva und der Handlung des „zerbrochenen Krugs“ her, indem er die Rollen der beiden Protagonisten umkehrt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen des Textes sind „Symbolik“, „Sprache“, „Sündenfall“, „Bibel“, „Weltbühne“, „Kleist“, „Der zerbrochene Krug“, „Theater“, „Lustspiel“, „Gesellschaft“, „Politik“, „Herrschaftssystem“, „Religion“, „Signifikant“, „Signifikat“, „Verdeckung“, „Entdeckung“.
- Quote paper
- B.A. Dominik Burger (Author), 2004, Die Symbolik der Sprache in Kleists 'Der zerbrochne Krug', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51875