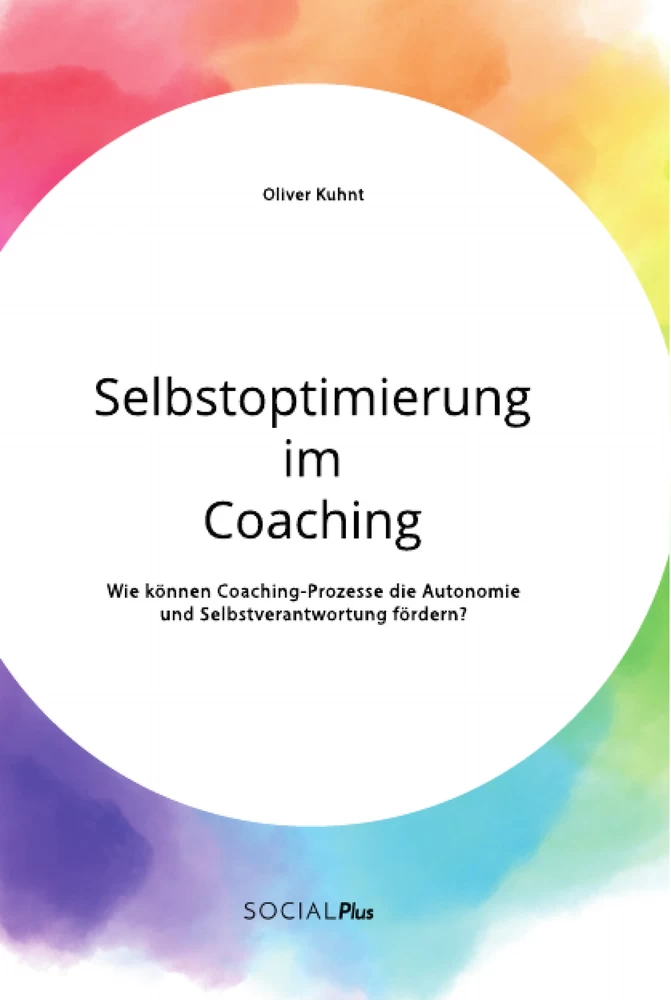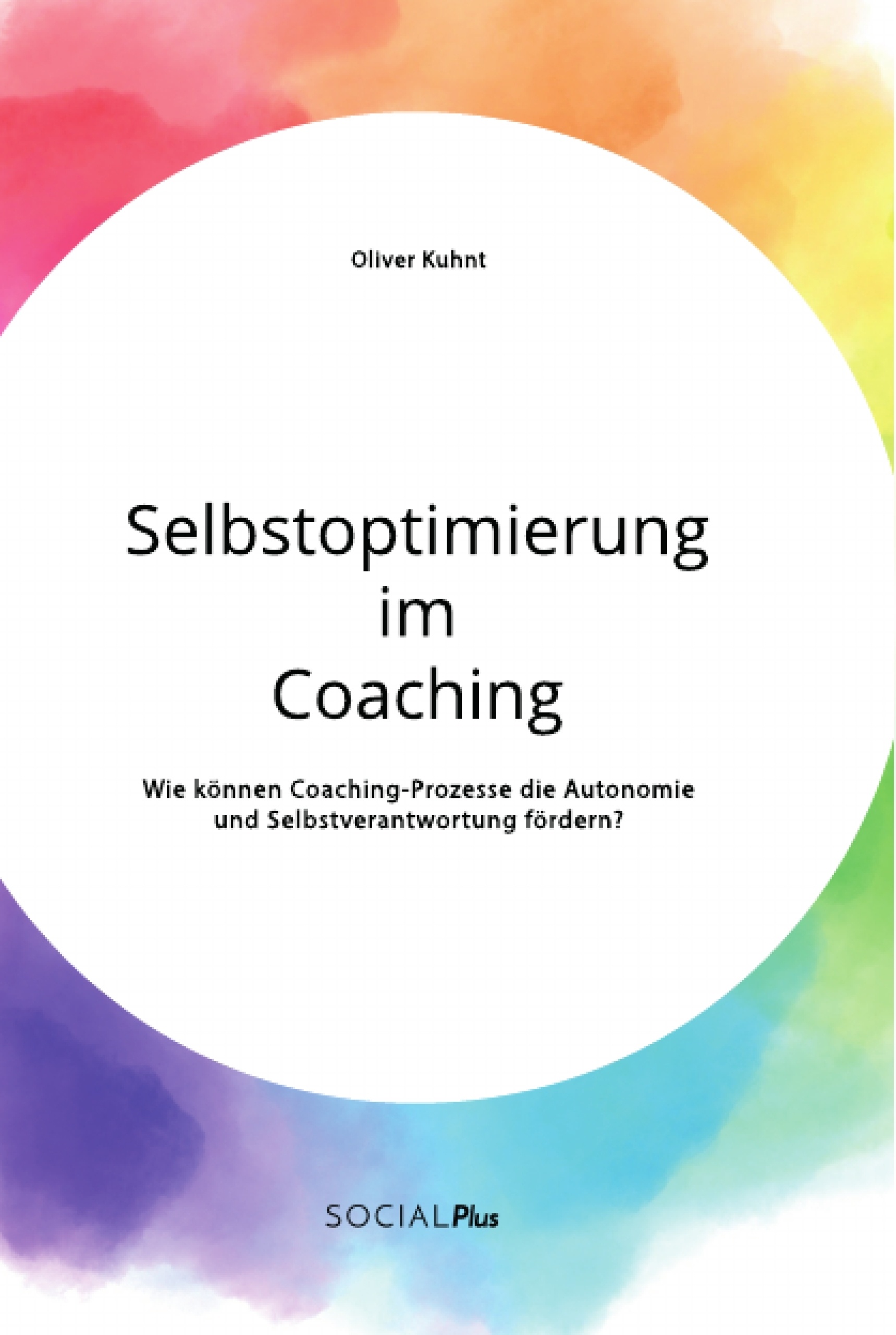Die Sorge um das körperliche und geistige Wohlbefinden treibt die Menschen schon seit Jahrtausenden um. Der Mensch möchte autonom und unabhängig sein. Dies widerspricht jedoch den modernen Optimierungskulturen, verkörpert von Beratern, Psychologen oder Therapeuten. Denn mit solchen Beratungsangeboten geht stets eine gewisse Abhängigkeit einher.
Wie können Coaching-Prozesse das auteronome Subjekt fördern und erhalten? Welche Stellung sollte das Subjekt im Coaching einnehmen? Welche Funktion erfüllt hierbei der Coach? Und wie wirken sich die angewandten Methoden des Coaches auf das auteronome Subjekt aus?
Oliver Kuhnt beleuchtet das Themenfeld der Selbstoptimierung und setzt sich dabei mit dem paradoxen menschlichen Streben nach Selbstoptimierung durch Coaching auseinander. Anhand von Handbüchern und Anleitungen für angehende Berater und Coaches zeigt Kuhnt, wie man Coaching-Angebote annehmen und gleichzeitig selbstbestimmt bleiben kann.
Aus dem Inhalt:
- Optimierungsdienstleistung;
- Neuroenhancement;
- Selbsterkenntnis;
- Psychoanalyse;
- Selbsthilfe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sorge um sich selbst
- Suche nach der Wahrheit
- Die „therapeutische Kultur“
- Der Aufstieg der Psychoanalyse
- Die Vermischung von Populärkultur und Psychologie
- Selbsthilfe und Humanistische Psychologie
- Der Wandel zur „Optimierungskultur“
- Der Kapitalismus als eine der Triebfedern für Selbstoptimierung
- Subjektivierung in der „Optimierungskultur“
- Subjektivierung und Gouvernementalität
- Das „auteronome“ Subjekt in der Kultur der Optimierung
- Selbstoptimierung als Oberbegriff
- Beispielpraxis zur Selbstoptimierung: Neuroenhancement
- Fazit zum Begriff der Selbstoptimierung
- Coaching als Selbstoptimierungs- Praxis
- Selbstverständnis der Coaching- Praxis anhand verschiedenen Quellen
- Coaching- Markt und Abgrenzung zur Therapie
- Fazit: Betrachtung der Coaching- Praxis als Selbstoptimierung
- Das „auteronome“ Subjekt im Coaching
- Anleitungsbeispiel Nr. 1 aus der Coaching- Praxis: „Zukunftsentwürfe“
- Anleitungsbeispiel Nr. 2: Das „eigentliche“ Thema finden
- Fazit: Untersuchte Praxisbeispiele aus dem Coaching
- Technische Entwicklungen im Bereich Coaching und Selbstoptimierung
- Der „Taschen-Coach“
- Abschließendes Fazit der vorliegenden Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Selbstoptimierung im Kontext der „Optimierungskultur“ und analysiert, wie Coaching-Prozesse die Autonomie und Selbstverantwortung fördern können. Sie verfolgt dabei das Ziel, die historischen Wurzeln des Strebens nach Selbstoptimierung aufzuzeigen und die Rolle des Coachings in diesem Prozess zu beleuchten.
- Die historischen Wurzeln der Selbstoptimierung
- Die „Optimierungskultur“ und ihre Auswirkungen auf das Subjekt
- Coaching als Praxis der Selbstoptimierung
- Das „auteronome“ Subjekt im Coaching
- Technische Entwicklungen im Bereich Coaching und Selbstoptimierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der Sorge um das eigene Selbst und führt den Leser in das Thema der Selbstoptimierung ein.
- Die Sorge um sich selbst: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Streben nach Selbstoptimierung und analysiert dessen historische Wurzeln, indem es auf die Lehren der Philosophen der Antike bis hin zur Entwicklung der Humanistischen Psychologie im 20. Jahrhundert eingeht.
- Die „therapeutische Kultur“: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung und Verbreitung der „therapeutischen Kultur“ und beleuchtet den Aufstieg der Psychoanalyse, die Vermischung von Populärkultur und Psychologie sowie die Rolle der Selbsthilfe und Humanistischen Psychologie.
- Der Wandel zur „Optimierungskultur“: Dieses Kapitel analysiert den Wandel von der „therapeutischen Kultur“ hin zur „Optimierungskultur“ und zeigt den Kapitalismus als eine der Triebfedern für Selbstoptimierung auf.
- Subjektivierung in der „Optimierungskultur“: Dieses Kapitel erforscht die Subjektivierungsprozesse in der „Optimierungskultur“ und beleuchtet die Konzepte der Gouvernementalität und des „auteronomen“ Subjekts.
- Selbstoptimierung als Oberbegriff: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Selbstoptimierung und beleuchtet verschiedene Praktiken, wie beispielsweise Neuroenhancement, die in diesen Zusammenhang fallen.
- Coaching als Selbstoptimierungs- Praxis: Dieses Kapitel betrachtet Coaching als eine Praxis der Selbstoptimierung und analysiert das Selbstverständnis der Coaching-Praxis anhand verschiedener Quellen. Außerdem wird der Coaching-Markt im Vergleich zur Therapie beleuchtet.
- Das „auteronome“ Subjekt im Coaching: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des „auteronomen“ Subjekts im Coaching und untersucht verschiedene Praxisbeispiele, wie beispielsweise die Erstellung von „Zukunftsentwürfen“ und die Suche nach dem „eigentlichen“ Thema.
- Technische Entwicklungen im Bereich Coaching und Selbstoptimierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen technischer Entwicklungen auf den Bereich Coaching und Selbstoptimierung und präsentiert Beispiele wie den „Taschen-Coach“.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Arbeit befasst sich mit den Themen Selbstoptimierung, Coaching, „Optimierungskultur“, Subjektivierung, Autonomie, Selbstverantwortung, „auteronome“ Subjekte, historische Entwicklung und technische Entwicklungen. Diese Begriffe bilden den Fokus der Untersuchung und werden im Kontext der heutigen Gesellschaft analysiert.
- Quote paper
- Oliver Kuhnt (Author), 2020, Selbstoptimierung im Coaching. Wie können Coaching-Prozesse die Autonomie und Selbstverantwortung fördern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/518483