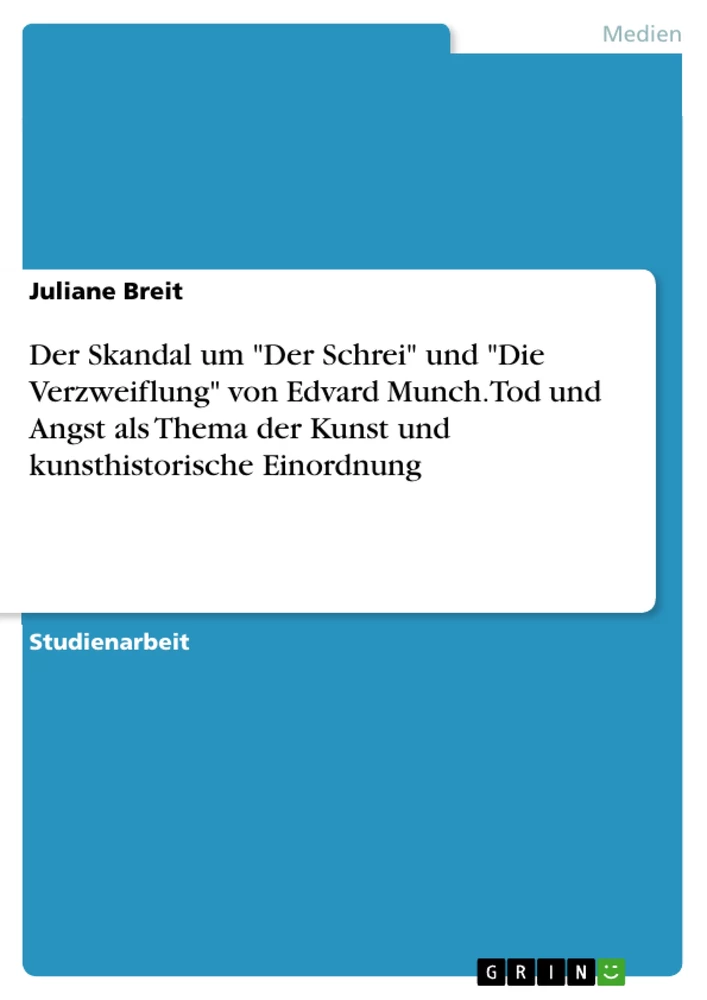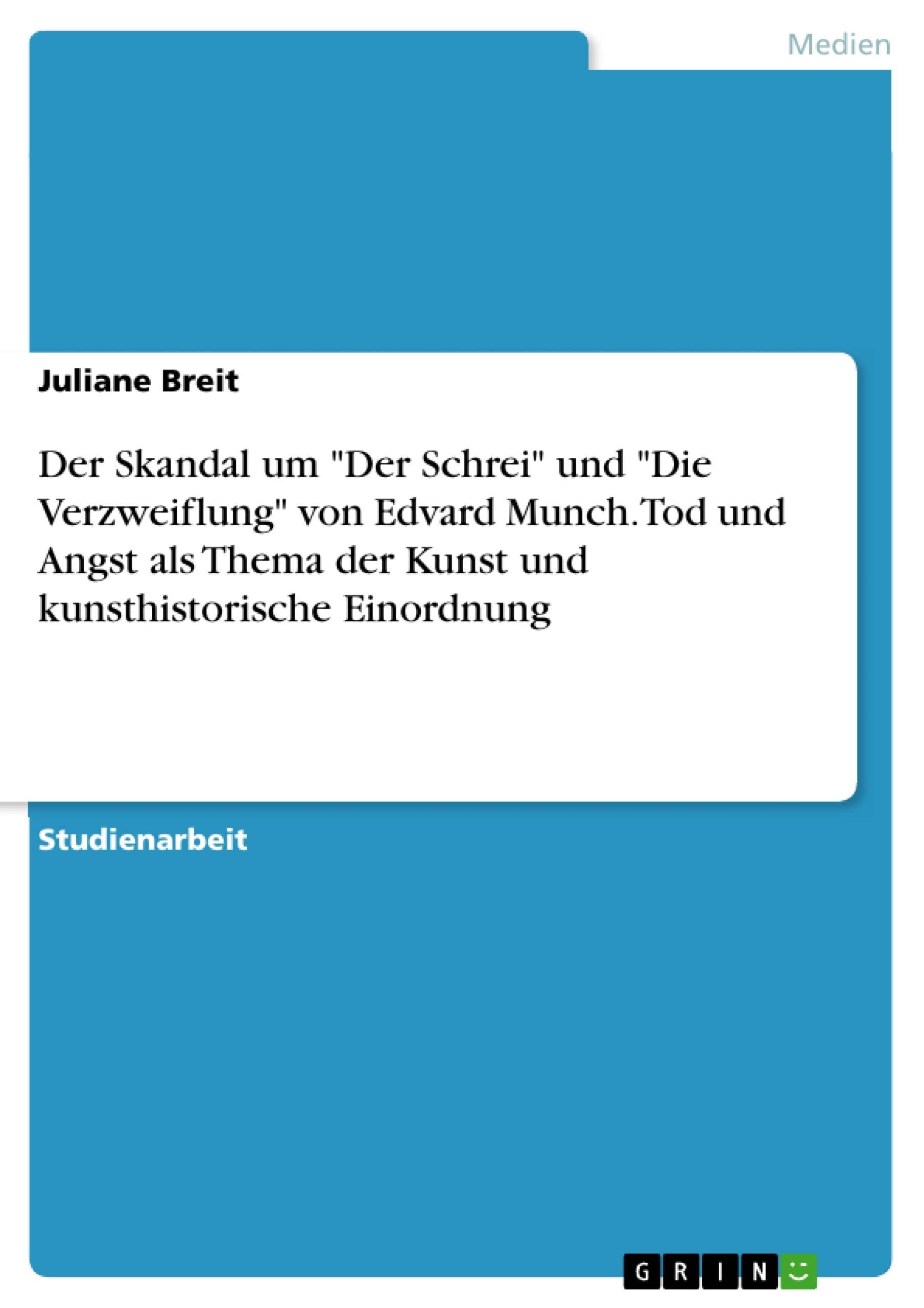Diese Arbeit widmet sich dem Skandal, den die beiden Bilder "Der Schrei" (1893-1910) und "Die Verzweiflung" (1892) des norwegischen Malers Edvard Munch in der damaligen Zeit entfachten. Wie allseits bekannt, prägte Munch dem Expressionismus. Exemplarisch dafür steht vor Allem sein Werk "Der Schrei", welches anders als alle anderen damaligen Werke war und für so viel Entsetzen sorgte, sodass Munch auf etwas andere Art und Weise zu Weltruhm gelangte.
In allen Mündern, die sich die Menschen über den Maler zerrissen, so zerrissen war auch Edvard Munchs Seele, die ihn in wohl letztendlich dazu bringt, paralysierende Angst und Tod in seinen Bildern darzustellen und den Betrachter unverschont damit zu konfrontieren. Zur damaligen Zeit unvorstellbar und gar unerhört den Ausstellungsbesucher solchem Geschmiere auszusetzen – ein Anblick, der für das Publikum kaum ertragbar war.
Zu Beginn dieser Arbeit soll eine generelle Bildbeschreibung der beiden Werke "Die Verzweiflung" und "Der Schrei" Edvard Munchs stehen. Ersteres wird vorangehend beschrieben, da es als Vorwerk zum ein Jahr später entstandenen Werk "Der Schrei" angesehen wird. Als Hauptteil der Arbeit folgt der Skandal um die beiden Bilder, der durch das damalige hoch konservative Ausstellungspublikum entstand, weite Kreise zog und Munch gar nicht mehr loslassen wollte.
Daraufhin sollen die Gründe für den Skandal einzeln und ausführlich erläutert werden, wobei hier als erstes auf den größten Ausstellungsskandal Munchs in Berlin eingegangen werden soll. Weiterhin ist es essenziell die ungewöhnlichen Themen, wie Tod, Angst und Verzweiflung, von denen sich Edvard Munch bedient, in den Fokus zu rücken und dessen Ursprünge zu analysieren. Hier soll auch auf das unglückliche Familienschicksal Munchs Bezug genommen werden, das er in seinen beiden Bildern wohl zu verarbeiten versuchte. Anschließend ist eine kunsthistorische Einordnung unerlässlich.
Die Bilder Munchs sollten mit denen anderer Maler verglichen werden, um den Skandal um seine Werke – aber auch seine Fortschrittlichkeit – besser verstehen zu können. Hier ist es wichtig, nationale Maler wie Anton von Werner und Max Liebermann heranzuziehen, aber auch nach Frankreich zu blicken, wo bereits der Impressionismus zuhause war. Zum Schluss soll noch Bezug auf ähnliche Darstellungen im Bezug auf "Der Schrei" und "Die Verzweiflung" genommen werden, ebenso wie Werke anderer Maler, die den Norweger inspiriert haben könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildbeschreibung
- „Die Verzweiflung“
- „Der Schrei“
- Der Skandal um die Werke „Der Schrei“ und „Die Verzweiflung“
- Der Skandal im Kontext
- Ausstellung in Berlin und das konservative Publikum
- Psychologische Malerei: Tod und Angst als zentrales Thema
- Kunsthistorische Einordnung
- Deutschland
- Frankreich
- Ähnliche Darstellungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Skandalen, die die beiden Bilder „Der Schrei“ und „Die Verzweiflung“ des norwegischen Malers Edvard Munch in der damaligen Zeit auslösten. Ziel ist es, die Gründe für diese Kontroversen zu analysieren und Munchs Werke im Kontext der Kunst seiner Zeit zu betrachten.
- Der Skandal um Munchs Werke in Berlin und der Einfluss des konservativen Publikums
- Die Rolle des Todes und der Angst als zentrale Themen in Munchs Kunst
- Die künstlerische Entwicklung von Munch im Vergleich zu seinen Zeitgenossen, insbesondere in Deutschland und Frankreich
- Die Suche nach ähnlichen Darstellungen und Inspirationsquellen für Munchs „Der Schrei“ und „Die Verzweiflung“
- Die Bedeutung von Munchs Werk für die Entstehung des Expressionismus.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine allgemeine Einleitung, die den Fokus der Arbeit auf die Skandale um die Werke „Der Schrei“ und „Die Verzweiflung“ legt. Das zweite Kapitel widmet sich der Beschreibung der beiden Gemälde, wobei „Die Verzweiflung“ als Vorwerk zum „Schrei“ betrachtet wird. Im dritten Kapitel werden die Skandale um die beiden Werke im Detail beschrieben, mit besonderem Augenmerk auf die harsche Kritik des konservativen Ausstellungspublikums. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Gründen für diese Kritik und analysiert die Themen Tod und Angst als zentrale Motive in Munchs Kunst. Hier wird auch auf das Familienschicksal von Edvard Munch eingegangen und seine Werke im Kontext der Kunst seiner Zeit, insbesondere in Deutschland und Frankreich, betrachtet. Zum Schluss wird in diesem Kapitel auf ähnliche Darstellungen von Angst und Verzweiflung in der Kunstgeschichte eingegangen, um die Besonderheit von Munchs Werken zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Edvard Munch, „Der Schrei“, „Die Verzweiflung“, Skandal, Expressionismus, psychologischer Naturalismus, Angst, Tod, Verzweiflung, konservatives Publikum, Anton von Werner, Max Liebermann, Impressionismus, Symbolismus, Laokoon, Charles Darwin, Søren Kierkegaard, Fyodor Dostojewski
- Quote paper
- Juliane Breit (Author), 2019, Der Skandal um "Der Schrei" und "Die Verzweiflung" von Edvard Munch. Tod und Angst als Thema der Kunst und kunsthistorische Einordnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/518346