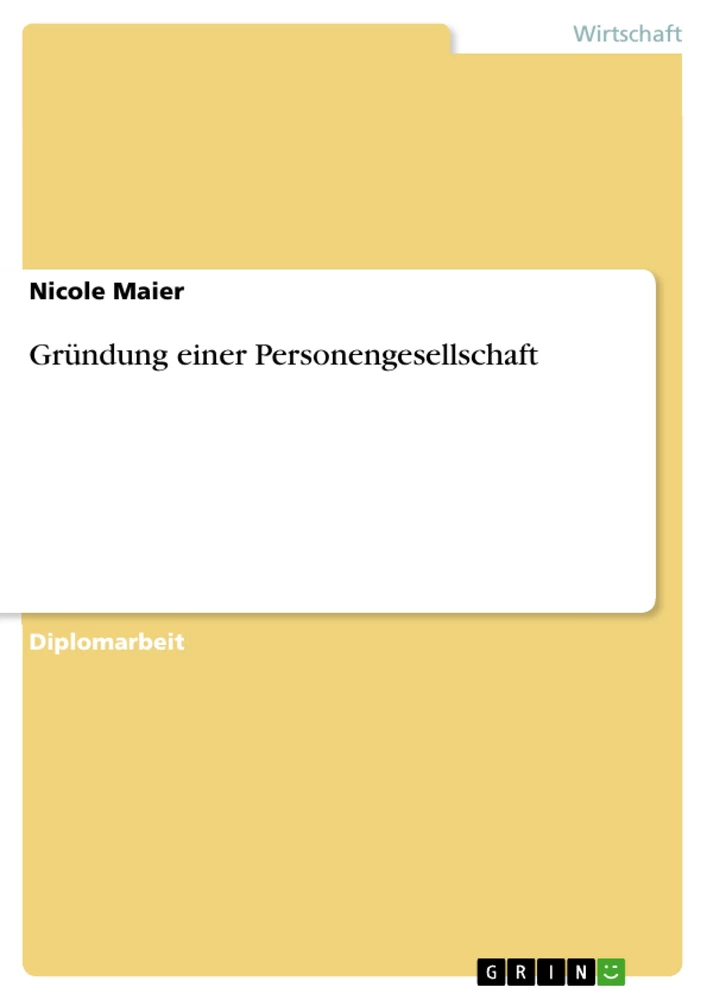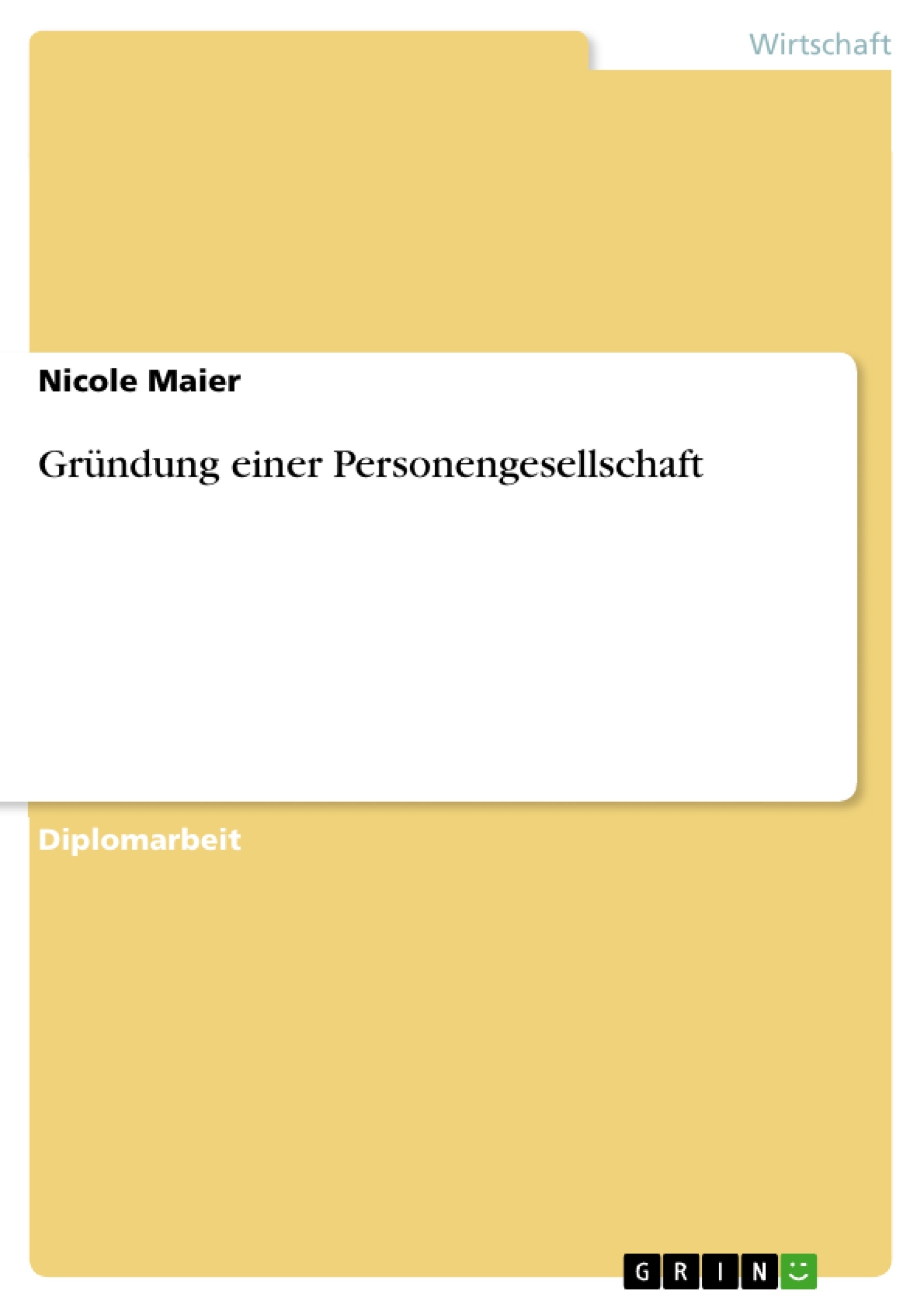Die Spezies der Unternehmer müsste in Deutschland eigentlich ausgestorben sein, dennin keinem anderen hoch entwickelten Land wird es den Existenzgründern so schwer gemacht. Durchschnittlicht benötigt der angehende Unternehmer 45 Tage, bis er ein Unternehmen eröffnen darf. In Großbritannien erfordert die Eröffnung des Unternehmens nur achtzehn Tage, in Frankreich acht Tage und in den USA unschlagbare fünf Tage. Doch trotz der zu nehmenden Hürden durch die Behörden, steigt die Zahl der Gründungen in Deutschland. Nach einer Statistik des Statistischen Bundesamtes vom 13.06.2005 fanden im März 2005 insgesamt 61.548 Existenzgründungen in Deutschland statt. Dieser statistischen Erhebung zufolge und der steigenden Zahl der Gründungen in den letzten Jahren erweitert sich für den steuerberatenden Berufsstand das Beratungsfeld in Bezug auf die Beratung bei den Unternehmensgründern erheblich. Die Beratungstätigkeit reicht von der Hilfe bei der Entscheidung der Rechtformwahl, über die Mithilfe des Gewerbeanmeldebogens bis hin zur Hilfeleistung bei Bankgesprächen. Die Wahl der Rechtsform ist für den Existenzgründer von großer Bedeutung, da sich danach die steuerlichen und handelsrechtlichen Folgen richten. Hinsichtlich der Statistik des Statistischen Bundesamtes wurden 3.994 PersGes neu gegründet, was einem Prozentsatz von 6,49 entspricht. In der Diplomarbeit soll im Nachfolgenden lediglich auf die Gründung der PersGes eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Umfang und Ziel der Arbeit
- 3 Formen der Gründung
- 3.1 Bargründung
- 3.2 Sachgründung
- 3.2.1 Allgemeines
- 3.2.2 Einlage einzelner Wirtschaftsgüter aus dem Privatvermögen
- 3.2.3 Überführung / Übertragung aus dem Betriebsvermögen
- 3.2.3.1 Allgemeines
- 3.2.3.2 Unentgeltliche Übertragung
- 3.2.3.2.2 Aufnahme einer natürlichen Person in ein Einzelunternehmen
- 3.2.3.2.3 Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils
- 3.2.3.3 Entgeltliche Überführung
- 3.2.3.4 Teilentgeltliche Übertragung
- 3.2.3.5 Ergänzungsbilanzen
- 3.3 Einbringung eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunternehmeranteils
- 3.3.1 Regelungsinhalt des § 24 UmwStG
- 3.3.1.1 Anwendungsgebiet / Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 UmwStG
- 3.3.1.2 Negativabgrenzung der Fälle in § 24 UmwStG
- 3.3.1.3 Zeitpunkt der Einbringung
- 3.3.2 Bewertungswahlrecht nach § 24 Abs. 2 UmwStG
- 3.3.2.1 Allgemeines
- 3.3.2.2 Buchwertansatz
- 3.3.2.3 Zwischenwertansatz
- 3.3.2.4 Teilwertansatz
- 3.3.3 Einbringungsgewinn nach § 24 Abs. 3 UmwStG
- 3.3.4 Folgen der Wahlrechtsausübung
- 3.3.4.1 Gesamthandsbilanzen und Ergänzungsbilanzen
- 3.3.4.2 Bilanzerstellung
- 3.3.4.3 Maßgeblichkeit
- 3.3.5 Steuerliche Problematiken
- 3.3.5.1 Vorabübertragung von Wirtschaftsgütern
- 3.3.5.2 Zurückbehaltung von Wirtschaftsgütern
- 3.3.5.3 Bestimmung des Kapitalkontos
- 3.3.5.4 Einbringung einer Pensionsverpflichtung
- 3.3.5.5 Einbringung einer steuerfreien Rücklage
- 3.3.5.6 Einbringung mit negativem Kapital
- 4 Steuerliche Konsequenzen
- 4.1 Steuerliche Konsequenzen für die aufnehmende Personengesellschaft
- 4.2 Steuerliche Konsequenzen für den einbringenden Gesellschafter
- 5 Fazit
- Abbildungen
- Anhang
- Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsanweisungen
- Rechtsprechungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen der Gründung einer Personengesellschaft.
- Es werden die steuerlichen Auswirkungen der Einbringung eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunternehmeranteils beleuchtet.
- Die Arbeit untersucht das Bewertungswahlrecht nach § 24 UmwStG und die Folgen der Wahlrechtsausübung.
- Es werden die steuerlichen Konsequenzen für die aufnehmende Personengesellschaft und den einbringenden Gesellschafter untersucht.
- Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Steuerprobleme, die im Zusammenhang mit der Einbringung von Wirtschaftsgütern in eine Personengesellschaft auftreten können.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Gründung einer Personengesellschaft und untersucht die steuerlichen Konsequenzen einer Einbringung eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunternehmeranteils in eine Personengesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Gründung einer Personengesellschaft im Steuerrecht dar und führt in die Thematik der Einbringung von Betriebsvermögen ein.
Kapitel 2: Umfang und Ziel der Arbeit
Dieses Kapitel definiert den Umfang und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird erläutert, welche Aspekte der Gründung einer Personengesellschaft im Detail behandelt werden.
Kapitel 3: Formen der Gründung
Kapitel 3 behandelt die verschiedenen Formen der Gründung einer Personengesellschaft, insbesondere die Sachgründung und die Einbringung eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunternehmeranteils.
Kapitel 3.2 Sachgründung
Dieses Unterkapitel behandelt die Einlage von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen und die Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen.
Kapitel 3.3 Einbringung eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunternehmeranteils
Dieses Unterkapitel erläutert die Regelungen des § 24 UmwStG, das Bewertungswahlrecht, die Folgen der Wahlrechtsausübung und die steuerlichen Problematiken im Zusammenhang mit der Einbringung.
Kapitel 4: Steuerliche Konsequenzen
Kapitel 4 befasst sich mit den steuerlichen Konsequenzen für die aufnehmende Personengesellschaft und den einbringenden Gesellschafter.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die steuerlichen Auswirkungen der Einbringung eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunternehmeranteils in eine Personengesellschaft. Daher sind die wichtigsten Schlüsselwörter: Personengesellschaft, Gründung, Einbringung, Betriebsvermögen, § 24 UmwStG, Bewertungswahlrecht, Steuerliche Konsequenzen, Gesamthandsbilanzen, Ergänzungsbilanzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Sachgründung bei einer Personengesellschaft?
Bei einer Sachgründung werden statt Bargeld Wirtschaftsgüter (z.B. Maschinen, Immobilien) aus dem Privat- oder Betriebsvermögen in die Gesellschaft eingebracht.
Was regelt § 24 UmwStG?
Er regelt die steuerlichen Bedingungen für die Einbringung von Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen in eine Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten.
Welche Bewertungswahlrechte gibt es?
Einbringende können zwischen dem Buchwertansatz (steuerneutral), dem Teilwertansatz (Aufdeckung aller Reserven) oder einem Zwischenwert wählen.
Was sind Ergänzungsbilanzen?
Sie dienen dazu, Wertunterschiede zwischen dem steuerlichen Kapitalkonto in der Gesamthandsbilanz und den individuellen Anschaffungskosten eines Gesellschafters festzuhalten.
Welche Folgen hat die Einbringung mit negativem Kapital?
Dies ist eine steuerliche Problematik, die oft zur Aufdeckung stiller Reserven und somit zu einem steuerpflichtigen Einbringungsgewinn führt.
- Quote paper
- Nicole Maier (Author), 2005, Gründung einer Personengesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51805