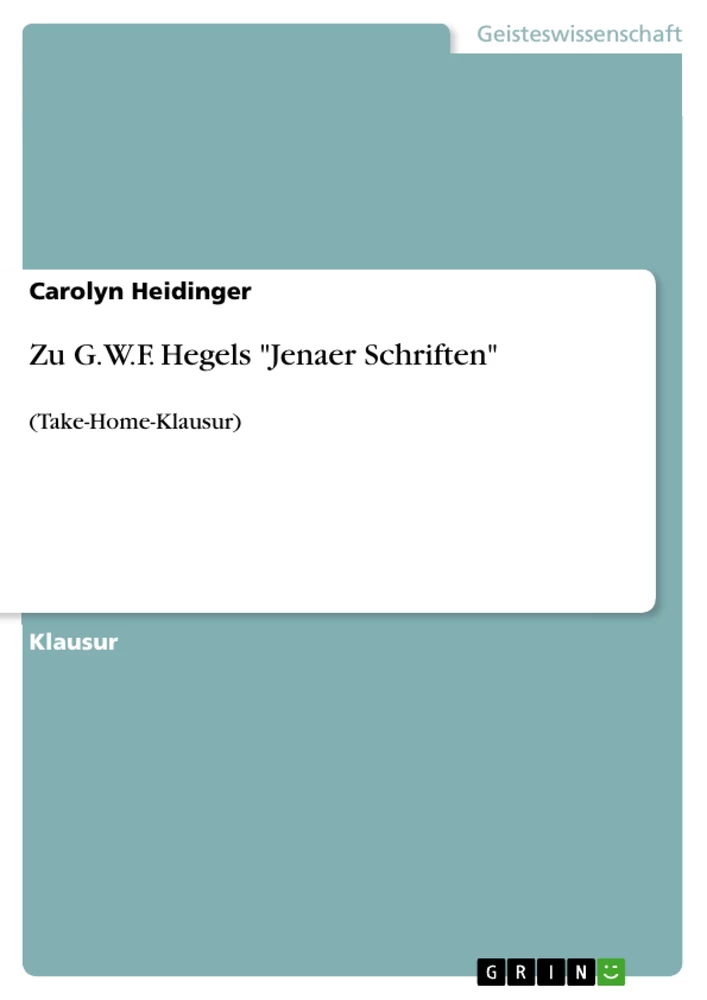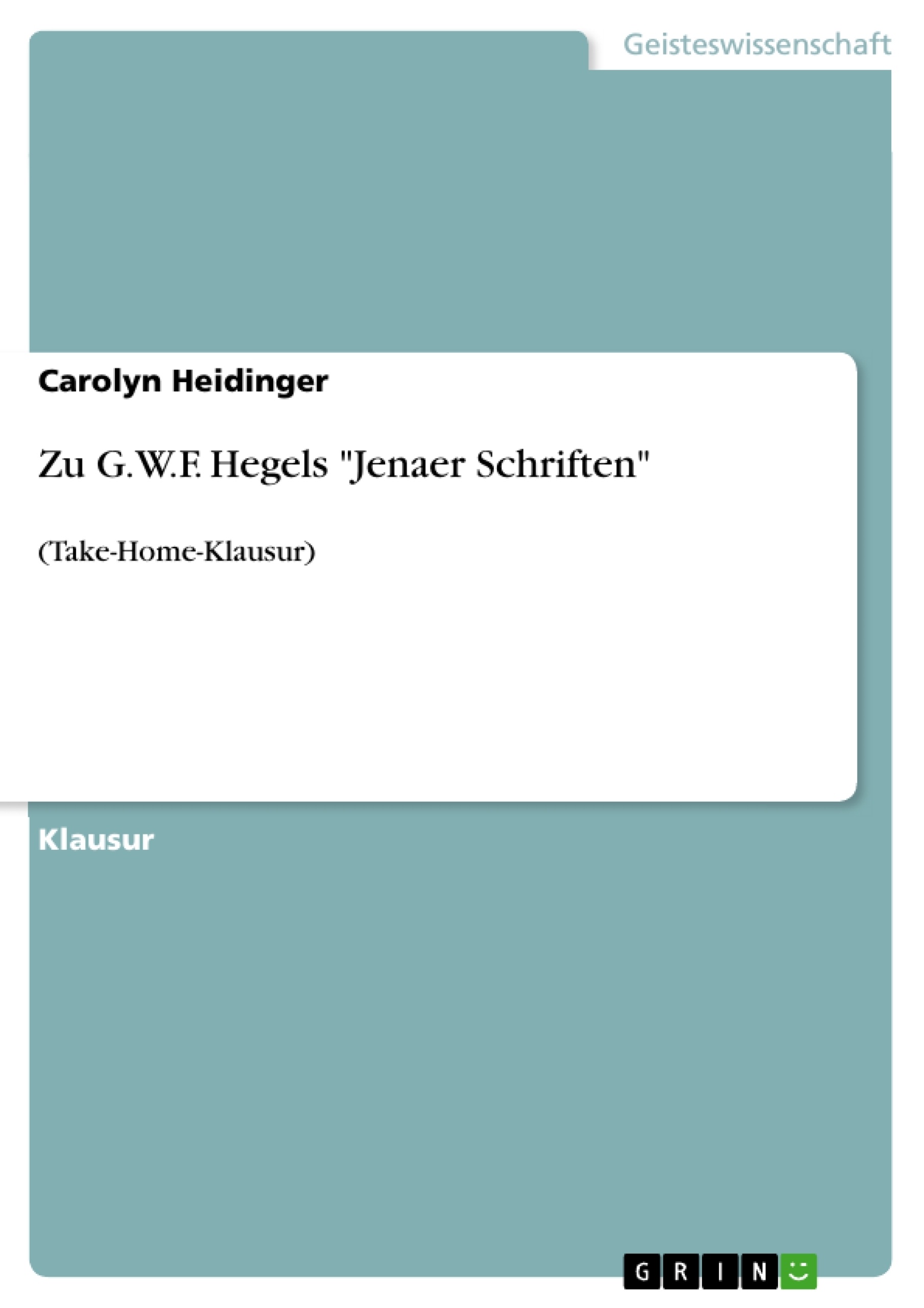Diese Arbeit mit dem Titel "Zu G.W.F. Hegels "Jenaer Schriften"" enthält die Ausarbeitung folgender Klausurfragen (inklusive eines Literaturverzeichnisses):
- Erläuterung zur folgenden These Hegels: „das wahre Bedürfniß der Philosophie geht doch wohl auf nichts anders als darauf, von ihr und durch sie leben zu lernen.“;
- Inwiefern unterscheidet der frühe Hegel „Reflexion“ und „Spekulation“?;
- In welchem Verhältnis steht Hegels Begriff der Philosophie zum sogenannten „allgemeinen Menschenverstand“?;
Inhaltsverzeichnis
- Erläutern Sie die folgende These Hegels: „das wahre Bedürfniß der Philosophie geht doch wohl auf nichts anders als darauf, von ihr und durch sie leben zu lernen.“¹
- Inwiefern unterscheidet der frühe Hegel „Reflexion“ und „Spekulation“?
- In welchem Verhältnis steht Hegels Begriff der Philosophie zum sogenannten „allgemeinen Menschenverstand“?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit Hegels Philosophie und untersucht seine Ansichten über die Beziehung zwischen Philosophie und Leben, sowie die Unterscheidung zwischen Reflexion und Spekulation und das Verhältnis von Hegels Philosophie zum "allgemeinen Menschenverstand".
- Die Beziehung zwischen Philosophie und Leben
- Hegels Unterscheidung zwischen Reflexion und Spekulation
- Hegels Kritik am "allgemeinen Menschenverstand"
- Die Rolle der Vernunft und Objektivität in Hegels Philosophie
- Die Bedeutung der Dialektik als Denkprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Erläutern Sie die folgende These Hegels: „das wahre Bedürfniß der Philosophie geht doch wohl auf nichts anders als darauf, von ihr und durch sie leben zu lernen.“¹
Hegel argumentiert, dass die Philosophie uns lehrt, wie wir durch sie und von ihr leben können. Er stellt die Philosophie als Quelle der Vernunft dar, die das Absolute, das Unabhängige und das Allumfassende Ganze im Gegensatz zum Individuellen und Besonderen repräsentiert. Hegel unterscheidet zwischen Philosophie und Philosophieren, wobei letzteres subjektiv betrieben werden kann und somit Scheinphilosophie sein kann. Das Aufheben des subjektiven Besonderen ist ein Denkprozess, der von der Subjektivität zur Objektivität führt. Dieser Prozess umfasst drei Schritte: Negieren, Konservieren und Erheben. Die Vernunft ist das Leben und wird erkannt, wenn die Vernunft erkannt wird. Dies ist eine fortlaufende Bewegung, die mit der Wissenschaft beginnt.
2. Inwiefern unterscheidet der frühe Hegel „Reflexion“ und „Spekulation“?
Hegel definiert Spekulation als unendliche Erkenntnis, Vernunft und das Erkennen von Einheit, Identität und dem Zusammenhang. Reflexion hingegen steht für endliche Erkenntnis, Verstand und das Fokussieren auf das Einzelne statt auf das Ganze. Hegel sieht Reflexion als Unphilosophie an. Obwohl beide gegensätzlich sind, benötigen sie sich gegenseitig, da die Reflexion überwunden werden muss, um zur Spekulation zu gelangen. Die Spekulation wiederum muss über die Reflexion hinausgehen, um die Bewegung der Vernunft mitzumachen.
3. In welchem Verhältnis steht Hegels Begriff der Philosophie zum sogenannten „allgemeinen Menschenverstand“?
Hegel betont, dass Philosophie esoterisch ist und dem inneren Kreis zugänglich ist, während der "allgemeine Menschenverstand" die Philosophie nicht wirklich verstehen kann. Er kritisiert den "allgemeinen Menschenverstand" als eine besondere Reflexionsform, die die Vernunft nicht erfasst. Hegel unterscheidet sein Verständnis von Philosophie von dem des "allgemeinen Menschenverstands", indem er zwischen Objektivität und Subjektivität, Philosophie und Unphilosophie sowie Spekulation und Reflexion trennt. Obwohl sich die Philosophie niemals zum Volk erniedrigen wird, kann sich das Volk dennoch zur Philosophie emporheben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Philosophie, Leben, Vernunft, Reflexion, Spekulation, "allgemeiner Menschenverstand", Objektivität, Subjektivität, Dialektik, Negieren, Konservieren, Erheben, Hegel, Metaphysik, Logik, Wissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Hegel mit „von der Philosophie leben lernen“?
Er versteht Philosophie als Quelle der Vernunft, die dem Individuum hilft, sich vom subjektiven Besonderen zum objektiven Ganzen zu erheben.
Was ist der Unterschied zwischen Reflexion und Spekulation bei Hegel?
Reflexion ist endliche Verstandeserkenntnis des Einzelnen; Spekulation ist unendliche Vernunfterkenntnis der Einheit und des Zusammenhangs.
Wie steht Hegel zum „allgemeinen Menschenverstand“?
Hegel kritisiert ihn als eine Form der Reflexion, die die Tiefe der spekulativen Philosophie nicht erfassen kann, da Philosophie „esoterisch“ sei.
Was sind die drei Schritte des dialektischen Denkprozesses?
Der Prozess umfasst das Negieren, Konservieren und Erheben, um von der Subjektivität zur Objektivität zu gelangen.
Kann jeder Philosophie verstehen?
Nach Hegel erniedrigt sich die Philosophie nicht zum Volk, aber das Volk kann sich durch Bildung zur Philosophie emporheben.
- Quote paper
- Carolyn Heidinger (Author), 2019, Zu G.W.F. Hegels "Jenaer Schriften", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/517320