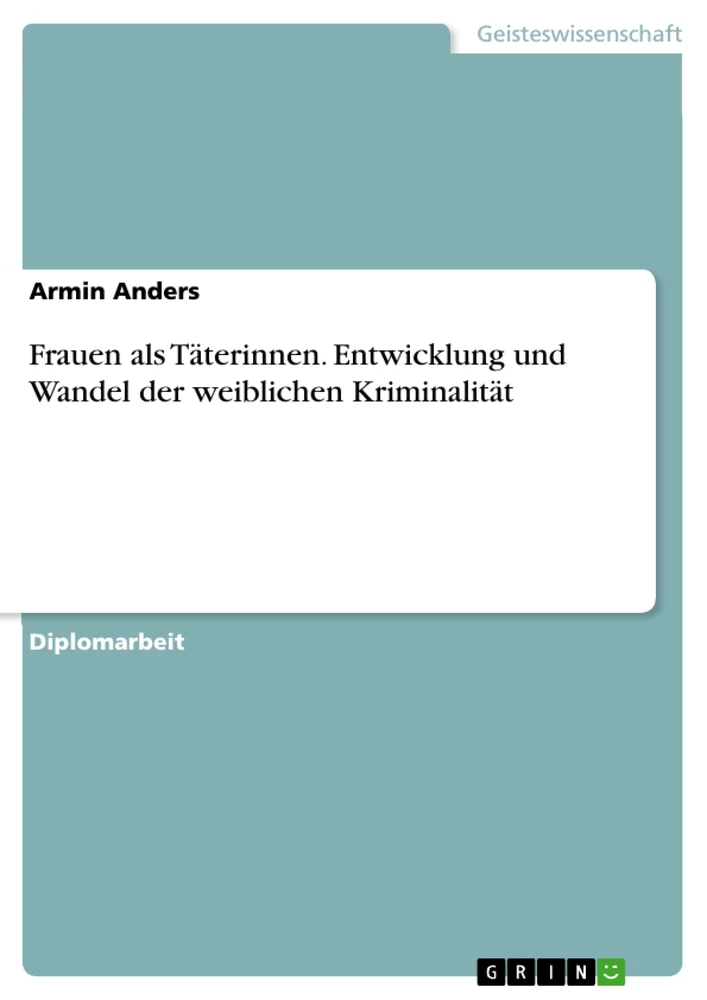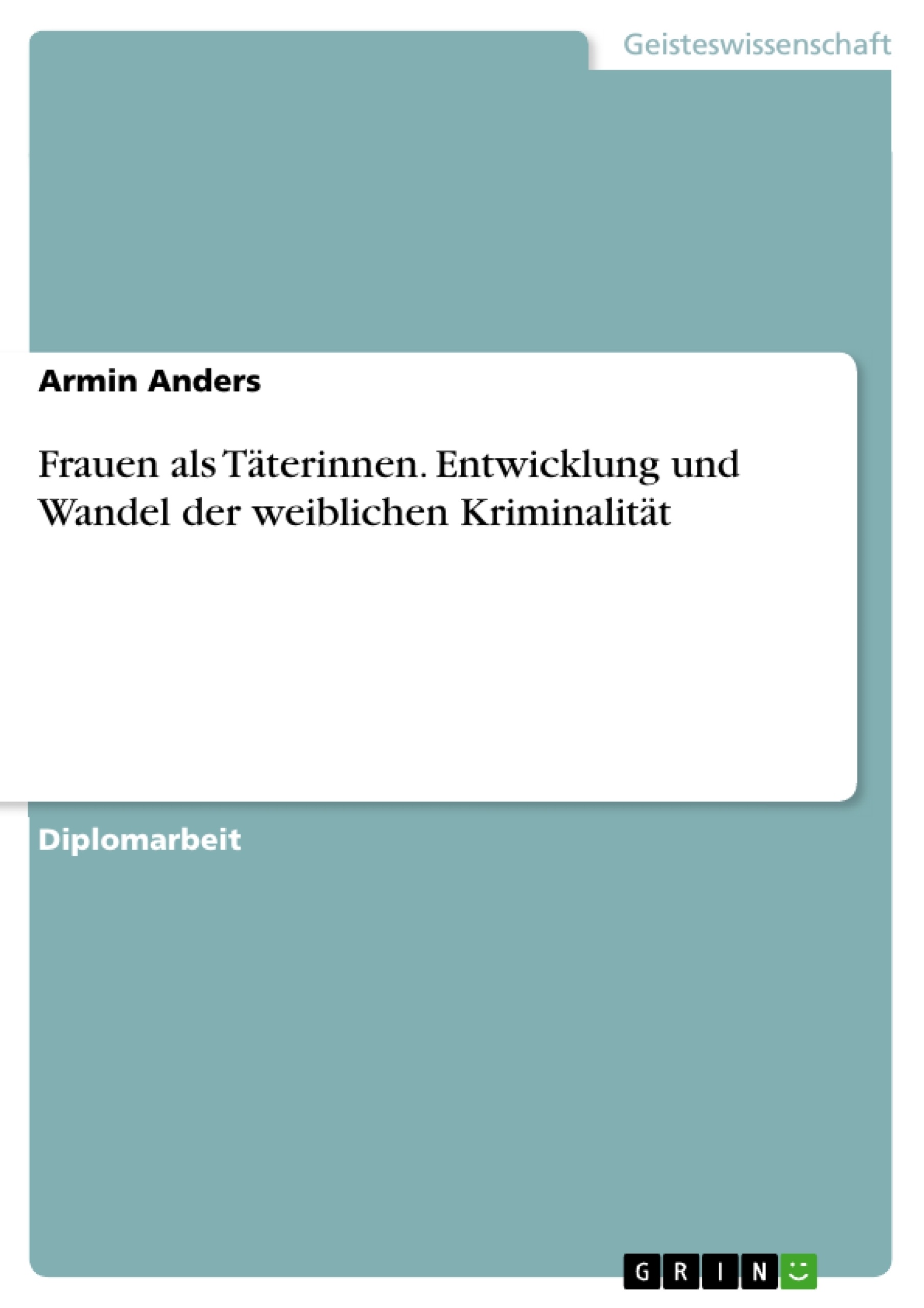"Ich bin überzeugt, dass die Frauen, wenn ihre jahrtausend alte Benachteiligung dem Mann gegenüber erst einmal überwunden ist, all die schlechten Eigenschaften, die man heute den Männern zuschreibt, genauso entwickeln."
(Loriot 1992 in DIE ZEIT vom 7.2.1992 in Kerschke-Risch, 1993)
Bekanntermaßen ist das Erscheinungsbild der kriminellen Frau in der Bundesrepublik Deutschland und dem Rest der Welt im Gegensatz zum männlichen Geschlecht nach offiziellen Zahlen noch immer als sehr gering anzusehen. Zwar ist im Laufe der Jahrzehnte ein Anstieg des weiblichen Anteils an der Gesamttatverdächtigenzahl zu verzeichnen, trotz allem machen diese in der BRD jedoch nicht mehr als 25 % aus. In anderen, nicht so weit entwickelten Nationen zeigt sich dagegen, dass die wahrgenommene weibliche Kriminalität teilweise sogar unter 5 % fällt. Es stellt sich die Frage, mit welchen Erklärungsmodellen und theoretischen Ansätzen sich diese Tendenzen, speziell in der Bundesrepublik Deutschland, erklären lassen und welche Ursachen dafür in Frage kommen. (vgl. Franke, 2000, S.17-23)
Oft scheint es, dass die männliche Kriminalität als Kriminalität schlechthin verstanden wird. So wird meist von dem „Täter“, „Verbrecher“, etc. gesprochen, selten von „Täterinnen“. Auch die Verurteilungs- und Tatverdächtigenzahlen sowie Medienberichte vermitteln eher den Eindruck, dass Kriminalität allein Männersache ist. (vgl. Neumann, 1980, S.132) In extrem feministischen Publikationen wird mitunter die Auffassung vertreten, dass Kriminalität überhaupt ein männliches Phänomen sei. Davon ausgehend, dass das Strafrecht von Männern für Männer gemacht worden ist, stellt sich nach Mergen die Frage wie die aktuelle Strafrechtskodifikation aussehen würde, wenn sie von Frauen geschaffen worden wäre und überdies die Strafrechtswissenschaft der letzten 200 Jahre samt allen Hilfswissenschaften in den Händen von Frauen gelegen hätte? Selbstverständlich ist diese Frage spekulativ und wie alle Fragen nach historischen Alternativen nicht beantwortbar. (vgl. Mergen, 1978, S.221ff. und Neumann, 1980, S.133)
Liegt es an der immer weiter fortschreitenden Emanzipation der Frau, an den innenpolitischen Veränderungen, denen unser Land ausgesetzt ist oder liegt die Ursache in einer verbesserten Aufklärungsarbeit durch die Justiz? Schon Anfang der siebziger Jahre schreibt Gipser „[...].
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abweichendes Verhalten, Kriminalität, Frauenkriminalität
- Abweichendes Verhalten
- Kriminalität
- Frauenkriminalität
- Fazit
- Die Entwicklung der Frauenkriminalität in der Statistik
- Zur Deutung von Statistiken
- Entwicklung der Tatverdächtigenzahlen
- Entwicklung der Verurteilungen
- Entwicklung der freiheitsentziehenden Maßnahmen
- Kritik an empirischen Befunden, Möglichkeiten und Grenzen von Statistiken
- Dunkelfeld
- Die teilnehmende Beobachtung
- Selbstreportbefragungen
- Opferbefragung
- Informantenbefragung
- Selektionsprozess
- Aufklärungsquote
- Fazit
- Ausgewählte Theorien zu abweichendem Verhalten in Bezug zur Frauenkriminalität
- Theorie der differentiellen Assoziation
- Bindungs- und Kontrolltheorie
- Labeling Approach
- Anomietheorie
- Mehr-Faktoren-Ansatz
- Fazit
- Frauenspezifische Deliktgruppen
- Diebstahl
- Betrug
- Kindstötung und Schwangerschaftsabbruch
- Straftaten gegen Kinder
- Fazit
- Erklärungsfaktoren für weibliche Delinquenz
- Schicht, Geschlecht, Alter
- Gewalterfahrungen
- Sucht und psychische Erkrankungen
- Unterschiede im Rollenverständnis
- Fazit
- Gesamtbetrachtung
- Konsequenzen für die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Entwicklung und den Wandel weiblicher Kriminalität. Ziel ist es, die Besonderheiten weiblicher Delinquenz im Vergleich zu männlicher Kriminalität zu beleuchten und soziologische Theorien auf ihre Erklärungskraft hin zu überprüfen. Die Arbeit analysiert statistische Daten und diskutiert verschiedene soziologische Erklärungsansätze.
- Entwicklung der Frauenkriminalität im Zeitverlauf
- Analyse relevanter soziologischer Theorien zur Erklärung weiblicher Kriminalität
- Untersuchung frauenspezifischer Delikte
- Einflussfaktoren wie soziale Schicht, Gewalterfahrungen und psychische Erkrankungen
- Implikationen für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der weiblichen Kriminalität ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie benennt die Forschungslücke und den Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit.
Abweichendes Verhalten, Kriminalität, Frauenkriminalität: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „abweichendes Verhalten“, „Kriminalität“ und „Frauenkriminalität“. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf diese Phänomene beleuchtet und die spezifischen Herausforderungen bei der Erforschung weiblicher Kriminalität herausgestellt. Es wird eine differenzierte Betrachtungsweise eingenommen, die die sozialen und kulturellen Kontexte berücksichtigt.
Die Entwicklung der Frauenkriminalität in der Statistik: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der weiblichen Kriminalität anhand statistischer Daten. Es werden sowohl die Gesamtzahlen der Tatverdächtigen als auch die Verurteilungszahlen und die Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen betrachtet. Kritische Punkte der Dateninterpretation, wie z.B. das Dunkelfeld der Kriminalität, werden ausführlich diskutiert. Methoden zur Schätzung der Dunkelziffer, wie teilnehmende Beobachtung, Selbstreportstudien und Opferbefragungen werden analysiert und deren Stärken und Schwächen beleuchtet. Die Komplexität der Dateninterpretation und die Herausforderungen der statistischen Erfassung weiblicher Kriminalität werden besonders hervorgehoben.
Ausgewählte Theorien zu abweichendem Verhalten in Bezug zur Frauenkriminalität: Dieses Kapitel stellt verschiedene soziologische Theorien vor, die versucht haben, abweichendes Verhalten und insbesondere weibliche Kriminalität zu erklären. Theorien wie die differentielle Assoziation, die Bindungs- und Kontrolltheorie, der Labeling Approach, die Anomietheorie und ein Mehr-Faktoren-Ansatz werden kritisch bewertet und auf ihre Anwendbarkeit auf den Kontext weiblicher Kriminalität untersucht. Die Stärken und Schwächen der jeweiligen Theorie im Hinblick auf die Erklärung weiblicher Delinquenz werden analysiert und deren jeweiliger Beitrag zur Gesamtbetrachtung eingeordnet.
Frauenspezifische Deliktgruppen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf bestimmte Delikte, die vermehrt von Frauen begangen werden, wie z.B. Diebstahl, Betrug, Kindstötung und Straftaten gegen Kinder. Es analysiert die spezifischen Merkmale dieser Delikte und versucht, mögliche Erklärungen für die höhere Beteiligung von Frauen bei diesen Tatbeständen zu liefern. Die soziale Einbettung der Taten und die gesellschaftlichen Bedingungen, die zu diesen Delikten führen könnten, werden untersucht.
Erklärungsfaktoren für weibliche Delinquenz: Dieser Abschnitt untersucht verschiedene Faktoren, die die weibliche Delinquenz beeinflussen könnten, darunter soziale Schicht, Geschlecht, Alter, Gewalterfahrungen, Sucht und psychische Erkrankungen sowie Unterschiede im Rollenverständnis. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren und deren Beitrag zum Verständnis weiblicher Kriminalität werden eingehend analysiert. Der Einfluss sozialer Ungleichheit und die Rolle von gesellschaftlichen Erwartungen und Geschlechterrollen werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Frauenkriminalität, weibliche Delinquenz, Kriminalitätstheorien, Soziologie, Statistik, Dunkelfeldforschung, Geschlechterrollen, Gewalterfahrungen, Sucht, psychische Erkrankungen, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Weibliche Kriminalität
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Entwicklung und den Wandel weiblicher Kriminalität. Sie beleuchtet die Besonderheiten weiblicher Delinquenz im Vergleich zu männlicher Kriminalität und überprüft soziologische Theorien auf ihre Erklärungskraft.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert statistische Daten zur Entwicklung der Frauenkriminalität, diskutiert verschiedene soziologische Erklärungsansätze, untersucht frauenspezifische Delikte und deren Einflussfaktoren (soziale Schicht, Gewalterfahrungen, psychische Erkrankungen etc.) und zieht schließlich Konsequenzen für die Soziale Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, abweichendem Verhalten/Kriminalität/Frauenkriminalität, der Entwicklung der Frauenkriminalität in der Statistik (inkl. Dunkelfeldforschung), ausgewählten Kriminalitätstheorien, frauenspezifischen Deliktgruppen, Erklärungsfaktoren weiblicher Delinquenz, einer Gesamtbetrachtung und Konsequenzen für die Soziale Arbeit.
Wie werden statistische Daten in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert statistische Daten zur Entwicklung der weiblichen Kriminalität, betrachtet Tatverdächtigenzahlen, Verurteilungen und freiheitsentziehende Maßnahmen. Sie diskutiert kritische Punkte der Dateninterpretation und das Problem des Dunkelfelds der Kriminalität ausführlich, inklusive verschiedener Methoden zur Schätzung der Dunkelziffer (teilnehmende Beobachtung, Selbstreportstudien, Opferbefragungen etc.).
Welche soziologischen Theorien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene soziologische Theorien zur Erklärung abweichenden Verhaltens und weiblicher Kriminalität, darunter die Theorie der differentiellen Assoziation, die Bindungs- und Kontrolltheorie, den Labeling Approach, die Anomietheorie und einen Mehr-Faktoren-Ansatz. Die Theorien werden kritisch bewertet und auf ihre Anwendbarkeit auf den Kontext weiblicher Kriminalität untersucht.
Welche frauenspezifischen Delikte werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Delikte, die vermehrt von Frauen begangen werden, wie Diebstahl, Betrug, Kindstötung und Straftaten gegen Kinder. Sie analysiert die spezifischen Merkmale dieser Delikte und sucht nach möglichen Erklärungen für die höhere Beteiligung von Frauen.
Welche Faktoren werden als Erklärung für weibliche Delinquenz diskutiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Einflussfaktoren auf weibliche Delinquenz, darunter soziale Schicht, Alter, Gewalterfahrungen, Sucht, psychische Erkrankungen und Unterschiede im Rollenverständnis. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren und deren Beitrag zum Verständnis weiblicher Kriminalität werden analysiert.
Welche Schlussfolgerungen werden für die Soziale Arbeit gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit basierend auf den Ergebnissen der Analyse der weiblichen Kriminalität und den diskutierten Einflussfaktoren. Diese Konsequenzen werden im letzten Kapitel detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenkriminalität, weibliche Delinquenz, Kriminalitätstheorien, Soziologie, Statistik, Dunkelfeldforschung, Geschlechterrollen, Gewalterfahrungen, Sucht, psychische Erkrankungen, Soziale Arbeit.
- Quote paper
- Armin Anders (Author), 2005, Frauen als Täterinnen. Entwicklung und Wandel der weiblichen Kriminalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51674