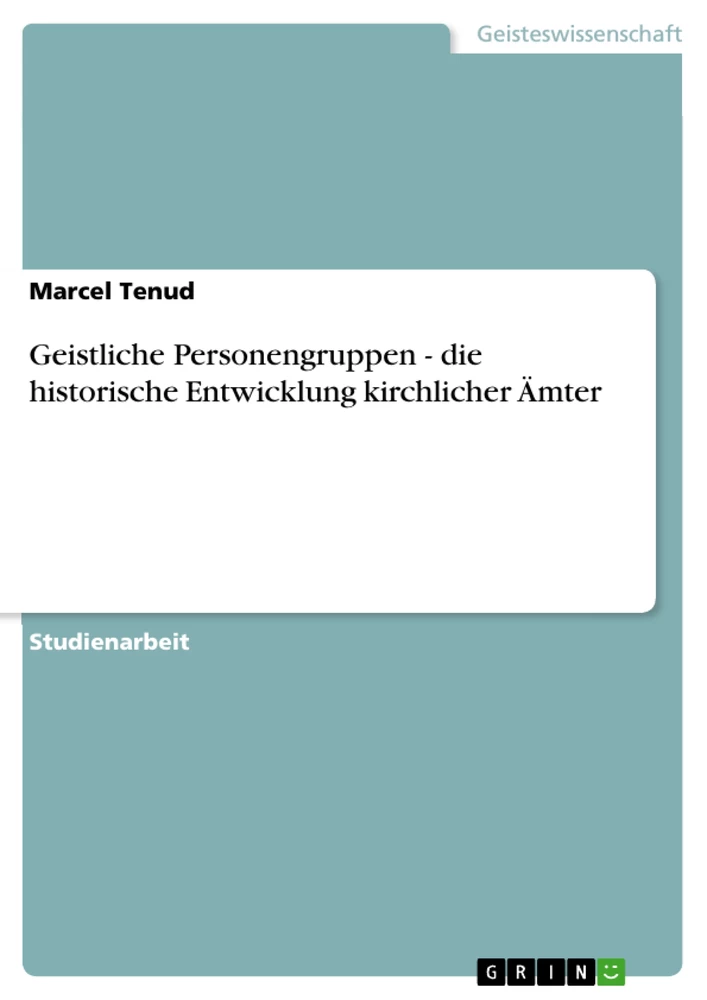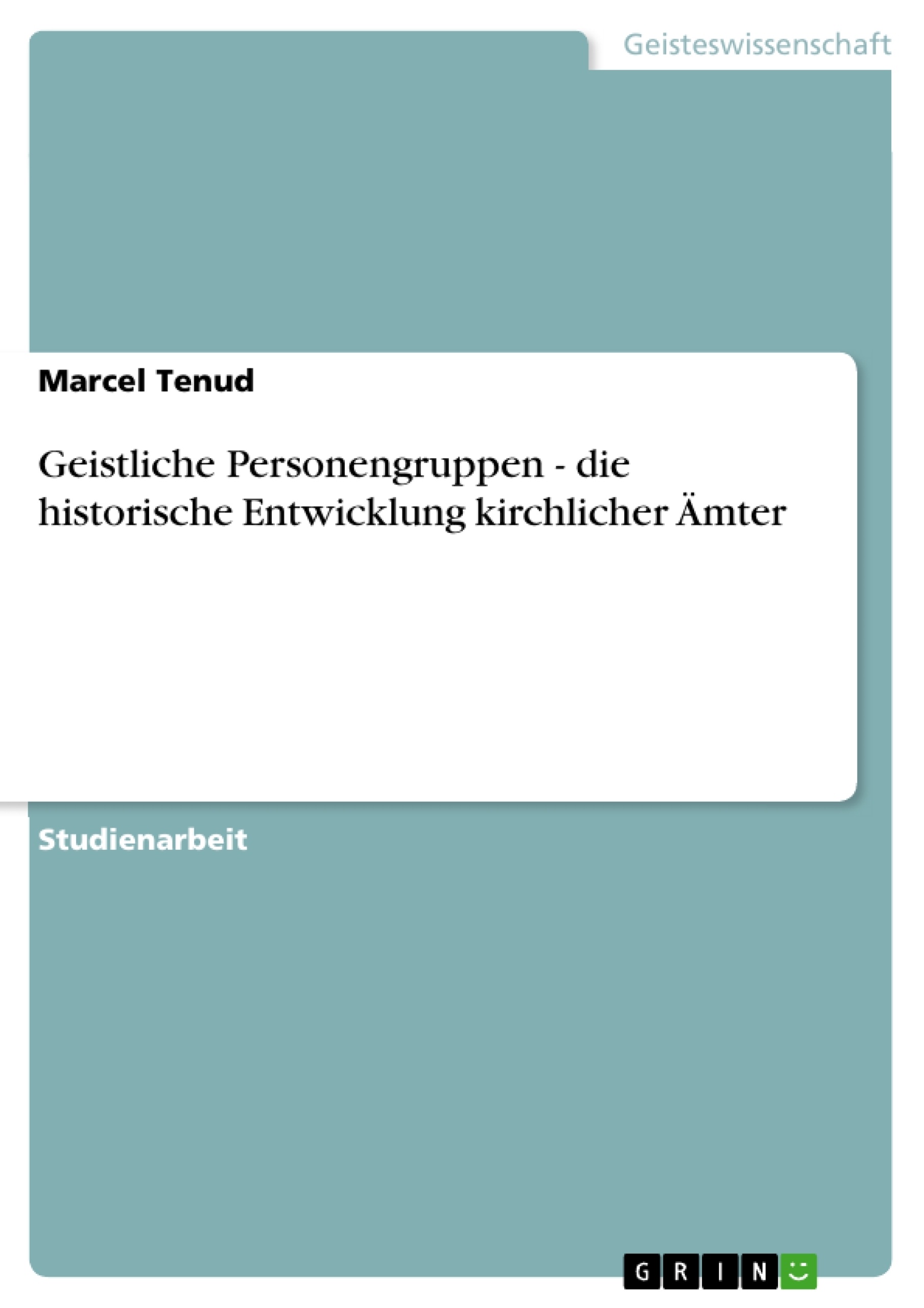Der Begriff Klerus war seit dem dritten Jahrhundert nach Christus die gebräuchliche Bezeichnung für Personen, die durch Wahl und Weihe ein kirchliches Amt und geistliche Vollmachten verliehen bekamen. Dies schuf schon früh eine Abgrenzung zu der Personengruppe der Laien. Im Hochmittelalter wurde der Begriff auf alle Personen ausgedehnt, die unter Kirchenrecht lebten. Der Empfang kirchlicher Weihen war für die Zugehörigkeit zum Klerus nicht mehr zwingend nötig.
Die Zahl der kirchlichen Weihen wurde um die Mitte des dritten Jahrhunderts auf sieben festgelegt, die seit 1203 in die ordines minores des Ostiarius (Türhüter), des Lector (Schriftleser), des Exorcista (Teufelsaustreiber) und des Sequenz (Messgehilfe), sowie die ordines maiores des Subdiakon, des Diakon und des Priester geteilt werden.
Seit dem 13. Jahrhundert wurde der Klerus in feste Kirchenstrukturen eingebunden. Den kirchenrechtlichen Eintritt in den Klerikerstand erhielt man durch folgenden Ablauf: Benennung oder Wahl, deren Bestätigung, der Weihe und anschließenden Einführung ins Amt.
Weihehindernisse, sogenannte Irregularitäten, waren vor allem die uneheliche Geburt, körperliche Gebrechen, Ehrlosigkeit, Mangel an mildem Herzen (frühere Richtertätigkeit), Amtsanmaßung und das Mindestalter.
Die Standespflichten der Majoristen bestanden im Gottesdienst, Stundengebet, Zölibat, würdigem Lebenswandel, Tragen der Standestracht und Gehorsam gegenüber den höheren Weihegraden.
Seit dem sechsten Jahrhundert bildete die Tonsur und das Bartverbot die äußerlichen Zeichen der Kleriker.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung zum Klerus
- II Mönchtum
- II a Ursprung und Entwicklung: Anachoretentum und Koinobitentum
- II b Mönchtum im Mittelalter:
- II c Monastische Neugründungen des 11. u. 12. Jhd.:
- II d Die Bettelorden des Spätmittelalters:
- III Diakon
- III a Byzantinischer Osten:
- III b Lateinischer Westen:
- IV Priester
- V Bischof
- Va Theolog. und kirchenrechtl. Stellung:
- VI Stift u. Kapitel
- VII Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der historischen Entwicklung des Klerus, den verschiedenen Ordnungen und deren spezifischen Lebensweisen innerhalb der christlichen Kirche. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Mönchtums, die verschiedenen Weihegrade und die spezifischen Rollen und Pflichten innerhalb der kirchlichen Hierarchie.
- Entstehung und Entwicklung des Klerus
- Mönchtum: Anachoretentum, Koinobitentum und die Entwicklung im Mittelalter
- Die verschiedenen Weihegrade und ihre spezifischen Aufgaben
- Die Bedeutung von Klöstern und Kapiteln in der kirchlichen Struktur
- Kirchliche Regeln und Vorschriften des Klerikerstandes
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung zum Klerus
Dieses Kapitel führt den Begriff Klerus ein und beschreibt seine Entwicklung vom dritten Jahrhundert nach Christus bis ins Hochmittelalter. Es erklärt die Abgrenzung zum Laienstand und die festgelegte Anzahl der kirchlichen Weihen, die in die ordines minores und ordines maiores geteilt wurden. Außerdem werden die Voraussetzungen und Pflichten für den Eintritt in den Klerikerstand erläutert.
II Mönchtum
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Mönchtum als Lebensweise, die eine vollständige Hingabe an Gott und die Christusnachfolge in Abgeschiedenheit von der Welt beinhaltet. Es werden die Ursprünge des Mönchtums im dritten Jahrhundert, das Anachoretentum und das Koinobitentum, sowie die wichtigsten Vertreter und deren Regeln beleuchtet. Außerdem werden die Auswirkungen des Mönchtums auf die Kirche, die Entstehung mönchischer Großsiedlungen und die Weiterentwicklung des Mönchtums im Mittelalter behandelt.
II a Ursprung und Entwicklung: Anachoretentum und Koinobitentum
Dieses Kapitel stellt die beiden Grundformen des Mönchtums, das Anachoretentum und das Koinobitentum, vor. Es beschreibt die Lebensweise der Asketen, die in die Wüste gingen, sowie die Entstehung des ersten Klosters in Tabennisi, Ägypten. Die Regeln der Mönchsväter Antonios der Große und Pachomios der Jüngere werden vorgestellt, die zur Grundlage für die Entwicklung des Mönchtums in Palästina, Syrien und Kleinasien wurden.
II b Mönchtum im Mittelalter:
Dieses Kapitel befasst sich mit der Verbreitung der Benediktregel im Mittelalter. Es beschreibt die Rolle der karolingischen Herrscher bei der Durchsetzung der Regel und den Niedergang des Mönchtums im westfränkischen Reich. Außerdem werden die Entstehung des Cluny-Reformmönchtums und die Bedeutung des Klosters Cluny als Zentrum der Reformbewegung im zehnten und elften Jahrhundert behandelt.
III Diakon
Dieses Kapitel behandelt den Diakon, seinen Status und seine Aufgaben im byzantinischen Osten und im lateinischen Westen.
III a Byzantinischer Osten:
Dieses Kapitel beleuchtet den Status des Diakons im byzantinischen Osten.
III b Lateinischer Westen:
Dieses Kapitel beleuchtet den Status des Diakons im lateinischen Westen.
IV Priester
Dieses Kapitel behandelt den Priester und seine Aufgaben innerhalb der Kirche.
V Bischof
Dieses Kapitel befasst sich mit der theologischen und kirchenrechtlichen Stellung des Bischofs.
Va Theolog. und kirchenrechtl. Stellung:
Dieses Kapitel beleuchtet die theologische und kirchenrechtliche Stellung des Bischofs.
VI Stift u. Kapitel
Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung von Stiften und Kapiteln in der kirchlichen Struktur.
Schlüsselwörter
Klerus, Mönchtum, Anachoretentum, Koinobitentum, Benediktregel, Cluny-Reform, Weihegrade, Diakon, Priester, Bischof, Stift, Kapitel, Kirchenrecht, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Klerus historisch?
Seit dem 3. Jahrhundert bezeichnete Klerus Personen, die durch Wahl und Weihe ein kirchliches Amt erhielten, was sie klar von den Laien abgrenzte.
Welche Weihegrade werden unterschieden?
Es wird zwischen den ordines minores (z.B. Lector, Ostiarius) und den ordines maiores (Subdiakon, Diakon, Priester) unterschieden.
Was sind Weihehindernisse oder Irregularitäten?
Dazu gehörten im Mittelalter Faktoren wie uneheliche Geburt, körperliche Gebrechen, mangelndes Mindestalter oder Ehrlosigkeit.
Welche Rolle spielte die Cluny-Reform?
Das Kloster Cluny war im 10. und 11. Jahrhundert das Zentrum einer bedeutenden Reformbewegung des Mönchtums im Mittelalter.
Was waren die äußeren Zeichen eines Klerikers?
Seit dem 6. Jahrhundert galten vor allem die Tonsur (spezielle Haarur) und das Bartverbot als Erkennungsmerkmale.
- Citar trabajo
- Marcel Tenud (Autor), 2001, Geistliche Personengruppen - die historische Entwicklung kirchlicher Ämter , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5147