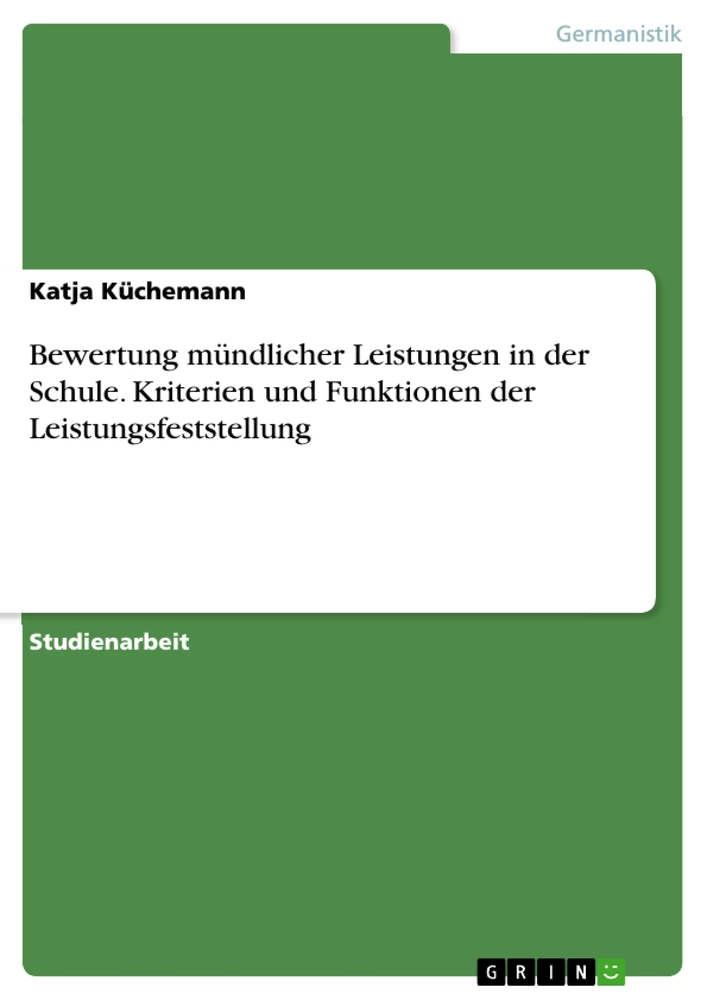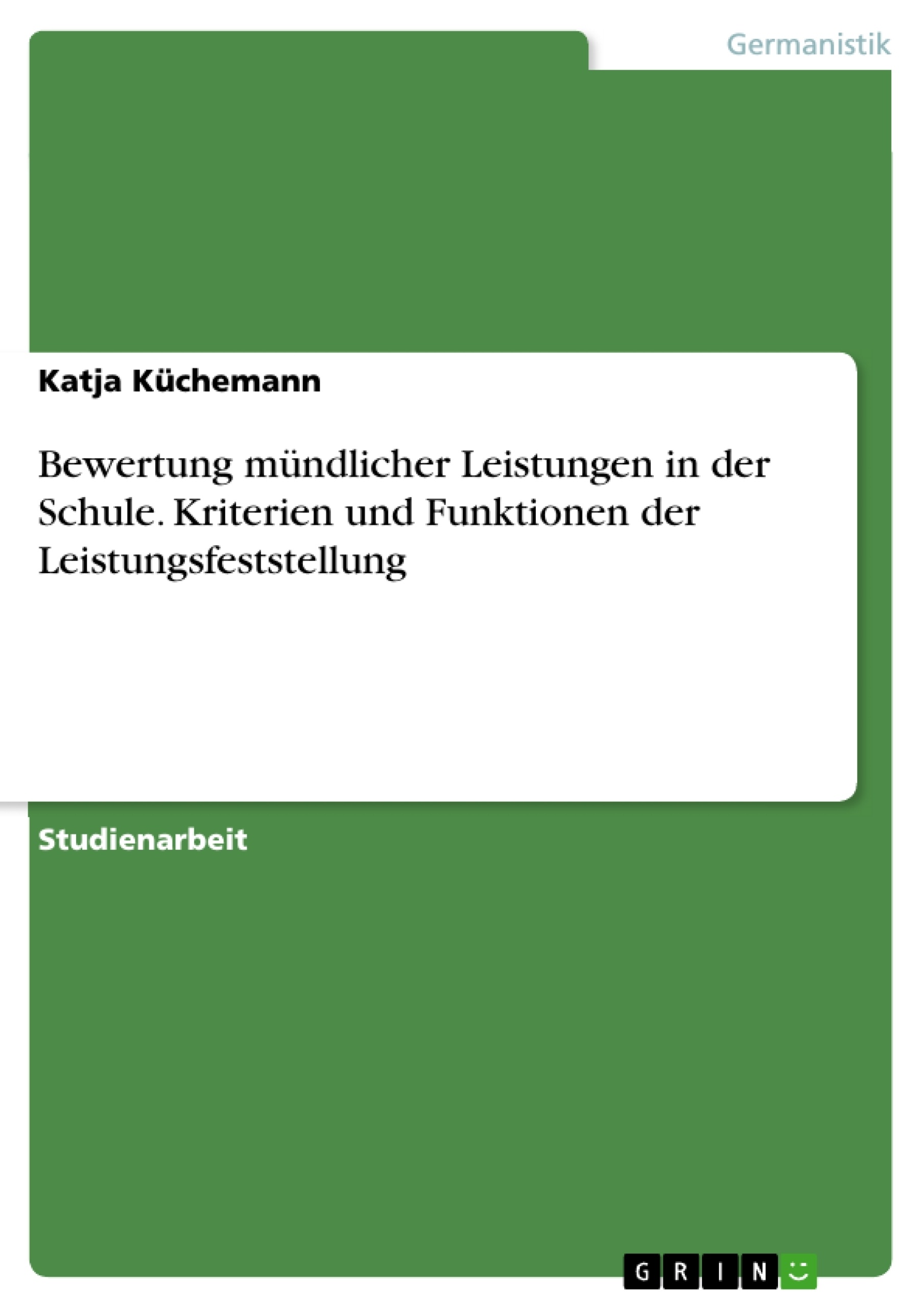An Ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.
Matthäus 7,16
Mündliche Leistungen zu bewerten gestaltet sich häufig schwieriger als angenom-men. Es besteht zunehmend die Gefahr, dass Kinder aufgrund ihres sozialen Back-grounds sowie ihrer mitgebrachten Fähigkeiten beurteilt werden, ohne dass Lernfort-schritte während des Unterrichts Beachtung finden. Weiterhin werden oftmals eher gute Noten für gute Beteiligungen und für gutes Sprechen verteilt, als für gutes Zuhö-ren und regelgerechtes Verhalten, die auch wichtige Bestandteile der Bewertung darstellen, jedoch oftmals vergessen werden.
Grundlage für die Erbringung mündlicher Leistungen stellt die Gesprächsfähigkeit dar, die nicht angeboren ist, sondern erlernt werden muss. „Gesprächsfähig sind Kinder, wenn sie sachangemessen und partnerbezogen miteinander sprechen. Sie finden sich in verschiedenen gegebenen Gesprächssituationen zurecht und können Sprecher- und Hörerrollen einnehmen, einen Gegenstand oder Sachverhalt richtig erfassen und verständlich wiedergeben, als Person authentisch sein und sich in der Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen an vereinbarte Regeln halten. In schwierigen Situationen ergreifen sie die Möglichkeit zur Metakommunikation und thematisieren problematische Punkte.“
Diese Hausarbeit ist im Zuge des Seminars „Leistung und Benotung im Deutschun-terricht“ entstanden, das sich mit den Erscheinungsformen von Leistung sowie den Bewertungsnormen und –modalitäten beschäftigt hat. In dieser Hausarbeit soll das Thema „Bewertung mündlicher Schulleistungen“ genauer untersucht und auf die ver-schiedenen Bewertungsaspekte näher eingegangen werden.
Es folgt zunächst eine genauere Eingrenzung und Definition der Begriffe „Leistungs-feststellung“ und „Leistungsbeurteilung“ mit Herausstellung der pädagogischen und gesellschaftlichen Ambivalenz von Schulleistungen. Im Anschluss folgen die Kriterien und die Funktionen der Leistungsfeststellung sowie die möglichen Fehlerquellen, die sich bei der Bewertung von Leistung ergeben können. Das eigentliche Hauptthema der Hausarbeit „Die Bewertung mündlicher Schulleistungen“ schließt sich dem ersten Teil an. Auch die Bewertung mündlicher Leistungen innerhalb des Deutschunterrichts spielt in dieser Hausarbeit eine wichtige Rolle. Zum Schluss werden auszugsweise einige Möglichkeiten der Leistungsdokumentation vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung
- 2.1. Schulleistungen in pädagogischer und gesellschaftlicher Ambivalenz
- 2.2. Mündliche Leistungen vs. sonstige Formen von Schulleistungen
- 2.3. Kriterien zur Leistungserfassung
- 3. Bewertung mündlicher Schulleistungen
- 3.1. Funktion der Bewertung mündlicher Leistungen
- 3.2. Fehlerquellen und Verzerrungen bei der Bewertung
- 3.2.1. Unterschiedliche Maßstäbe der Beurteilung
- 4. Mündliche Leistungsbewertung während des Unterrichts
- 4.1. Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung
- 5. Bewertung mündlicher Leistungen im Fach Deutsch
- 6. Dokumentation mündlicher Leistungen
- 6.1. Portfolio
- 6.2. Leistungspräsentation
- 6.3. Lerntagebücher
- 6.4. Zertifikate
- 6.5. Selbstbewertung, wechselseitige Bewertung, beauftragte Bewertung
- 6.6. Bewertung
- 7. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bewertung mündlicher Schulleistungen im Detail. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der Leistungsfeststellung und -beurteilung zu beleuchten, potenzielle Fehlerquellen aufzuzeigen und Möglichkeiten zur Dokumentation mündlicher Leistungen vorzustellen. Der Fokus liegt auf der Berücksichtigung pädagogischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge.
- Definition und Abgrenzung von Leistungsfeststellung und -beurteilung
- Kriterien und Funktionen der Bewertung mündlicher Leistungen
- Fehlerquellen und Verzerrungen bei der Bewertung mündlicher Leistungen
- Möglichkeiten zur Dokumentation mündlicher Leistungen
- Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bewertung mündlicher Leistungen ein und hebt die Herausforderungen hervor, die sich aus sozialen Hintergründen und unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler ergeben. Sie betont die Bedeutung von Gesprächsfähigkeit als Grundlage für mündliche Leistungen und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Leistungsfeststellung“ und „Leistungsbeurteilung“ und unterscheidet sie klar voneinander. Es werden die pädagogischen und gesellschaftlichen Aspekte von Schulleistungen beleuchtet und die Bedeutung von Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität hervorgehoben. Die Komplexität der Leistungsbewertung durch Noten wird aufgrund allgemeiner Lehrpläne und der Selbstreflexion des Lehrers thematisiert.
3. Bewertung mündlicher Schulleistungen: Das Kapitel behandelt die Funktion der Bewertung mündlicher Leistungen und analysiert detailliert mögliche Fehlerquellen und Verzerrungen. Hierbei steht insbesondere die Problematik unterschiedlicher Beurteilungsmaßstäbe im Vordergrund.
4. Mündliche Leistungsbewertung während des Unterrichts: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Konsequenzen der mündlichen Leistungsbewertung für die Unterrichtsgestaltung. Es wird die Wechselwirkung zwischen Bewertungspraxis und didaktischem Vorgehen analysiert.
5. Bewertung mündlicher Leistungen im Fach Deutsch: Hier wird die spezifische Herausforderung der Bewertung mündlicher Leistungen im Deutschunterricht betrachtet. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten des Faches und den daraus resultierenden Anforderungen an die Bewertungsmethodik.
6. Dokumentation mündlicher Leistungen: Das Kapitel beschreibt verschiedene Möglichkeiten der Dokumentation mündlicher Leistungen, wie Portfolios, Leistungspräsentationen, Lerntagebücher, Zertifikate und Selbst-/wechselseitige/beauftragte Bewertungen. Es wird dargelegt, wie diese Methoden zur Verbesserung der Transparenz und der Fairness der Bewertung beitragen können.
Schlüsselwörter
Mündliche Leistungen, Leistungsfeststellung, Leistungsbeurteilung, Bewertung, Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität), Fehlerquellen, Dokumentation, Deutschunterricht, Gesprächsfähigkeit, Unterrichtsgestaltung, pädagogische und gesellschaftliche Ambivalenz.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Bewertung mündlicher Schulleistungen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit der Bewertung mündlicher Schulleistungen. Sie untersucht die verschiedenen Aspekte der Leistungsfeststellung und -beurteilung, analysiert potenzielle Fehlerquellen und stellt Möglichkeiten zur Dokumentation vor. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den pädagogischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Abgrenzung von Leistungsfeststellung und -beurteilung, Kriterien und Funktionen der Bewertung mündlicher Leistungen, Fehlerquellen und Verzerrungen bei der Bewertung, Möglichkeiten zur Dokumentation mündlicher Leistungen, Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung und die spezifischen Herausforderungen im Deutschunterricht.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Leistungsfeststellung und -beurteilung (inklusive Unterkapiteln zu Schulleistungen, mündlichen vs. schriftlichen Leistungen und Kriterien zur Leistungserfassung), Bewertung mündlicher Schulleistungen (mit Fokus auf Fehlerquellen und Verzerrungen), mündliche Leistungsbewertung im Unterricht und deren Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung, Bewertung mündlicher Leistungen im Fach Deutsch, Dokumentation mündlicher Leistungen (mit verschiedenen Methoden wie Portfolios, Lerntagebüchern und Selbstbewertungen) und schließlich ein Resümee.
Welche Methoden der Dokumentation mündlicher Leistungen werden vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert diverse Methoden zur Dokumentation, darunter Portfolios, Leistungspräsentationen, Lerntagebücher, Zertifikate und verschiedene Formen der Selbst-, wechselseitigen und beauftragten Bewertung. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Transparenz und Fairness der Bewertung.
Welche Fehlerquellen bei der Bewertung mündlicher Leistungen werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert detailliert mögliche Fehlerquellen und Verzerrungen bei der Bewertung, insbesondere die Problematik unterschiedlicher Beurteilungsmaßstäbe und die damit verbundenen subjektiven Einflüsse. Die Komplexität der Leistungsbewertung durch Noten wird ebenfalls thematisiert.
Welche Bedeutung haben die pädagogischen und gesellschaftlichen Aspekte?
Die Hausarbeit betont die Bedeutung der Berücksichtigung pädagogischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge bei der Bewertung mündlicher Leistungen. Die Herausforderungen, die sich aus sozialen Hintergründen und unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler ergeben, werden explizit angesprochen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Mündliche Leistungen, Leistungsfeststellung, Leistungsbeurteilung, Bewertung, Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität), Fehlerquellen, Dokumentation, Deutschunterricht, Gesprächsfähigkeit, Unterrichtsgestaltung und pädagogische und gesellschaftliche Ambivalenz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Aspekte der Bewertung mündlicher Schulleistungen detailliert zu untersuchen, potenzielle Fehlerquellen aufzuzeigen und Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistungsbeurteilung und -dokumentation vorzustellen. Der Fokus liegt auf der Schaffung einer transparenteren und faireren Bewertungspraxis.
- Arbeit zitieren
- Katja Küchemann (Autor:in), 2006, Bewertung mündlicher Leistungen in der Schule. Kriterien und Funktionen der Leistungsfeststellung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51459