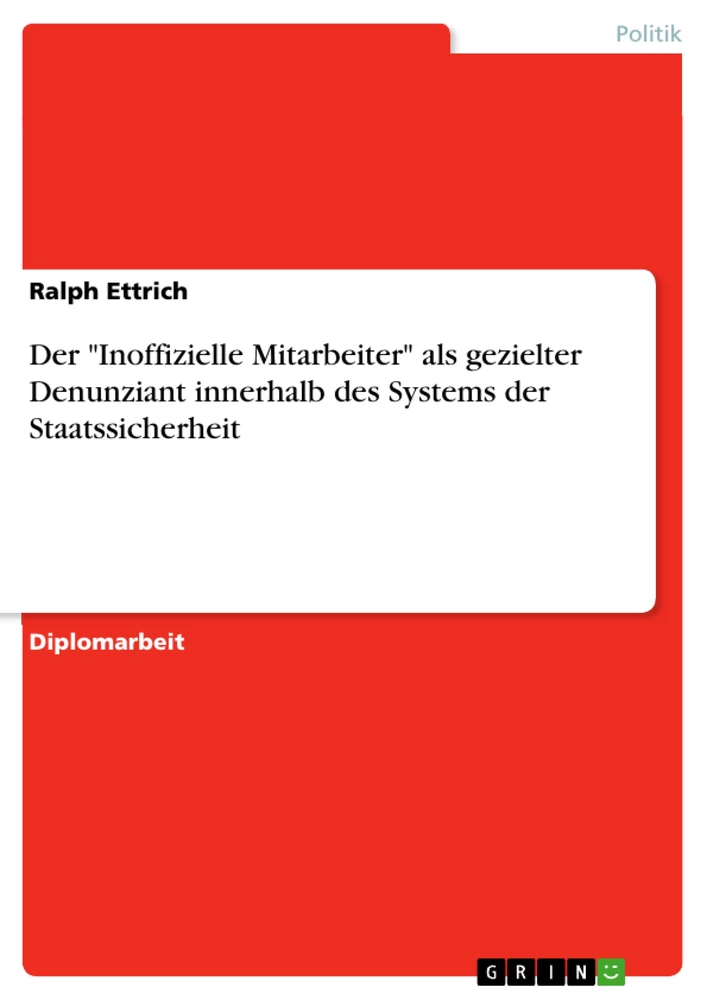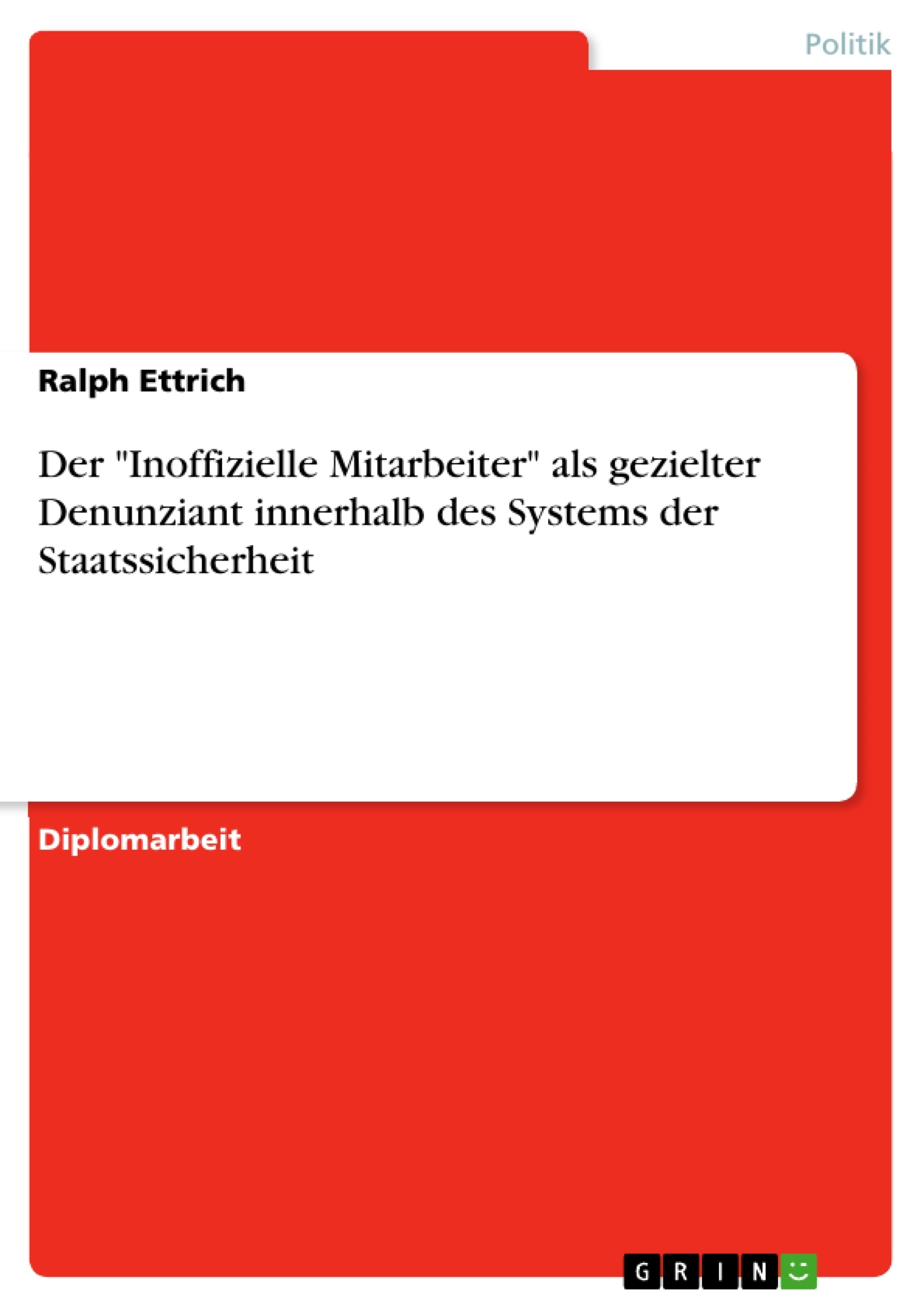Einleitung
„Seit geraumer Zeit stellt die Gauck-Behörde, die auf Initiative der letzten Volkskammer entstand und aufgrund des Gesetzes über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik vom 30. Oktober 1991 geschaffen wurde, ein Vorbild für den Umgang mit der IM-Problematik dar, [...].“1
Wie Karol Sauerland haben viele weitere Autoren – und nicht zuletzt diese Diplomarbeit – damit eine Möglichkeit, über das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit zu forschen und zu publizieren. Die Einsicht in die Akten des MfS stellte lange Zeit ein Novum unter den Sicherheitsdiensten des ehemaligen Ostblocks dar. 1999 wurde auch in Polen eine ähnliche Behörde und gesetzliche Grundlagen geschaffen.2 Weitere Öffnungen von Archiven der osteuropäischen Sicherheitsapparate sind mir nicht bekannt.
In den vergangenen Monaten jedoch ist die bis dahin übliche Praxis der Akteneinsicht – besonders die wissenschaftlich motivierte – in die Diskussion geraten.
Auslöser dafür war die Klage des Alt-Bundeskanzlers Helmut Kohl gegen die Herausgabe seiner MfS-Akten. Das als „Berliner Richterspruch“ (04.07.2001) bekannte Urteil bestärkte Helmut Kohl in seinem Rechtsverständnis und gab der Klage statt.3
„Eine Katastrophe für die Forschung und damit für die Aufarbeitung könnte der Richterspruch auch in sofern sein, als damit der 2003 drohenden Aktenvernichtung von Stasi-Unterlagen neue Argumente geliefert werden.“4
----
1 Sauerland, 2000, S. 145.
2 Nach dem Wahlerfolg der Solidarność-Parteien 1997 in Polen wurde ein Gesetz erlassen, welches ähnlich dem Stasiunterlagengesetz Opfern, Untersuchungsorganen und Wissenschaftlern durch eine neu geschaffenes Institut für Nationales Gedächtnis die Akten des polnischen Staatssicherheitsdienstes zugänglich macht. Es trat am 09.04.1999 in Kraft. Im Gegensatz zur Gauck-Behörde hat diese Institut Rechte einer Staatsanwaltschaft. Vgl. Sauerland, 2000, S.156ff.
3 Vgl. Weber/Steinbach/Müller, 2001, S. 740f.
4 Ebenda, S. 742.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Begriffe Verrat und Denunziation
- 2.1 Was ist Verrat?
- 2.2 Was ist Denunziation?
- 2.3 Verrat nach Margret Boveri
- 3 Der „Inoffizielle Mitarbeiter“
- 3.1 Ein kurzer geschichtlicher Abriss
- 3.1.1 Der „V-Mann“ in der SBZ
- 3.1.2 V-Leute bei der K5
- 3.1.3 Der IM nach der Gründung des MfS (Feb. 1950)
- 3.2 IM-Kategorien
- 3.2.1 IM zur Sicherung bestimmter Bereiche
- 3.2.2 IM zur Feinbekämpfung
- 3.2.3 IM für logistische Aufgaben
- 3.2.4 Kontaktpersonen und hauptamtliche IM
- 3.1 Ein kurzer geschichtlicher Abriss
- 4 Die Richtlinien des MfS zur Arbeit mit dem IM – Anleitung zur Denunziation?
- 4.1 Die Gewinnung der IM durch das MfS
- 4.1.1 Auswahl
- 4.1.2 Prüfung
- 4.1.3 Kontaktaufnahme
- 4.1.4 Rekrutierung und Verpflichtung
- 4.2 Warum wird einer IM?
- 4.3 Die Regelung der „täglichen Arbeit“ mit den IM
- 4.3.1 Erfassungsrichtlinie 1950
- 4.3.2 Richtlinie 21 (1952)
- 4.3.3 Richtlinie 1/58
- 4.3.4 Richtlinie 1/68
- 4.3.5 Richtlinie 1/79
- 4.4 EXKURS Spontane Denunziation durch die Bevölkerung
- 4.1 Die Gewinnung der IM durch das MfS
- 5 EXKURS „Jugendliche IM“
- 5.1 IMS „Klaus Müller“
- 5.2 IMB „Mark Aurelius“
- 6 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Rolle des „Inoffiziellen Mitarbeiters“ (IM) als gezielten Denunzianten innerhalb des Systems der Staatssicherheit. Ziel ist es, die Mechanismen der IM-Rekrutierung, -Führung und -Kontrolle zu analysieren und deren Beitrag zur Aufrechterhaltung des DDR-Regimes zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Richtlinien und Anweisungen des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS).
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Verrat und Denunziation
- Geschichtliche Entwicklung des IM-Wesens in der DDR
- Kategorisierung und Aufgaben der IM
- Analyse der MfS-Richtlinien zur Arbeit mit IM
- Beispiele konkreter IM-Fälle
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Bedeutung der Untersuchung der Rolle des Inoffiziellen Mitarbeiters (IM) innerhalb des Systems der Staatssicherheit der DDR. Sie skizziert die Forschungsfrage und die methodischen Ansätze der Arbeit.
2 Die Begriffe Verrat und Denunziation: Dieses Kapitel analysiert die Begriffe Verrat und Denunziation, untersucht deren semantische und kontextuelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Es beleuchtet verschiedene Definitionen und Perspektiven auf diese Phänomene, inklusive der Betrachtung von Margret Boveris Werk zum Thema Verrat. Dies bildet die theoretische Grundlage für die spätere Analyse der IM-Tätigkeit.
3 Der „Inoffizielle Mitarbeiter“: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den „Inoffiziellen Mitarbeiter“ (IM) im Kontext der Staatssicherheit. Es behandelt die historische Entwicklung des IM-Systems von den Anfängen in der SBZ bis zur Auflösung des MfS, klassifiziert die verschiedenen IM-Kategorien nach ihren Aufgaben und Funktionen, und beleuchtet die unterschiedlichen Motive für die Zusammenarbeit mit dem MfS. Die Kapitelteil-Gliederung zeigt den geschichtlichen Verlauf und die verschiedenen Kategorien der IMs.
4 Die Richtlinien des MfS zur Arbeit mit dem IM – Anleitung zur Denunziation?: Dieses Kapitel analysiert die Richtlinien und Anweisungen des MfS zur Arbeit mit den IM. Es untersucht, wie diese Richtlinien die IMs systematisch zur Denunziation anleiteten, und beleuchtet die verschiedenen Strategien und Techniken, die das MfS zur Gewinnung, Führung und Kontrolle der IM einsetzte. Die Analyse verschiedener Richtlinien über die Jahrzehnte zeigt eine systematische Entwicklung und Anpassung der Methoden.
5 EXKURS „Jugendliche IM“: Dieser Exkurs befasst sich mit dem Einsatz jugendlicher IM durch das MfS. Anhand konkreter Fallbeispiele (IMS „Klaus Müller“ und IMB „Mark Aurelius“) werden die Besonderheiten der Rekrutierung und Arbeit mit Jugendlichen als IM beleuchtet. Das Kapitel zeigt die besondere Vulnerabilität von Jugendlichen und die ethischen Probleme dieses Vorgehens.
Schlüsselwörter
Inoffizieller Mitarbeiter (IM), Staatssicherheit (Stasi), Ministerium für Staatssicherheit (MfS), Denunziation, Verrat, DDR, Rekrutierung, Überwachung, Repression, Richtlinien, Kategorien, Geschichte, Fallstudien.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Die Rolle des Inoffiziellen Mitarbeiters (IM) in der DDR
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Rolle des „Inoffiziellen Mitarbeiters“ (IM) als gezielten Denunzianten innerhalb des Systems der Staatssicherheit der DDR. Sie analysiert die Mechanismen der IM-Rekrutierung, -Führung und -Kontrolle und beleuchtet deren Beitrag zur Aufrechterhaltung des DDR-Regimes.
Welche Aspekte werden im Detail behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Richtlinien und Anweisungen des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), definiert und grenzt die Begriffe Verrat und Denunziation ab, geht auf die geschichtliche Entwicklung des IM-Wesens in der DDR ein, kategorisiert die Aufgaben der IM und präsentiert Fallbeispiele, insbesondere von jugendlichen IM.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Verrat und Denunziation, ein Kapitel zum „Inoffiziellen Mitarbeiter“, ein Kapitel zur Analyse der MfS-Richtlinien zur Arbeit mit IM, einen Exkurs zu jugendlichen IM und abschließend ein Resümee. Jedes Kapitel ist weiter untergliedert und enthält detaillierte Unterpunkte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert primär auf der Analyse der Richtlinien und Anweisungen des MfS zur Arbeit mit Inoffiziellen Mitarbeitern. Zusätzlich werden Fallbeispiele und möglicherweise weitere Quellen verwendet, um die theoretischen Ausführungen zu untermauern. Die genaue Quellenangabe ist im vollständigen Text der Arbeit zu finden.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Zentrale Forschungsfragen sind die Funktionsweise des IM-Systems, die Methoden der Rekrutierung und Führung, die Motive der IM und die Effektivität dieser Methoden zur Aufrechterhaltung des DDR-Regimes. Weiterhin wird die ethische Dimension, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz jugendlicher IM, untersucht.
Welche Definitionen von Verrat und Denunziation werden verwendet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen von Verrat und Denunziation, untersucht deren semantische und kontextuelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten und bezieht auch die Betrachtung von Margret Boveris Werk zum Thema Verrat ein.
Welche Kategorien von Inoffiziellen Mitarbeitern werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Kategorien von IM, einschließlich solcher zur Sicherung bestimmter Bereiche, zur Feinbekämpfung, für logistische Aufgaben sowie Kontaktpersonen und hauptamtliche IM. Die genaue Kategorisierung wird im Kapitel 3 detailliert beschrieben.
Welche konkreten Beispiele für IM werden genannt?
Die Arbeit enthält als Fallbeispiele die IM „Klaus Müller“ und „Mark Aurelius“, um den Einsatz jugendlicher IM durch das MfS zu beleuchten. Weitere konkrete Beispiele könnten im Hauptteil der Arbeit enthalten sein.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inoffizieller Mitarbeiter (IM), Staatssicherheit (Stasi), Ministerium für Staatssicherheit (MfS), Denunziation, Verrat, DDR, Rekrutierung, Überwachung, Repression, Richtlinien, Kategorien, Geschichte, Fallstudien.
- Quote paper
- Ralph Ettrich (Author), 2002, Der "Inoffizielle Mitarbeiter" als gezielter Denunziant innerhalb des Systems der Staatssicherheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51374