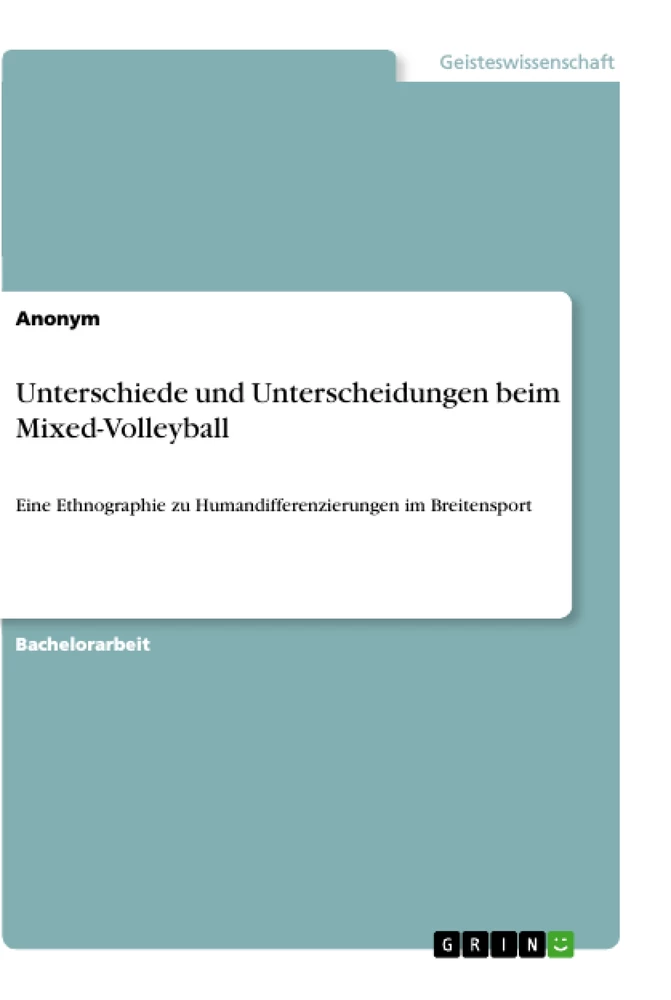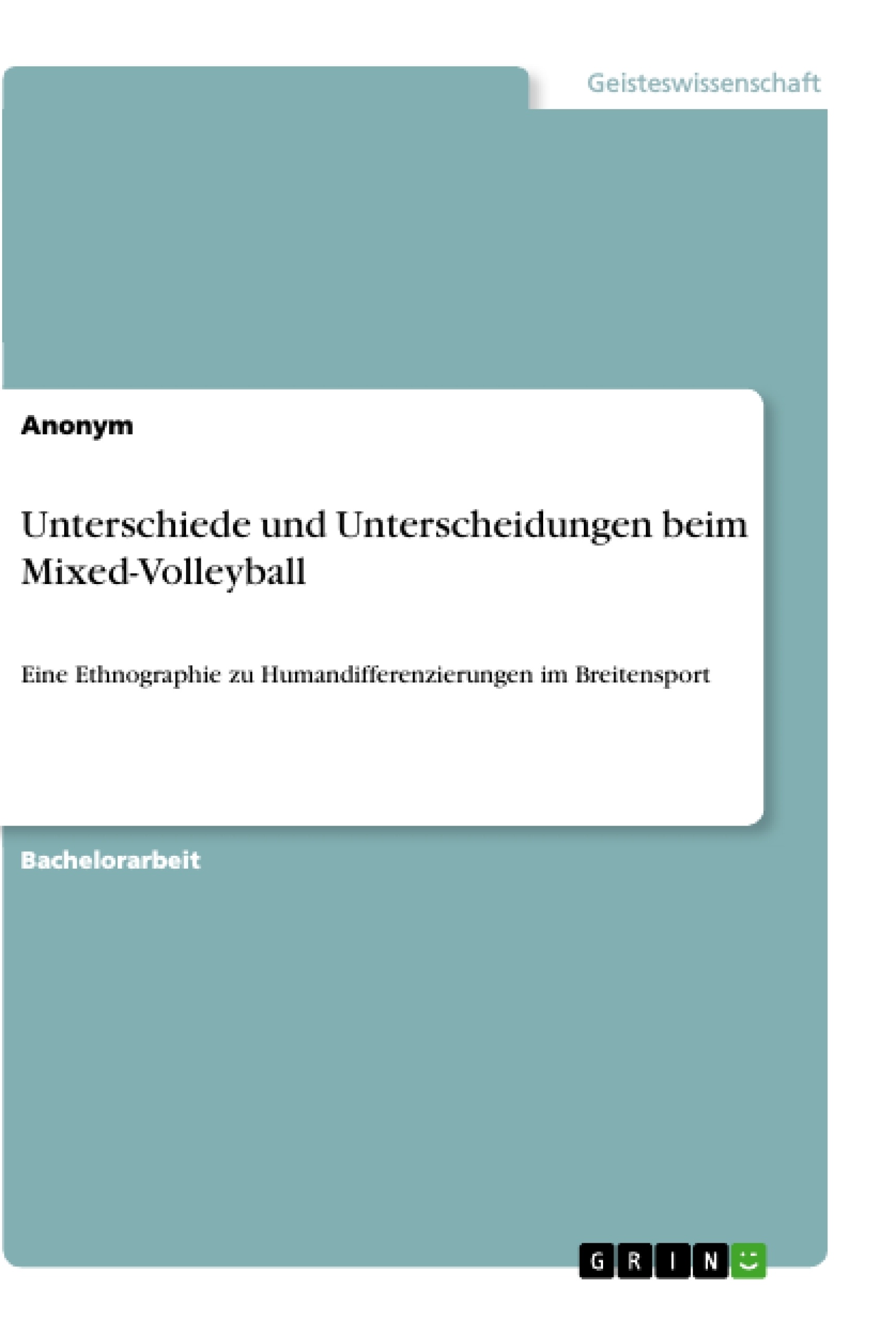In Margared Meads 1931 veröffentlichten Studie über Gesellschaftsstrukturen in Neuguinea folgert sie, dass Geschlechterrollen kulturell bedingt seien und nicht genetisch vorgegeben (Mead 1981). Durch diese Forschung wurde das Thema Gender in der Ethnologie etabliert. Heutzutage fragt die Forschung nicht mehr nach der Rolle der Frau in der Gesellschaft, sondern hinterfragt, was Geschlecht bedeutet und wie diese Humankategorie funktioniert. Seitdem hat in der Geschlechterforschung „eine Entwicklung von differenztheoretischen Perspektiven hin zu dekonstruktivistischen Perspektiven stattgefunden“ (Richthammer 2017). (...)
Arbeiten von Marion Müller (2006), Karolin Heckemeyer (2017) und Michael A. Messner (2010) zeigen, dass der Sport von Geschlechterrollen durchdrungen ist. (...)
Der grundsätzlich unterstellte Leistungsvorteil der Männer wird schon im Schulsport produziert und bis zum Leistungssport reproduziert (Messner 2010). Geschlecht fungiert neben „race“ und „disability“ als soziale Teilungsdimension des Sports (Müller/Steuerwald 2017). Die zentrale Logik des Sports ist demnach eine „vergeschlechtliche Leistungslogik“ (Heckemeyer 2017) Dabei stellt sich die Bildung von Leistungsklassen anhand der Geschlechterdifferenz als Taktik heraus, um einen Leistungsvergleich zu vermeiden und so Geschlechterrollen im Sport zu manifestieren und zu reproduzieren (Müller 2006, Heckemeyer 2017). In der sportsoziologischen Literatur wird die „strikt geschlechterbinäre Wettkampfstruktur“ (Heckemeyer 2017), besonders wegen der unmittelbar damit verschränkten Vorstellung eines „level playing field“ kritisiert (Heckemeyer 2017; Sullivan 2011). Chancengleichheit sei weder innerhalb noch außerhalb der Geschlechterklassen möglich, getrennte Wettbewerbe seien mit der Fairnesslogik nicht zu legitimieren (Sullivan 2011).
(...) In der Geschlechterforschung wurden binäre Geschlechtervorstellungen bereits durch plurale Vorstellungen von Geschlechtlichkeit abgelöst (Richthammer 2017). Im Sport, als ein Funktionssystem unserer Gesellschaft, wird das Geschlecht jedoch nach wie vor in einer binären Kategorie gedacht.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Hauptteil
Zur Datenerhebung
Theoretische Einbettung
Analyse
Humandifferenzierungen in offiziellen Regeln
Der Einfluss des Leistungssports
Humankategorien in der materiellen Kultur und in sozialen Interaktionen
Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Einleitung
Das Thema gender und sex wird immer häufiger zum Hauptforschungsthema von soziologischen und ethnologischen Forschungen. Die große Pionierin der Gender Studies im Bereich Ethnologie ist Margaret Mead. In ihrer erstmals 1931 veröffentlichten Studie über Gesellschaftsstrukturen in Neuguinea folgerte sie, dass Geschlechterrollen kulturell bedingt seien und nicht genetisch vorgegeben (Mead 1981). Durch diese Forschung wurde das Thema gender in der Ethnologie etabliert. Heutzutage fragt die Forschung nicht mehr nach der Rolle der Frau in der Gesellschaft, sondern hinterfragt, was Geschlecht bedeutet und wie diese Humankategorie funktioniert. Seitdem hat in der Geschlechterforschung „eine Entwicklung von differenztheoretischen Perspektiven hin zu dekonstruktivistischen Perspektiven stattgefunden“ (Richthammer 2017: 135).
Es war folgende Situation, die den Auslöser gab, mich mit den Geschlechterunterschieden im Sport zu befassen: Ich war seit dreieinhalb Monaten in einem Mixed-Volleyball-Team - hatte davor in einer reinen Damenmannschaft gespielt - und lernte den Mixed-Wettkampfbetrieb schon etwas kennen. Auf einem Turnier Anfang des Jahres 2019, zu dem zwölf Teams gekommen waren, trat unser Team in der Vorrunde mit vier Frauen auf dem Feld an, wobei die Regel besagte, eine Mannschaft (die aus sechs Spieler*innen besteht) konstituiere sich aus „mindestens drei Frauen“. Ungeübt wie mein Blick auf das Thema Geschlechterzusammensetzung war (da es im Damenvolleyball kein Thema ist), bemerkte ich es nicht einmal, dass bei uns eine Frau mehr auf dem Spielfeld stand, als bei den gegnerischen Teams. Bei der Siegerehrung gab es zusätzlich eine mündliche Würdigung für uns: Das einzige Team, welches die komplette Vorrunde – und sogar sehr erfolgreich – mit vier Frauen gespielt hat!
Diese Würdigung machte mich nicht stolz, auch wenn dies wahrscheinlich die Intention der Würdigung gewesen war – denn es implizierte etwas Unausgesprochenes: Nahm man etwa an, dass dem Team aus einer Überzahl an Frauen (und damit einer relativen Unterzahl an Männern) ein Nachteil entstünde?
Arbeiten von Marion Müller (2006), Karolin Heckemeyer (2017) und Michael A. Messner (2010) zeigen, dass der Sport von Geschlechterrollen durchdrungen ist.
„We now have over three decades of scholarly research that shows how these beliefs in the essential differences between women and men were constructed through the routine operation of institutions, including organized sports. Boys’ access to sports, coupled with girls’ lack of access, literally shaped our bodies and thus our belief that men were naturally strong and athletic, while women were naturally frail and in need of protection—a belief that not-so-incidentally corresponded with the post–World War II pushing of women out of the labor force and into the cult of motherhood and homemaking“ (Messner 2010: 2).
Der grundsätzlich unterstellte Leistungsvorteil der Männer wird schon im Schulsport produziert und bis zum Leistungssport reproduziert (Messner 2010). Geschlecht fungiert neben „race“ und „disability“ als soziale Teilungsdimension des Sports (Müller/Steuerwald 2017:18). Die zentrale Logik des Sports ist demnach eine „vergeschlechtliche Leistungslogik“ (Heckemeyer 2017: 27) Dabei stellt sich die Bildung von Leistungsklassen anhand der Geschlechterdifferenz als Taktik heraus, um einen Leistungsvergleich zu vermeiden und so Geschlechterrollen im Sport zu manifestieren und zu reproduzieren (Müller 2006: 409, Heckemeyer 2017: 27). In der sportsozio- logischen Literatur wird die „strikt geschlechterbinäre Wettkampfstruktur“ (Heckemeyer 2017: 45), besonders wegen der unmittelbar damit verschränkten Vorstellung eines „level playing field“ kritisiert (Heckemeyer 2017: 45; Sullivan 2011: 415). Chancengleichheit sei weder innerhalb noch außerhalb der Geschlechterklassen möglich, getrennte Wettbewerbe seien mit der Fairnesslogik nicht zu legitimieren (Sullivan 2011: 415).
Neuere Erkenntnisse der Biologie legen zudem eine Pluralität von Geschlechtern nahe (Voß 2011: 309). In Deutschland wurde das dritte Geschlecht (auch divers genannt) Anfang dieses Jahres auch rechtlich anerkannt. In der Geschlechterforschung wurden binäre Geschlechter- vorstellungen bereits durch plurale Vorstellungen von Geschlechtlichkeit abgelöst (Richthammer 2017: 135). Im Sport, als ein Funktionssystem unserer Gesellschaft, wird das Geschlecht jedoch nach wie vor in einer binären Kategorie gedacht.
Aus den genannten Gründen möchte ich mich zahlreichen Arbeiten der (Sport- ) Soziologie anschließen, um über die Kategorie Geschlecht als Leistungsklasse zu reflektieren. Das Forschungsfeld stellen gemischt- geschlechtliche Volleyballmannschaften dar, die sich zum gemeinsamen Sporttreiben in der Freizeit organisieren. Im Zentrum steht die Annahme, dass leistungsrelevante Kategorien ausgeblendet werden, sodass die Kategorie Geschlecht weiterhin als binär gedachte, soziale Teilungsdimension des Sports, auch im Hobbybereich, aufrechterhalten wird. Die sich daraus ergebenden Fragen sind: Inwiefern kommt die Kategorie Geschlecht beim gemischtgeschlechtlichen Sport zum Tragen? Und: wird die Geschlechterdifferenz dramatisiert?
Hauptteil
Die moderne Gesellschaft, in der wir leben, wird in der soziologischen Literatur durch ihre Funktionssysteme charakterisiert (Luhmann 1984, Nassehi 2017: 55). Die Fragestellung dieser Arbeit bewegt sich in einem solchen gesellschaftlichen Teilbereich, dem Funktionssystem Sport. Das Funktionssystem Sport gliedert sich in seine Sportartensysteme, die eine „Verkettung von Wettkampfinteraktionen“ sind (Schulze 2005: 92). Weiter definiert Schulze Sportarten durch ihre spezifische Wettkampfinteraktion, die durch die Wettkampforganisation, einem Verband, organisiert werden. „Die Wettkampforganisation bringt segmentär nach Alter und Geschlecht (…) unterschiedliche Wettkampfsysteme derselben Sportart hervor.“ (Schulze 2005: 92).
Die prinzipielle Ergebnisoffenheit eines jeden Wettkampfes sorgt für Spannung bei den Zuschauern wie Teilnehmern. Um sie herzustellen, wird durch funktionelle und präsumtive Leistungsklassen ein Vorentscheid getroffen, wer gegeneinander antreten kann (Müller 2006: 395). Die funktionellen Leistungsklassen basieren auf bisherigen Wettkampfergebnissen. Sie funktionieren durch das Muster von Aufstieg und Abstieg; „Konkurrenz wird erst möglich, indem man sich auf Leistungen mit einem gemeinsamen Maßstab beziehen kann“ (Müller 2006: 394). Präsumtive Leistungsklassen orientieren sich am Körper der Sportler*innen. Den gemeinsamen Maßstab, auf den die Leistungen bezogen werden, bilden damit askriptive Merkmale. Das sind solche, die am Körper ansetzen und „lediglich als Indikatoren für die körperliche Leistungsfähigkeit dienen“ (Müller 2006: 395). Beispiele hierfür, die Müller (2006: 395) nennt, sind die Gewichtsklassen beim Boxen und Leistungsklassen nach Alter und Geschlecht, die in vielen Sportarten üblich sind.
Auch Verschachtelungen von Leistungsklassentypen kommen in vielen Sportarten aus Leistungsniveau vor – so auch beim Volleyball: Durch präsumtive Leistungsklassen wird nach zwei Geschlechtern separiert, bevor die Einteilung in funktionelle Leistungsklassen stattfindet (vgl. Müller 2006: 395). So dient primär das Geschlecht als gemeinsamer Maßstab, auf den die Leistungen bezogen werden und an dem sich die Konkurrenz konstituiert, indem im Voraus ein Teil der Konkurrenz vom Leistungsvergleich anhand dieser Differenzlinie ausgeschlossen wird.
In dem von mir beobachteten Feld handelt es sich jedoch nicht um einen geschlechterseparierten Sport. Die Hobbyvolleyballer spielen zusammen ein Mixed-System, bei dem prinzipiell jede*r mitmachen kann – Frauen und Männer gemeinsam. Obligatorisch bei Wettkämpfen ist jedoch nur ein Anteil von Frauen, sodass auch eine reine Damenmannschaft an einem Mixed- Wettkampf antreten könnte.
Durch meine Forschung zeige ich mithilfe von Stefan Hirschauers analytischen Rahmen über Humandifferenzierungen, welche Differenzierungen wann gezogen werden und wie diese Differenzierungen funktionieren. Einhergehend damit wird es um die Zuschreibungen gehen, die in dem Sport als Leistungsrelevant erachtet werden. Schließlich werde ich mich mit der Rolle von Humankategorien als Zulassungs-, bzw. Ausschlusskriterien im Volleyball befassen.
Zur Datenerhebung
Das Untersuchte Feld des Mixed-Volleyballs, verstanden als sportliche Aktivität in einem gemischtgeschlechtlichen Team als Freizeitsport, ist primär durch die gemeinsame Aktivität der Beteiligten, zeitlich und personell, abgrenzbar. Der Freizeitsport wird auch „Breiten- und Freizeitsport“ genannt und bezeichnet im Volleyball immer gemischtgeschlechtliche „Mixed-Mannschaften“.
Die Personen, die in dem Feld agieren, sind Mitglieder der Volleyballabteilungen verschiedener Sportvereine und verbringen einen Teil ihrer Freizeit damit, sich zusammenzufinden, um gemeinsam diesen Sport hobbymäßig zu betreiben. Die Ausübung des Sports ist der Grund der Mitgliedschaft der einzelnen Personen und des (ein- bis zweimal, in Ausnahmen mehrmals wöchentlich stattfindenden) Zusammentreffens zum Zweck des Trainings oder des Wettkampfes. Diese Personen sind Vereinsmitglieder oder – im Falle des Hochschulsports – Studierende an einer Universität. Die Räumlichkeiten und Sportgeräte werden vom Verein oder der Universität bereitgestellt. Die Mitgliedschaft im Verein oder Immatrikulation an der Hochschule ist jeweils die Zugangsvoraussetzung.
Zwischen den Sportgruppen bestehen große Unterschiede, die sich in der Motivation der Beteiligten, der Regelmäßigkeit des gemeinsamen Trainings, in der (Nicht-) Teilnahme an Wettkämpfen, sowie im Leistungsniveau ausdrücken. Ich konnte bei meiner Forschung, abgesehen von den Unterschieden, auch Gemeinsamkeiten herausarbeiten: Dazu zählen soziale Praktiken, die von den Akteuren in jeder der untersuchten Gruppen angewandt wurden und die im Feld vorherrschenden Regeln, auch wenn es sich um ungeschriebene handelt.
Örtlich fand die Forschung innerhalb des Gebiets des Volleyballverband Rheinhessen (VVRH) statt. Die hier vorgefundenen Differenzierungsformen lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auch in diversen anderen Volleyballverbänden der Bundesrepublik finden.
Bei dieser teilnehmenden Beobachtung bestand der Feldzugang zum Teil bereits vor der Idee der Forschung: Das Team, in dem ich momentan selbst Volleyball spiele – ich nenne es in dieser Arbeit Traubenheim1, hat mich bereits im Herbst vergangenen Jahres als Mitglied und Spielerin aufgenommen. Die Tatsache, dass ich vorher in einer Damenvolleyballmannschaft aktiv war, schaffte mir ein relativ breites Spektrum an Möglichkeiten des Zugangs im Feld des Mixed-Volleyballs. Ich entschied mich für ein Probetraining bei einem Team, das ich in Wettkampfergebnislisten des Verbandes fand. Dadurch konnte ich das Spielniveau ungefähr einschätzen, ohne mir vorher auch nur ein Spiel des Teams angeschaut zu haben. Ein Auswahlkriterium war demnach das Leistungsniveau, wobei ich ein mit meiner vorherigen Damenmannschaft vergleichbares Niveau angestrebt habe. Ein zweites Kriterium war die relative Nähe zu meinem Wohnort.
Mitglied zu werden war ein Prozess, bei dem ich verschiedene Stadien durchlief. Nach einem Telefonat nahm ich probeweise am Training teil. Zu diesem Stadium war ich „Interessierte“. Später unterschrieb ich eine Beitrittserklärung zum Verein, die mich formal gesehen zum „Mitglied“ machte. Durch meine regelmäßige Anwesenheit im Training und zu den Spielen, lernte ich mit der Zeit meine Mitspieler*innen kennen – ein langsamer Prozess, da sich die Themen in dem Umfeld erwartungsgemäß vor allem auf den Sport selbst beziehen. Als Mitglied fühlte ich mich erst ab dem Moment, in dem mir mein eigenes Trikot überreicht wurde. Ich hatte bereits ein Spiel ohne Trikot mitspielen können, aber in die Farben meiner Mannschaft gehüllt, werde ich selbst von außen als Mitspielerin wahrgenommen.
Diese Mixed-Volleyballmannschaft bot einen gut geeigneten Feldzugang, denn neben dem wöchentlichen Training wurde in drei verschiedenen Hobbyligen mitgespielt, in denen zwei verschiedene Regeln gelten, was die Zusammensetzung der Mannschaften betrifft: In den Ligen „BFS“ und „Mixed“ gelten zwei unterschiedliche Modi, welche die Mindestanzahl von Frauen vorgeben. Einige Teams spielen in beiden Ligen. Abgesehen davon fahren meine Teamkolleg*innen und ich gemeinsam gelegentlich zu Turnieren. Durch die Teilnahme an Spielen verschiedener Wettkampfsysteme konnte ich nach und nach einen umfassenden Einblick in das Feld des Mixed-Volleyballs gewinnen.
Meine Entscheidung, nicht nur stationär vorzugehen, sondern abgesehen von meinem Team, bei dem der Feldzugang bereits bestand, auch bei weiteren Hobbyvolleyballgruppen zu forschen, liegt darin begründet, unterschiedliche Perspektiven und Motivationen der Personen zu sammeln und aufzuzeigen, sodass das Forschungsfeld in seiner Gesamtheit besser zu verstehen ist.
Das Team Traubenheim war mit der Forschung einverstanden und verwehrte sich meinem Vorhaben nicht. Es war wahrscheinlich Grund genug, dass ich ein Teil des Teams bin. Bei meiner Forschung in einer anderen Gruppe (ich nenne sie in dieser Arbeit „Team Ameisenberg") bekam ich den Feldzugang durch Personen, mit denen ich in der Vergangenheit regelmäßig Volleyball gespielt hatte und mit denen noch eine sportlich-freundschaftliche Beziehung besteht. Zugang zur dritten Gruppe – diese ist nicht durch einen Verein organisiert, sondern durch den allgemeinen Hochschulsport einer Universität – bekam ich, da sie in Räumlichkeiten der Universität trainieren, durch meinen Studierendenstatus. Dort entgegnete mir meine Interviewpartnerin in akademischer Manier, zu Forschungszwecken würde sie mir gerne helfen. Lediglich meine vierte Anfrage zur Forschung in einer weiteren Gruppe blieb unbeantwortet, möglicherweise aus dem Grund, dass ich die angefragte Person nur relativ flüchtig kannte. Die Beziehung zwischen Interviewerin und Interviewpartner*innen spielte demnach eine entscheidende Rolle für den Feldzugang.
Um die Differenzierungspraktiken in diesem Feld zu erforschen, habe ich mich für eine teilnehmende Beobachtung entschieden. Diese Methode wird in der Ethnologie mit dem Ziel angewandt, Menschen möglichst unverändert zu beobachten und die „natürlichen Lebenssituationen“ zu untersuchen (Fischer 1998: 74).
Eine teilnehmende Beobachtung ist zeitlich gestreckt und beinhaltet Feldphasen. Bei den Feldaufenthalten wird ein möglichst „variantenreiches und qualitativ umfassendes Datenmaterial“ (Amann/Hirschauer 1997 :16) erhoben. Die Vielzahl an Feldaufenthalten fand bei verschiedenen, im Umkreis trainierenden Gruppen statt, sodass Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen herausgearbeitet werden konnten. Ich war zu den Trainingseinheiten anwesend, bei denen ich beobachtend und teilnehmend auftrat und es zudem zu informellen Gesprächen kam. Außerdem führte ich Gespräche mit einem Gesprächsleitfaden, die ich mithilfe eines Tonbandgeräts aufnahm. Notizen machte ich mir oft am selben Abend, kurz nach dem Training beziehungsweise Wettkampf. Die Beobachtungen hielt ich in einem Feldtagebuch fest. Aufgezeichnete Gespräche transkribierte ich möglichst bald, spätestens am nächsten Tag.
Aus den anfangs geplanten Gruppengespräche ergaben sich wegen der Trainingssituationen Gespräche mit Gruppen unterschiedlicher Größen, sowie ein Einzelinterview. Möglicherweise lag dies an meiner Zurückhaltung. Bei der Bestimmung der Gesprächsgruppen hätte ich fordernder auftreten können und mich weniger wegen einer potenziellen Störung des Trainingsablaufs zurückhalten müssen.
Die Interviews führte ich themenzentriert (vgl. Schlehe 2008: 78), sie wurden in einer dem Thema angepassten Umgebung geführt. Zu Beginn dieser Gespräche erklärte ich das Ziel der Forschung, machte den Interviewpartner*innen deutlich, dass Diskussionen erwünscht sind und sicherte ihnen Anonymität zu (vgl. Schlehe 2008: 74). Ein Interviewleitfaden half mir bei der Gesprächsführung; dieser wurde auf Basis der Beobachtungen und aus informellen Interviews erstellt (vgl. Schlehe 2008: 78). Ich hielt mich vage an den Interviewleitfaden, ließ je nach Gesprächsführung einzelne Fragen aus oder stellte sie an einer anderen Stelle des Gesprächs, und stellte Nachfragen, die sich aus dem Gesprächskontext ergaben. Reziprozität im Gespräch kam teilweise durch die Nachfragen und durch das Einbringen eigener Meinung auf. Als besonders wertvoll für die Analyse erwiesen sich Diskussionen (so auch Schlehe 2008: 78) und gegenseitiges Kommentieren der Interviewten untereinander.
Da das Feld meines Forschungsinteresses sich durch kürzere (meist zweistündige), regelmäßige (oft nur wöchentliche) Zusammenkünfte der in dem Feld agierenden Personen auszeichnet, war die Forschung durch einen Wechsel zwischen kürzeren Feldforschungsphasen und längeren Phasen der Datenaufbereitung und Literaturrecherche gekennzeichnet.
Die verminderte Aufnahmefähigkeit nach körperlicher Betätigung stellte sich für mich als Problem dar; beim ethnographischen Interview wird vom Interviewer eine hohe Aufmerksamkeit gefordert. Interviews nach sportlicher Aktivität waren enger am Interviewleitfaden orientiert, und ich habe weniger Nachfragen gestellt, als bei Gesprächen ohne vorangegangene körperliche Verausgabung. Während der sportlichen Betätigung waren Beobachtungen besonders erschwert; jahrelanges Training lehrte mich, mich nur auf den Ball zu konzentrieren. Bei dieser Forschung wurde mir im besonderen Maße klar, wie begrenzt die menschliche Wahrnehmung ist. Teilnehmen und Beobachten war schlicht nicht immer gleichzeitig möglich. Wegen dieser Umstände entschloss ich mich, nicht bei jedem Feldaufenthalt als Spielerin teilzunehmen. So konnte ich auch detailreichere Beobachtungen festhalten, die ich als aktive Teilnehmerin nicht hätte zu Papier bringen können.
Die räumliche und zeitliche Umgebung der aufgenommenen Gespräche (während der Trainingszeiten) führte mich weiter zu dem Problem, dass mich ein schlechtes Gewissen plagte, die Interviewpartner*innen von ihrem Hobby abzuhalten und den Trainingsablauf zu beeinflussen. Umgekehrt kann es einen Einfluss auf die Spieler*innen gehabt haben, dass sie in diesem Moment nicht ihrem Hobby nachgingen, für das sie eigentlich gekommen waren. Möglicherweise wurden die Erzählungen so kürzer, als sie es in einer anderen räumlichen und zeitlichen Umgebung geworden wären.
Datenschutz ist wichtig. Deshalb habe ich beim Transkribieren der Audiodateien alle Personennamen verfremdet, sodass Rückschlüsse auf die Klarnamen einzelner Personen nicht mehr gezogen werden können. Auch die Namen der jeweiligen Hobbyvolleyballgruppen wurden verfremdet, da sie über den Ort, an dem das Training stattfindet, Auskunft geben und nicht als Forschungsrelevant erachtet werden. Der Lesbarkeit halber wurden alle Namen durch adäquate Pseudonyme ersetzt (vgl. Meyer und Meier zu Verl 2019: 285).
Diese Arbeit stellt den Versuch dar, einen Teilbereich der modernen Gesellschaft aus der emischen Perspektive heraus zu beschreiben. Der Akzent der Forschung lag auf den Formen der Differenzierung und wie sie in der Praxis gelebt werden. „Die ethnomethodologische Grundannahme ist, dass alle soziale Differenzierung praktiziert werden muss, (…) wobei Individuen (…) als bloße Vermittler sozialer Praxis betrachtet werden.“ (Hirschauer 2014: 182). Die teilnehmende Beobachtung erwies sich als hilfreiche Methode, da sie mir die Praktiken der Menschen nicht nur vor Augen hielt, sondern mich selbst in sie einband. Die Forschung belehrte mich auch meiner persönlichen Grenzen.
Das Funktionssystem Sport kennt seine eigenen Regeln und Werte, die nicht einfach auf andere Funktionssysteme übertragen werden können. Die erhobenen Daten können deshalb nur im Kontext des Funktionssystems Sport interpretiert werden. Zwischen den örtlich begrenzten Volleyballverbänden können die Ergebnisse vergleichend betrachtet werden.
Theoretische Einbettung
Ausgehend von der Fragestellung, wieso beim anfangs erwähnten Turnier ein Frauen-“Überschuss“ zur Kenntnis genommen wurde und damit einhergehend, wie Frauen und Männer im Sport wahrgenommen werden, habe ich mich dem Thema durch qualitative ethnologische Feldforschung genähert.
Für die teilnehmende Beobachtung hielt ich mich im Feld bei verschiedenen Mixed-Mannschaften auf, bei denen ich teilnehmend und beobachtend auftrat. Zunächst stand dabei die Frage im Mittelpunkt, welche Humandifferenzierungen zum Vorschein treten. Es geht dabei um die Frage, „welche Praktiken, welchen Unterscheidungsgebrauch einführen, weiterverfolgen, restabilisieren oder auch wieder loswerden“ (Nassehi 2017: 55) - das Unterscheiden selbst wird zum Gegenstand gemacht. Charakteristisch dafür ist die „Kontingenzperspektive auf soziale Phänomene“ (Hirschauer 2014: 172; Reckwitz 2008: 17). Das Differenzieren ist ein kultureller Akt, der auf die soziale Relevanz von Differenzierungsformen verweist (Pellow 1996: 215; Hirschauer 2014: 183).
Mit Verweis auf die Kontingenzperspektive stellt sich die Frage, welche Differenzierungen möglich sind. Außerdem wird mit Bezug auf das Funktionssystem Sport der Frage nachgegangen, welche Differenzen zur Bildung von Leistungsklassen als relevant erachtet werden - und welche tatsächlich gebraucht werden. Zunächst werde ich deshalb erklären, welche Differenzen im Sport möglicherweise relevant sein könnten. Um Differenzierungsformen erkennen und verstehen zu können, müssen zunächst Stefan Hirschauers Erkenntnisse über Humandifferenzierungen als analytischer Rahmen herangezogen werden.
Humandifferenzierungen durchdringen unseren Alltag und können auf verschiedene Arten hervorgebracht werden: In sozialen Praktiken, institutionellen Infrastrukturen und in Elementen der materiellen Kultur; etwa „Strukturen des sozial geformten Körpers, Artefakte[n], Technologien und Architekturen.“ (Hirschauer/Boll 2017:15). Es ist ein Teil der menschlichen Kultur, Menschen und Dinge in Kategorien zu ordnen. Kategorien „tragen (…) grundlegend zu kultureller Ordnung bei (Hirschauer 2014: 173). „Menschen werden nach einer Vielzahl von Aspekten unterschieden und in Kategorien sortiert.“ (Hirschauer/Boll 2017: 7). Diese Kategorien „fassen für ähnlich gehaltenes zusammen und grenzen es von anderen ab“ (Heintz 2017: 90). Sie „sind nach einer je eigenen Logik konstruiert.“ (Hirschauer/Boll 2017: 7). Differenzierungen können hergestellt, gebraucht oder nicht gebraucht, aufgebaut, abgebaut oder übergangen werden (Hirschauer 2014: 170) und werden immer aus einem „Set konkurrierender Differenzierungen“ (Hirschauer 2014: 183) gewählt. Die Differenzierung schafft eine Unterscheidung, die „einen Unterschied macht“ (Hirschauer 2014: 183). Differenzierungen sind Resultat von historisch kontingenten Konstruktions- und Objektivierungs- prozessen (Heintz 2017: 89). Hirschauer betont, Kategorien seien „kontingente sinnhafte Unterscheidungen“ (Hirschauer 2014: 170), und spricht weiter von Aufbau und Abbau von Humandifferenzierungen, beispielsweise der Gebrauch der Kategorie Ethnizität im Südafrika der Apartheid und späteren bewussten Irrelevant-setzen dieser Unterscheidung im Zuge der Antidiskriminierungs- politik (Hirschauer 2014: 183).
Zu den „kulturgeschichtlichen Schwergewichten“ (Hirschauer/Boll 2017: 8) der Differenzierungen zählen laut den beiden Autoren Ethnizität, Rasse, Geschlecht, Leistung, religiöse sowie nationale Zugehörigkeit. Neben diesen seien auch viele weitere Kategorisierungen möglich: „Generationen und Altersgruppen, Milieus und Professionen, die verschiedenen Distinktionen von Normalen und Deviantem, aber auch ganz alltagsweltliche Differenzierungen nach Dialekt, Attraktivität oder Leibesfülle.“ (Hirschauer/Boll 2017: 8). Diese Auflistung zeigt, dass Humandifferenzierungen einerseits verschiedene Ansatzpunkte haben. Diese können der Körper, eine Tätigkeit oder bestimme Güter sein (Hirschauer/Boll 2017: 8). Zudem unterscheiden sie sich auch dadurch, dass die Verweildauer in den verschiedenen Kategorien variiert, die Besetzungsstärke der unterschiedlichen Kategorien variiert und auch die sozialen Einheiten, welche die Kategorisierungen zu produzieren zum Ziel haben, variieren (Hirschauer/Boll 2017: 8). So schreiben Hirschauer und Boll, Leistung ziele auf die Herstellung von Individuen, Geschlecht auf die Bildung von Paaren; Ethnizität, Nationalität und Religion ziele hingegen auf die Bildung von Kollektiven (Hirschauer/Boll 2017: 8).
Kalthoff schreibt, es seien zwei Operationen voneinander zu unterscheiden: Die Kategorisierung von Menschen selbst und die klassifizierende Bewertung. Zwischen diesen bestehe immer ein Zusammenhang, indem Beschreibungen über Menschen „zugleich die Zuschreibung eines Wertes mit organisieren“ (Kalthoff 2017: 216). Daher reiche die klassifizierende Bewertung „ihrerseits [von] einer nicht-hierarchisierenden [bis hin zu] einer stark hierarchisierenden Form“ (Kalthoff 2017: 216). Im Leistungssport werde die Hierarchie durch die Betonung der Unvergleichbarkeit der Geschlechter rhetorisch verdeckt, schreibt Müller (2006: 400).
Analyse
Diese Arbeit soll zeigen, welche Praktiken welchen Unterscheidungsgebrauch beim Mixed-Volleyball aufrechterhalten und stabilisieren: Auf Institutionelle Weise - durch festgeschriebene Regeln, durch den Leistungssport als Vorbild des Hobbysports, in der materiellen Kultur und sozialen Kommunikations- formen.
Humandifferenzierungen in offiziellen Regeln
In den allgemeinen Volleyballregeln festgelegt, finden sich Differenzierungen von zwei gleichzeitig wirkenden präsumtiven Leistungsklassen. Differenzierungen im Ligabetrieb setzen hier an den beiden askriptiven Merkmalen „Alter“ und „Geschlecht“ an und haben jeweils angepasste Regeln zur Konsequenz, die sich in der Höhe des Netzes äußert. Eine Tabelle von Arno Schulz (1987: 21) zeigt die Regeln zur Höhe des Netzes in den jeweiligen präsumtiven Leistungsklassen. Die Netzhöhe wird nach Altersklassen gestaffelt, die bereits vorher nach Geschlecht separiert wurden: Der niedrigste Wert von 2,10m wird in der weiblichen D-Jugend (die jüngste Altersklasse) angewandt, die gleichaltrigen Herren hängen das Netz fünf Zentimeter höher. In jedem Alter spielen die Herren den Ball über ein höheres Netz als die gleichaltrigen Damen. Die männliche Jugend muss sich beim Wechsel in eine höhere Altersstufe mal an ein sechs Zentimeter höheres Netz anpassen (von D-Jungend nach C-Jugend), beim Wechsel von C-Jugend nach B-Jugend beträgt die Differenz ganze elf Zentimeter. Beim Wechsel in die nächsthöhere Altersklasse (Wechsel von B-Jugend zur A-Jugend) liegt die Differenz bei neun Zentimetern. Den jungen Männern wird im Laufe des Älterwerdens viel Anpassungsfähigkeit abverlangt. Anders sieht das bei den jungen Damen aus: Wenn die jüngsten (D-Jugend) in die nächsthöhere Altersklasse (C-Jugend) wechseln, müssen sie sich an ein fünf Zentimeter höheres Netz gewöhnen. Auch beim Wechsel in die B-Jugend wird das Netz nur fünf Zentimeter höher sein. Im letzten Schritt wird das Netz nur vier Zentimeter höher gehängt. Ab der A-Jugend hängen die Damen das Netz auf die Höhe von 2,24 Meter; die Herren auf 2,43 Meter. Eine Reduktion der Höhe wird erst ab dem Seniorenalter und nur bei den Männern vorgenommen.
Es wird deutlich, dass der Sport den männlichen Jugendlichen im Laufe des Älterwerdens mehr Anpassungsfähigkeit abverlangt, als den weiblichen. Zwei präsumtive Leistungsklassen wirken dabei ineinander: Alter und Geschlecht, wobei das Alter eine Leistungsklasse darstellt, die gezwungenermaßen veränderlich ist, während das Geschlecht eine exklusive Mitgliedschaft darstellt, die in der Regel nicht veränderlich ist. Die Geschlechterdifferenz wird in allen Altersklassen gebraucht und damit werden Unterschiede in der Behandlung von weiblichen und männlichen Spielern legitimiert.
Um beim Mixed einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Netzhöhen der Damen und der Herren zu finden, gibt es eine pragmatische Lösung: „[M]an trifft sich in der Mitte“ (Jens; Transkript 2: Z. 63). Für die Männer hat dies eine geringere Netzhöhe als in der Liga zur Folge, für Frauen bedeutet dies ein höheres Netz als in der Liga. Damit ist die Umstellung von Liga-System zum Mixed-System für Frauen schwieriger als sie sich bei Männern, die von der Leistungsliga in das Mixed-System wechseln, gestaltet. Meine Interviewpartnerin Jana drückt das so aus: „(…) für Männer ist die Netzhöhe ja auch ´nen Ticken niedriger – Männer spielen ja höher – Damen spielen tiefer – das heißt, für uns [Damen] ist es eigentlich schwerer und für die [Männer] ist es einfacher (…)“ (Jana; Transkript 3: Z. 83-87). Die unterschiedlichen Höhen des Netzes wirken sich auf die Spielweisen von Frauen und Männern auf unterschiedliche Art aus. Frauen, die ein niedrigeres Netz gewöhnt sind, haben nicht trainiert, höher zu springen. Folglich fällt Frauen der Angriff und Block schwerer und so wird nachgesagt: „(…) als Kerl, wenn du jetzt gegenüber ´nen Frauenblock hast, ist es (…) wie kein Block“ (Jana; Transkript 3: Z. 99 f.). Dass „Frauen (…), grad im Block schwächer“ sind (Jana; Transkript 3, Z. 81), führt dazu, dass in den Mixed-Spielen darauf geachtet wird, zwei Frauen nicht nebeneinander aufzustellen, damit ein Mann „dann den Block stellen kann“ (Jana; Transkript3 Z. 89 f.). Von Frauen wird nicht einmal verlangt, den Block zu stellen, Frauen werden deshalb schonmal gefragt, ob sie denn blocken würden (Feldtagebuch [im Folgenden: FTB], Z. 275-279). Diese Aufgabe wird mehr von Männern erwartet, denn für Männer sei es „einfacher“ zu blocken (Jana; Transkript 3, Z. 85).
Die Variationen der Netzhöhen und die Auswirkungen zeigen: Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden im Ligabetrieb des Volleyballsports produziert und beim Übertragen in die Mixed-Variante mit Rollenzuweisungen verknüpft. Die Funktionen der einzelnen Spieler*innen werden damit nach Geschlecht hervorgebracht, jedoch nur im geringeren Maße, entscheidender ist die Körpergröße. Während von Männern erwartet wird, dass sie groß sind und höher springen können, um den gegnerischen Angriff zu blocken, wird eine Frau von Teamkolleg*innen eher gefragt, ob sie überhaupt blocke. Eine Rollenverteilung anhand der Geschlechterdifferenz, wie sie beim Paartanz2 betrieben wird, kommt trotzdem nicht vor. Obwohl sich die beiden Kategorien Körpergröße und Geschlecht im Alltagsverständnis überlagern, werden Frauen wie Männer beim Mixed auf allen Positionen eingesetzt. Die Positionen werden anhand der Professionalisierung vergeben. Körpergröße spielt dabei die wichtigste Rolle, da diese darüber entscheidet, ob das Netz ein echtes Hindernis darstellt oder nicht und in welchem Winkel der Ball zum Gegner geschlagen werden kann. Die kleinsten Personen der Mannschaft sind deshalb meist Zuspieler (die nur in Ausnahmen den Ball über das Netz spielen) oder Liberos bzw. Liberas (deren Aufgaben hauptsächlich aus Annahme und Abwehr besteht).
Die Wettkampforganisation des Volleyball Verbandes Rheinhessen (VVRH) hat für die Mixed-gruppen zwei verschiedene Wettkampfsysteme hervorgebracht. In den Regeln der Mixed-Wettkämpfe ist die geschlechtliche Unterscheidung konstitutiv. Sie wird offensichtlich in den zwei verschiedenen Wettkampfmodi, die ich kennenlernte. Ich spielte mit meinem Team sowohl den Modus „drei-drei“ als auch „vier-zwei“. Diese Modi bestimmen die Mindestanzahl von Frauen auf dem Spielfeld und geben gleichzeitig die binäre Geschlechterlogik wieder. Der Modus vier-zwei bedeutet, dass zu dem Team auf dem Feld, das aus sechs Spieler*innen besteht, in jedem Moment des Wettkampfes mindestens zwei Frauen gehören müssen (FTB, Z. 3-7). Der Mindestanteil an Frauen ist damit genauestens geregelt, jedoch keine maximale Anzahl. Umgekehrt ist es bei den Männern, für die ein maximaler Anteil, aber kein Minimum angegeben wird. Ein Mixed-Wettkampf kann deshalb mit einem ausschließlich weiblichen Team stattfinden, nicht aber mit einem ausschließlich männlichen Team. Kurz: Bei der Modusregel „geht [es] immer um die Damen“ (Elli; Transkript 4, Z. 40f.).
Hier liegt die geschlechtliche Differenzierungsform zunächst in den Regeln vor, sie wird aber auch in der sozialen Praxis gelebt. So übersteigt die Anzahl der Frauen nur selten die Mindestzahl, wie Elli im Gespräch herausstellt: „(…) wenn man sagt, mindestens zwei Frauen, spielen die meisten nur mit zwei Frauen.“ (Transkript 4, Z. 22f.).
In den Gesprächen bringen einige der Akteure sogar hervor, dass es einen Unterschied mache, ob drei oder zwei Frauen auf dem Feld stehen. So meint Jens: „Ich persönlich hab´ festgestellt, dass (…) mit zwei Frauen, [und] vier Männern (…) oftmals n´ bisschen mehr Druck im Angriff ist“ (Transkript 2, Z.48- 50.). Auch Elli betont, dass das Spiel mit nur zwei Damen „schneller“ und „ein bisschen härter“ sei (Transkript 4, Z. 10). Ein Unterschied in den beiden Modi liege laut Dennis auch darin, dass mit einem Mann mehr auf dem Feld „immer zwei Leute zum Blocken vorne“ seien (Transkript 5; Z. 13f.). Ben gibt zu verstehen, dass die beiden Modi für ihn „keinen Unterschied“ machen, sagt aber im weiteren Satz „das bisschen was da anzupassen ist“, mache „auf dem Niveau“ für ihn keinen Unterschied (Transkript 5, Z. 8f.). Er gibt mit seiner Aussage, dass es ein „bisschen (…) anzupassen“ gibt, zu verstehen: Auch für ihn macht es einen Unterschied, obwohl er dies im Satz davor negiert.
Andere betonen, dass es nicht auf die Zusammensetzung ankommt, sondern darauf, dass die beiden gegnerischen Teams ähnlich aufgestellt seien: „[W]enn (…) man ´nen Erfolg in dem Turnier erzielen will dann ist es natürlich besser, wenn man ähnlich aufgestellt ist wie die Mannschaft gegenüber. Weil – wenn die natürlich mit vier Männern spielen, wir aber mit vier Frauen, ist es klar einfach ´ne Kraftsache. (…)“ Weiter führt sie aus: „[E]s ist ja nicht so Techniktraining oder sowas. Das fehlt ja den meisten.“ (Leonie; Transkript 1, Z. 51-55). Der erste Teil der Aussage zeigt, dem Prinzip der Ausgangsgleichheit wird eine große Bedeutung zugesprochen und gleichzeitig wird eine Differenz anhand der Geschlechterkategorie aufrechterhalten.
Der Zweite Teil des Zitats von Leonie und der weiter oben zitierten Aussage von Ben gibt zu verstehen, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern als sich mit dem Leistungsniveau (im Sinne von Techniktraining) veränderlich angesehen werden. Demnach könne Techniktraining die „Kraftsache“ entschärfen. Auf die Kraft allein – die immer nur den Männern zugeschrieben wird – komme es nicht an. „[G]rundsätzlich muss man sagen, Volleyball ist eine der schwersten Ballsportarten die´s gibt, weil´s viel Technik ist – und natürlich, wenn man (…) die Technik nicht so beherrscht, ist eine Frau definitiv besser die die Technik beherrscht als [ein] Mann [der die Technik nicht beherrscht].“ (Elli; Transkript 4, Z. 47-49).
Körperliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern gelten als „ganz klar“ (Klaus; Transkript 5, Z. 86), „menschlich“ (Klaus; Transkript 5, Z. 86) und „nicht von der Hand zu weisen“ (Ben; Transkript 5, Z. 90). Auch wird den Männern ein Leistungsvorteil durch ihre höhere Statur bescheinigt. „bei Männern reicht [es] schon, dass sie groß sind. (…) als Frau musst du (…) schon mehr können“ (Jana; Transkript 3, Z. 53 f.). Demnach mache ein höheres Leistungsniveau auch eine kleinere Körpergröße wett.
Der Einfluss des Leistungssports
„Ich guck ab und zu (…) wenn es zu seh´n ist, [Volleyball im] Fernsehen (…) da sieht man, wie man´s auf ´nem hohen Niveau spielt und man denkt sich: so muss ich´s machen, aber man weiß auch, da komm ich nie hin.“ (Max; Transkript 2, Z. 203-206.).
So wie Max verfolgen viele der Freizeitsportler die Spiele der Volleyball Bundesligen. In den qualitativ hochwertigen Spielen werden Bewegungs- formen, Wettkampfinteraktionen und auch Aspekte wie Bekleidungsformen vermittelt. Der Leistungssport ist ein Vorbild für die Freizeitsportler*innen.
Deshalb müssen zunächst differenzherstellende Aspekte des Leistungssports besprochen werden. Die Wettkämpfe im Leistungssport sind nicht nur nach (auf vorangegangenen Ergebnissen beruhenden) funktionellen Leistungsklassen (vgl. Müller 2006: 395) durch ein Oben-Unten-Schema gegliedert; vor der Leistungsdifferenzierung werden zunächst ebenfalls „präsumtive Leistungsklassen“ (Müller 2006: 395) gebildet, die an askriptiven Merkmalen (In diesem Fall Alter und Geschlecht) als Indikatoren bestimmen, wer mit wem verglichen werden kann.
Die Einteilung in Leistungsklassen dient dazu, Wettkämpfe möglichst ergebnisoffen und dadurch spannend zu halten. Sportliche Leistung wird durch den Körper erbracht. Für die Leistungsklassenbildung im Sport scheint es daher plausibel und legitim, körperliche Merkmale herbeizuziehen (Müller 2006: 398). Humandifferenzierungen, die am Körper ansetzen, können das Geschlecht, die Ethnizität, und auch die Körpergröße sein. Daneben sind weitere denkbar wie Schuhgröße, Muskelmasse, Attraktivität, oder Gewicht. Letzteres wird durchaus zur Leistungsklassenbildung im Boxen herbeigezogen. Es gibt also viele Differenzierungen, die am Körper ansetzen, einige davon könnten für eine Leistungsklassenbildung beim Sport in Betracht gezogen werden.
Vor der Einteilung nach funktionellen Leistungsklassen, werden die beiden askriptiven Merkmale des Alters und des Geschlechts für präsumtive Leistungsklassen herangezogen. Während die Verweildauer in der Altersklasse begrenzt ist, gilt die Mitgliedschaft zu einem Geschlecht als exklusiv (Müller 2006: 402), ein Wechsel ist „praktisch ausgeschlossen“ (Müller 2006: 399). Im Sport erscheinen die körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen „als ein unhinterfragter Gemeinplatz.“ (Heckemeyer 2017: 30).
Diese Geschlechtersegregation findet nach einem „strikt binär organisierte[n] Klassifikationssystem“ (Müller 2006: 399) statt. Personen müssen in der Kategorie Geschlecht entweder als Mann oder als Frau klassifizierbar sein. Hirschauer spricht deshalb von einem „Ausweiszwang“ (Hirschauer 1994: 215). Zusätzlich wird ein Leistungsvergleich zwischen den beiden Geschlechtern unterbunden (Müller 2006: 397f.). Die Geschlechterdifferenz genießt im Volleyball-Leistungssport eine besondere Relevanz. Die Individuen der beiden Pole werden als grundsätzlich verschiedenartig dargestellt, während früher Unterschiede zwischen den Geschlechtern häufig als Defizite der Frauen formuliert wurden (Richthammer 2017: 135). Laut Bettina Heintz (2017: 93) werde im Leistungssport aufwändig versucht, Geschlechterunterschiede zu sichern. Heintz nennt den Leistungssport deshalb eine „Trutzburg“ (2017: 93).
Die Ausgangsfrage, an der sich meine Forschung orientierte, war: Wieso wird die Anzahl der Frauen zur Kenntnis genommen - und eine Überanzahl sogar als positiv angemerkt? Differenzierungsformen wurden mithilfe der Theorien der Mainzer Forschungsgruppe Un/doing Differences unter die Lupe genommen. In meiner Forschung sind neben der Geschlechterdifferenzierung weitere Differenzierungsformen sichtbar geworden. Im Folgenden wird besprochen, inwiefern Humandifferenzierungen als Ausschlussmechanismus aus dem Leistungssport fungieren.
Da innerhalb dieses regionalen Mixed-Feldes zwei verschiedene Wettkampfsysteme vorliegen, die sich in erster Linie in der Zusammensetzung der Mannschaft unterscheiden, wollte ich von meinen Interviewpartner*innen wissen, wieso sie sich für die Mixed-Variante entschieden haben. Es ging nicht darum, den Sport Volleyball oder das Sporttreiben an sich in Frage zu stellen, sondern vielmehr darum, die Motive der Personen herauszuarbeiten, wieso sie sich im Breitensport, als Abgrenzung zum Ligabetrieb, organisieren. Mir wurden pragmatische Antworten entgegnet und Antworten, die sich an der Geschlechterdifferenz orientieren. Eine der Differenzierungsformen trat in besonderem Maße hervor, so stellte sich heraus, dass sich eine geringe Körpergröße als das Ausschlusskriterium aus der Liga erweist: „(…) bei mir persönlich, hieß es immer, ich bin zu klein für die Liga, also Damenliga. Technik haben ´se immer gesagt ist gut, aber Körpergröße wird nicht reichen. Deswegen bleibt mir nicht viel übrig, als Mix zu spielen“ (Elli; Transkript 4, Z. 61-64).
Ellis Antwort orientiert sich an der Liga – sie wollte ursprünglich in der Liga spielen, wurde dort jedoch wegen ihrer Körpergröße ausgeschlossen, denn der Ligabetrieb ist insofern zulassungsbeschränkt, dass sich die Inklusion an körperlichen Merkmalen orientiert, die für die Leistungsfähigkeit als ausschlaggebend gelten. Weil Elli zu klein ist, muss sie in der Mixed-Runde mit einem höheren Netz spielen. Sinnerfahrungen auf den Angriffs- und Blockpositionen bleiben dadurch in doppelter Weise erschwert. Elli ist Zuspielerin.
Auf ähnliche Weise wird der Ausschluss aus der Liga auch von Max beschrieben: „(…) bei Hobbymannschaften bleiben ja die ganz großen Leute raus – also ich bin ja auch kein Großer … das spielt mit eine Rolle, dass man sagt: Okay ich kann ja nicht auf Topniveau spielen, von der Länge her, dann passt das mit´m Mixed (…).“ (Max; Transkript 2, Z. 67-69).
Auch Max berichtet von der Unmöglichkeit, als kleiner Mensch „auf Topniveau“ mitzuspielen. Jens nimmt seine Aussage daraufhin auf und spezifiziert den Ausschluss aus der Liga als Zulassungsbeschränkung für bestimmte Positionen: „Wobei wir Kleinen, (…) sind (…) vielleicht gute Liberos oder so. Gute Annahmespieler, dafür sind wir wahrscheinlich grottenschlecht am Netz. (…) Zuspieler trau ich mir auch noch zu.“ (Jens; Transkript 2, Zeile 70-73).
Mit „am Netz“ sind die beiden Positionen 3 (Mittelblock) und 4 (Außenangriff) gemeint, wobei der Zuspieler auch am Netz steht. Weil dieser aber selten den Ball über das Netz spielt, wird die Körpergröße des Zuspielers nicht als relevant erachtet. Jens spricht die beiden Positionen 3 und 4 an, denn hier haben die größten Spieler einen entscheidenden Vorteil, weil der Ball hauptsächlich von diesen Positionen über das Netz geschlagen wird, oder der Angriff des Gegners über dem Netz abgeblockt wird. Die Höhe des Netzes determiniert damit besonders die kleinen Spieler*innen in ihrem Zugang zu bestimmten Positionen. Die Kategorie Körpergröße stellt sich nicht nur als Ausschlusskriterium aus der Liga dar, sie trägt außerdem zu einer Regulierung des Zugangs zu bestimmten Positionen bei.
Karolin Heckemeyer (2017: 46) betont die sportpolitische Relevanz von Gedanken über alternative Leistungsklassen. Um der Einschränkung kleiner Spieler*innen entgegenwirken, die sich Erstens in einem Ausschluss aus der Liga, Zweitens in einer Beschränkung in der Wahl der Positionen widerspiegelt, liegt der Gedanke über eine alternative Leistungsklasse nahe. Beispielsweise wäre eine Liga denkbar, in der die Inklusion nicht durch die Geschlechterzugehörigkeit, sondern durch eine (maximale) Körpergröße beschränkt ist. Wenn die Höhe des Netzes der (wirklichen, nicht nach dem Kriterium des Geschlechts unterstellten) Körpergröße angepasst ist, wäre Inklusion für kleine Leute auf allen Positionen und sogar „auf Topniveau“ möglich. Auch wurde im Gespräch durch Max der Gedanke einer Altersgrenze hervorgebracht (Transkript 2, Z.107f.).
Die Zuschreibungen, die den Körpern auferlegt werden, spielen für die aktuelle Form von Leistungsklassen eine wichtige Rolle: Männer gelten als größer und stärker; Frauen als kleiner und schwächer. Im Funktionssystem Sport stellen diese Zuschreibungen klar eine hierarchisierende Form der Humandifferenzierung dar. Wer bei der hierarchisierenden Form „oben“ und wer „unten“ steht, wird anhand der Differenzlinie des Geschlechts, mitsamt der dazugehörigen Zuschreibungen festgelegt. Die Differenzlinie Geschlecht findet sich nicht nur im Leistungssport, sie wird in den Hobbyligen durch Modusregeln institutionalisiert – es wird sich nicht an Differenzlinien orientiert, die von den Akteuren als leistungsrelevant angesehen werden.
Dabei werden dieser Differenzlinie nur zwei mögliche Ausprägungen unterstellt. Deutlich sichtbar in den Namen der Modi: „drei-zu-drei“ und „vier- zu-zwei“. Eine Zweigeschlechtliche Norm wird propagiert. Eine konfliktfreie Inklusion von Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zuordnen, wäre dennoch in mindestens zwei Formen denkbar:
Eine mögliche Antwortstrategie könnte sein, die Narration der binären Geschlechtlichkeit aufzuheben, indem eine Regel Teams aus zwei Frauen und zwei Männern vorgibt – bei zwei Personen der Mannschaft wäre das Geschlecht egal. Der „Ausweiszwang“, den Hirschauer (1994: 215) benennt, würde jedoch für vier Personen pro Mannschaft weiter bestehen.
Eine andere Antwortstrategie würde andere Differenzierungsformen heranziehen, sodass das Geschlecht irrelevant wird. Wie weiter vorne besprochen, ist es für den Sport plausibel, dass Kategorien herangezogen werden, die ihren Ansatzpunkt am Körper haben (Müller 2006: 398). Denkbar sind für Mixed-Volleyball-Spiele Staffelungen der Leistungsklassen nach Körpergröße. Diese Kategorie zur Bildung von Leistungsklassen heran- zuziehen, würde nicht nur diskriminierende Effekte der Geschlechterkategorie ausschalten, auch kleine Menschen würden so besser in den Sport inkludiert; sie würden nicht mehr von bestimmten Sinnerfahrungen ausgeschlossen und könnten alle Positionen besetzen.
Humankategorien in der materiellen Kultur und in sozialen Interaktionen
Die Differenzierung nach Geschlecht wird bereits direkt nach Betreten des Gebäudes und vor Eintritt in die eigentliche Sporthalle durch architektonische Maßnahmen hervorgebracht. Vor, sowie nach dem Sport, wird die Umkleide aufgesucht. In manchen Fällen sind diese durch ein Schild an der Wand nach Geschlecht ausgewiesen – Frauen und Männer getrennt. Nicht in allen Hallen jedoch ist eine Markierung vorhanden, die diese Unterscheidung sichtbar macht. Für Akteure im Feld bleibt es trotzdem selbstverständlich, nur mit Personen des gleichen Geschlechts die Umkleiden und sanitären Einrichtungen zu teilen. Die Differenzierung nach Geschlecht ist damit in den Architekturen der Sporthallen als Teil der materiellen Kultur zu finden (Hirschauer/Boll 2017: 15).
Vor jedem Trainingsspiel kommt es zu dem Moment, an dem die anwesenden Spieler*innen auf die beiden Feldhälften verteilt werden. Die Spieler*innen stellen sich keineswegs zufällig auf, es wird dabei immer nach dem gleichen Muster vorgegangen: Zuerst wird gezählt, wie viele Personen verteilt werden können und wie viele davon Frauen sind. Die Frauen werden zunächst auf die Feldhälften verteilt, sodass die Anzahl auf beiden Seiten möglichst ausgeglichen ist, wobei die Spielposition berücksichtigt wird. Dann werden die weiteren Spieler nach Spielposition verteilt. Wenn alle sechs Spieler*innen eines Teams aufgestellt sind, werden die Frauen innerhalb der Teams so „sortiert“, dass sie nicht neben einander stehen (Transkript 3, Z. 87).
Die materielle Kultur erstreckt sich auch über die Formen des Bekleidens. Durch „overt signals or signs“ (Barth 1998: 14) wird sich auch als Team abgegrenzt und damit eine visuelle Differenzierung zum gegnerischen Team vorgenommen. Das Trikot macht die Mannschaft als solche erkennbar. Auch in der Sportmannschaft gilt: Wer die einheitliche Kleidung trägt, „betont die Gemeinschaft“ (Lentz 2017: 137). Gleiche Trikots für Frauen und Männer, also „unisex“-Trikots zu finden, bei denen die Geschlechterdifferenz in den Hintergrund rückt, kann sich jedoch schwierig gestalten (FTB, Z. 215-217).
Weiterhin werden auch Geschlechterdifferenzen in der Kleidung hervorgebracht; schon von weitem lassen sich Männer anhand der längeren, lockereren Sporthosen, und Frauen anhand der kürzeren, engeren Sporthosen erkennen (FTB, Z. 42 & Z. 248). Es liegt demnach ein „gendered dress[code]“ (Eicher/ Roach-Higgins 1993: 10) vor, das Geschlecht wird durch die Kleidung sichtbar gemacht.
Neben den Bekleidungsformen lassen sich „overt signals or signs“ (Barth 1998: 14) auch in der Sprache finden. In einer taktischen Auszeit hatte ein Teamkollege das Wort „Mädchenaufschläge“ fallen lassen (FTB, Z. 207-209), welches nicht etwa den Aufschlagspieler benennt, sondern vielmehr eine Bezeichnung für langsamere Aufschläge ist, wobei der Ball eine bogenförmige Flugbahn nimmt. In dem Wort finden sich zwei Kategorien, die des Alters und die des Geschlechts. Ein Mädchen ist ein weibliches Kind. Mädchen werden in der Regel nicht mit Sportlichkeit und Aggressivität assoziiert, eher das Gegenteil ist der Fall. Die beiden Kategorien verstärken sich im sportlichen Kontext gegenseitig, da sie beide mit Zuschreibungen der Schwäche belegt sind. Es zeigt eine gewisse Ironie der Bezeichnung seiner Aufschläge als „Mädchenaufschlage“, dass der Aufschlagspieler in diesem Moment ein älterer Mann war. Diese Bezeichnung soll das eigene Team stärken, indem dem Gegner Sportlichkeit abgesprochen wird.
Fazit
Mit dieser Arbeit bin ich Humandifferenzierungen im Hobbybereich des Funktionssystems Sport nachgegangen. Das Forschungsfeld stellten gemischtgeschlechtliche Volleyballmannschaften dar, die sich zum gemeinsamen Sporttreiben in der Freizeit organisieren.
Die Fragen, die mich interessierten, waren: Wie kommt die Kategorie Geschlecht beim gemischtgeschlechtlichen Sport zum Vorschein? Inwiefern wird die Geschlechterdifferenz dramatisiert? Aus der Kontingenzperspektive ergab sich im Hinblick auf Leistungsklassen außerdem die Frage: Welche anderen Kategorien werden als leistungsrelevant erachtet? Im Zentrum stand dabei die Annahme, dass die Kategorie Geschlecht auch im Mixed-Volleyball als Wettkampfstruktur und als (binäre) soziale Teilungsdimension des Sports aufrechterhalten wird, wobei andere leistungsrelevante Kategorien ausgeblendet werden.
Um die Differenzierungen in diesem Feld zu erforschen, habe ich mich für eine teilnehmende Beobachtung entschieden. Ich führte die Forschung bei verschiedenen Gruppen durch, so konnten Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden. Der Feldzugang war von der Beziehung zu Interviewpartner*innen, meiner Vereinsmitgliedschaft und der Mitgliedschaft in der Institution Universität geprägt. Die teilnehmende Beobachtung erwies sich als hilfreiche Methode, die sie mir die Praktiken der Menschen nicht nur vor Augen hielt, ich wurde selbst in sie eingebunden. Durch Beobachtungen, informelle Gespräche und themenzentrierte Interviews entstand eine Fülle von qualitativem Datenmaterial. Ein methodisches Problem war die verminderte Aufnahmefähigkeit der Forscherin bei und nach der sportlichen Betätigung. Teilnehmen und Beobachten war nicht immer möglich, deshalb entschied ich mich, zusätzlich reine Beobachtungen ohne aktive Teilnahme durchzuführen.
Um Differenzierungsformen zu erkennen und zu analysieren, wurden Theorien zur Humandifferenzierung herangezogen. Für die Forschung charakteristisch ist die Kontingenzperspektive auf Formen der Differenzierung: Erst eine Differenzierung, die in irgendeiner Weise hervorgebracht wird, schafft einen Unterschied. Jede soziale Differenzierung wird von Individuen praktiziert, um Teil einer Vollzugswirklichkeit zu sein, Individuen werden als bloße Vermittler sozialer Praxis angesehen (Hirschauer 2014: 182).
Die Forschung weist darauf hin, dass eine Sportsoziologische Ethnographie in der modernen Gesellschaft nicht losgelöst vom Funktionssystem Sport verstanden werden kann. Innerhalb des Funktionssystems gibt es viele verschiedene Sportarten, die sich durch die jeweilige Wettkampfinteraktion auszeichnen (Schulze 2005: 92). Die Wettkampforganisation bringt Wettkämpfe nach präsumtiven und funktionellen Leistungsklassen hervor (Müller 2006: 395; Schulze 2005: 92). Das Prinzip der Ergebnisoffenheit soll dabei für spannende Wettkämpfe sorgen. Konkurrenz wird erst durch den Bezug auf einen gemeinsamen Maßstab möglich. Dafür werden Menschen zunächst nach askriptiven Merkmalen kategorisiert. Im Ligabetrieb setzen präsumtive Leistungsklassen an den beiden askriptiven Merkmalen Alter und Geschlecht an. Die präsumtiven Leistungsklassen bilden die Grundlage, auf der weitere, funktionelle Leistungsklassen gebildet werden.
Die heranwachsenden Volleyballspieler und Volleyballspielerinnen werden an unterschiedliche Netzhöhen gewöhnt und werden verschiedenen Anforderungen der Anpassung ausgesetzt. Die Vorstellung, dass Männer natürlich größer sind und höher springen können, wird dramatisiert. Wettkämpfe, an denen Frauen und Männer teilnehmen, werden in der regulären Liga vermieden (vgl. Müller 2006: 408).
Das Gegenstück zum Ligabetrieb ist der sogenannte Breiten- und Freizeitsport (BFS), oft wird „Mixed“ als Synonym verwendet. Die Freizeitmannschaften haben die Möglichkeit, sich in verschiedenen Freizeitligen mit anderen Teams zu messen. Die Freizeitteams sind nicht wie im Ligabetrieb nach Geschlecht segregiert, sondern gemischtgeschlechtlich. Dafür steht das Wort „Mixed“. Es müssen jedoch nicht beide Geschlechter im Team antreten; obligatorisch ist nur die Teilnahme von Frauen, im Wettkampf übersteigt die Anzahl jedoch nur selten das geforderte Mindestmaß.
Die materielle Kultur erstreckt sich auch in die Architekturen der Sporthallen. Durch die Umkleiden und sanitären Anlagen wird eine Geschlechterdifferenz hervorgebracht – es werden gleiche Geschlechter zusammengefasst und gleichzeitig vom jeweils anderen abgegrenzt.
Differenzierungsformen kommen in sozialen Interaktionen zum Vorschein. Auch in diesen fungiert die Geschlechterkategorie als Leitdifferenz in einem Klassifikationssystem, das nach einem strikt binären Entweder-oder-Muster funktioniert. Vor Trainingsspielen werden die Frauen immer gleichmäßig auf beide Feldhälften aufgeteilt, so dass sie nicht neben einander stehen, damit der tendenziell größere Mann den Block stellen kann.
Soziale Interaktionen beinhalten auch Kommunikationsformen, die durch „overt signals or signs“ (Barth 1998: 14) zum Vorschein kommen. Zum einen war dies in der Sprache zu erkennen: In dem Wort „Mädchenaufschläge“ stecken die beiden Kategorien des Alters und des Geschlechts. Die jeweiligen Ausprägungen sind mit Zuschreibungen besetzt, die nicht als sportlich gelten.
Zum anderen ist dies in der Kleidung sichtbar: Die Mitgliedschaft zur Kategorie Geschlecht wird in der Kleidung durch den „gendered dress[code]“ (Eicher/ Roach-Higgins 1993: 10) deutlich. Die Kleidung drückt bei Wettkämpfen außerdem eine Abgrenzung zum Gegner aus: Das Tragen von einheitlichen Trikots aller Spieler*innen eines Teams „betont die Gemeinschaft“ (vgl. Lentz 2017: 137).
Durch meine Forschung wurde deutlich, dass die binär gedachte Kategorie Geschlecht den Sport auch im Hobbybereich, in dem die Geschlechter nicht segregiert werden, durchdringt. Diese Kategorie tritt in offiziellen Regeln, in der materiellen Kultur und in sozialen Interaktionen hervor. Die Spielpositionen werden jedoch von Geschlechterrollen beeinflusst – die Körpergröße entscheidet jedoch letztlich über die Möglichkeiten des Individuums.
Durch die Forschung wurde deutlich, dass eine geringe Körpergröße ein Ausschluss aus dem Ligabetrieb bedeutet. Deshalb wurden zwei Vorschläge zu alternativen Leistungsklassen formuliert, die darauf abzielen, einerseits der Diskriminierung von Personen des dritten Geschlechts entgegenzuwirken, andererseits kleinen Personen eine bessere Inklusion in den Sport zu ermöglichen.
Literaturverzeichnis
Amann, K. & Hirschauer, S. (1997): Die Befremdung der eigenen Kultur. Ein Programm. In: Klaus Amann, Stefan Hirschauer (Hrsg.): Die Befremdung der eigenen Kultur. Zur ethnographischen Herausforderung soziologischer Empirie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Barth, F. (1998). Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Waveland Press.
Bette, K. H. (2014): Sportsoziologie. In: Karl Heinz Bette: Sportsoziologische Aufklärung: Studien zum Sport der modernen Gesellschaft. Bielefeld: Transcript Verlag.
Eicher, J. B. & Roach-Higgins, M. E.: (1993). Definition and Classification of Dress: Implications for Analysis of gender roles. In: Ruth Barnes, & Joanne B. Eicher (Hrsg.): Dress and gender: Making and meaning. Berg Publishers.
Fischer, H. (1998): Feldforschung. In: Bettina Beer, & Hans Fischer (Hrsg.): Ethnologie. Einführung und Überblick. Berlin: Reimer.
Heckemeyer, K. (2017): Geschlechterdifferenzen im Sport. Leistungsklassen, selektive Geschlechtertests und die Reproduktion weiblicher Unterlegenheit. In: Marion Müller, Chistian Steuerwald (Hrsg.): >Gender<, >Race< und >Disability< im Sport. Von Muhammad Ali über Oscar Pistorius bis Caster Semenya. Bielefeld, transcript Verlag.
Heintz, B. (2017): Kategoriale Ungleichheit und die Anerkennung von Differenz. In: Stefan Hirschauer (Hrsg.): Un/doing Differences. Praktiken der Humandifferenzierung. Weilerswist, Velbrück.
Hirschauer, S. (1994): Die soziale Fortpflanzung der Zwei-Geschlechtlichkeit. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 46 (4), S. 668-692.
Hirschauer, S. (2014): Un/doing Differences. Die Kontingenz sozialer Zugehörigkeiten. Zeitschrift für Soziologie, 43 (3), S. 170-191.
Kalthoff, H. (2017): Kontingenz und Unterwerfung. Die organisierte Humanevaluation der Schule. In: Stefan Hirschauer (Hrsg.): Un/doing Differences. Praktiken der Humandifferenzierung. Weilerswist, Velbrück.
Lentz, C. (2017): Die Aufführung der Nation und die Einhegung von Ethnizität in afrikanischen Nationalfeiern. In: Stefan Hirschauer (Hrsg.): Un/doing Differences. Praktiken der Humandifferenzierung. Weilerswist, Velbrück.
Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Mead, Margaret (1981): Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaften: Kindheit und Jugend in Neuguinea. München, dtv, 1981.
Messner, M. A. (2010). Out of play: Critical essays on gender and sport. Suny Press.
Meyer, C., & zu Verl, C. M. (2019). Ergebnispräsentation in der qualitativen Forschung. In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden, Springer.
Müller, Marion (2006). Geschlecht als Leistungsklasse. Der kleine Unterschied und seine großen Folgen am Beispiel der „gender verifications“ im Leistungssport. Zeitschrift für Soziologie 35 (5), S.392-412.
Müller, M., & Steuerwald, C. (Hrsg.) (2017). Gender, race und disability: Einführende Überlegungen zur Bedeutung sozialer Zugehörigkeiten im Sport und in der (Sport-) Soziologie. In: Marion Müller, Chistian Steuerwald (Hrsg.): >Gender<, >Race< und >Disability< im Sport. Von Muhammad Ali über Oscar Pistorius bis Caster Semenya. Bielefeld, transcript Verlag.
Nassehi, A. (2017): Humandifferenzierung und gesellschaftliche Differenzierung. Eine Verhältnisbestimmung. In: Stefan Hirschauer (Hrsg.): Un/doing Differences. Praktiken der Humandifferenzierung. Weilerswist, Velbrück.
Pellow, D. (Hrsg.) (1996): Setting boundaries. The Anthropology of Spatial and social Organization. Westport, Bergin&Garvey.
Richthammer, E. 2017: Spielräume für Geschlechterfragen. Re-und Dekonstruktion der Kategorie Geschlecht in kunstpädagogischen Kontexten. Wiesbaden. Springer Fachmedien.
Schlehe, J. (2008): Formen qualitativer ethnographischer Interviews. In: Bettina Beer: Methoden ethnologischer Feldforschung. Berlin, Reimer.
Schulz, A. (1987): Volleyballregeln leicht verständlich. München, BLV. Schulze, B. (2005): Sportarten als soziale Systeme. Ansätze einer Systemtheorie der Sportarten am Beispiel des Fußballs. Münster, Waxmann.
Sullivan, C. F. (2011): »Gender Verification and Gender Policies in Elite Sport: Eligibility and ›Fair Play‹«, in: Journal of Sport & Social Issues, 35 (4), S. 400–419.
Voß, H. J. (2010). Making sex revisited. Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive. Bielefeld, transcript Verlag.
Anhang
Transkript 1: Rike und Leonie 3
Es ist der 26. Februar, beim Training einer Mixedgruppe in Ameisenberg. Die Uhrzeit ist 20:30. Wir gehen wegen der Geräuschkulisse in die Damenumkleide. Dauer der Aufnahme: 16 Minuten.
1 DH: „Spielt ihr schon immer Mixed-Volleyball?“
2 [ZustimmendeLaute von beiden Teilnehmenden]
3 LEONIE: „Eigentlich ausschließlich …. Nur in der Damenmannschaft hab´ ich
4 angefangen. Das waren so meine ersten Spielerfahrungen die ich gesammelt
5 hab, beim reinen Damenvolleyball.“
6 DH: (zu RIKE) „und du hast kein reines Damenvolleyball gespielt, immer Mixed
7 Volleyball?“
8 RIKE: „Ja.“
9 DH: „Seit wann?“
10 RIKE: „Hmmm ... das war glaub ich 2017, Oktober … Oktober.“
11 DH: „Noch gar nicht so lang… ähm ... Was gefällt euch am Mixed Volleyball?
12 Also – (zu LEONIE gewandt) du kannst da ja auch bisschen Vergleich ziehen,
13 zu den Damen …?“
14 LEONIE: „Also mein größter – Vorteil – eigentlich am Mixed war, dass – ich
15 irgendwann gar nicht mehr so die Lust hatte, in der Liga mitzuspielen. Weil ich
16 das für mich als Freizeitausgleich mehr gesucht habe und da war so ´ne Mixed-
17 mannschaft, die ab und zu mal auf Hobbyturniere fährt - für mich angenehmer
18 … um auch das beruflich zu vereinbaren – anstelle von so ´nem … Zwang …
19 regelmäßig an Spielen teilzunehmen.“
20 DH: „und dir, was gefällt dir am Mixed Volleyball?“
21 RIKE: „Also mir gefällt das, dass also ... dass es so hmm ... gleichgerecht ist,
22 also es gibt Männer und Frauen. Nicht so wie zum Beispiel: Damenmannschaft
23 gibt’s nur halt Damen. Ich find´s auch so schön ähm zum Beispiel halt es gibt
24 Frauen, die halt nicht so Kraft in den Armen haben und wenn wir halt ähm …
25 wenn wir draufschlagen, haben die Männer – können wir Punkte machen ... Ich
26 find´s hier halt angenehm, weil die Leute nett sind.“
27 LEONIE: „Das ist halt sehr ausgeglichen man kann halt besser ähm – sich
28 gegenseitig unterstützen. Man ist nicht ... ein Einzelkämpfer letztendlich, weil
29 jeder hat seine Stärken im Team und da ist es halt – grad der unterschied
30 Männer/Frauen fällt dann nicht so auf weil vielleicht ´ne Frau ´nen kürzeren Ball
31 schneller kriegt, dafür dann der Mann vielleicht besser schlägt.“
32 RIKE: „Ja.“
33 LEONIE: ja (lacht).
34 DH: „Ihr spielt ja auch manchmal Turniere. Da gibt’s ja auch nen Modus
35 vorgeschrieben – da wird dann am Anfang gesagt wir spielen heute drei-drei
36 oder mindestens zwei Frauen – welcher Modus ist bei euch üblich?“
37 LEONIE: „Also bis jetzt bei den letzten Turnieren waren es immer zwei Frauen,
38 als Vorgabe. Aber das ist für uns in der Mannschaft immer schwierig, genug
39 Frauen zu stellen.“
40 DH: „Weil ihr zu wenig Frauen seid?“
41 LEONIE: „Oft ja.“
42 DH: „Habt ihr oft ein Frauen-Problem?“ (lachen)
43 LEONIE: „Na, wenn das nicht Gender-konform ist!“ (lacht)
44 DH: „Wie fühlt sich der Modus an – glaubt ihr es ist egal ob man drei oder zwei
45 Frauen auf dem Feld stehen hat?“
46 RIKE: „Ja …. mir ist es relativ egal wie viele Frauen auf dem Feld stehen, es
47 wird eigentlich sowieso immer ausgeglichen – sie (Leonie) hat ja gesagt jeder
48 hat seine Stärke. Deswegen ist es mir relativ egal.“
49 LEONIE: „Für mich persönlich ist es auch egal – allerdings, wenn‘s jetzt
50 tatsächlich um ein Turnier geht und man `nen Erfolg in dem Turnier erzielen
51 will dann ist es natürlich … besser, wenn man ähnlich aufgestellt ist wie die
52 Mannschaft gegenüber. Weil - wenn die natürlich mit vier Männern spielen, wir
53 aber mit vier Frauen, ist es klar einfach ne Kraftsache. Die dann auch irgendwo
54 fehlt. Um da den Sieg zu bekommen. Weils ja nur Hobby ist was gespielt wird
55 es istja nicht so – Techniktraining oder sowas. Das fehlt ja den meisten.“
56 [RIKE: „ja.“]
57 DH: „Okay …. Die Turniere habt ihr auch am Wochenende?“
58 LEONIE: „Ja.“
59 DH: „Versetzt euch in eine Spielsituation. Ihr steht einem Team gegenüber und
60 ihr seid schon 5 Punkte im Rückstand. Was tust du in deiner Position, um ...
61 ähm … um das Spiel noch zu drehen?“
62 LEONIE: „Letzt endlich einfach weiterkämpfen. also. Es ist halt - Wir sind halt
63 nicht zwangsläufig eine Mannschaft, die unbedingt auf Sieg aus ist. Von daher
64 ist dieser Druck so ‘n bisschen … genommen. Es ist natürlich auch immer
65 schön – freuen wir uns auch – wenn, aber... solche Erfolge verzeichnen wir
66 nicht so oft.“
67 RIKE: „Also bei mir ist es so ich will auch mal gewinnen. Aber ich sag immer
68 zu mir: Hauptsache ich hab‘ Spaß und das ist das Größte, was man gewinnen
69 kann.“
70 LEONIE: „Hat sie wohl Recht.“
71 DH: „Sehr gut. (Pause) … Noch mal zu dieser Mindestfrauenregel. Ähm –
72 wenn‘s diese Regel nicht gäbe, wie würdet ihr das Team aufstellen? Wenn es
73 egal wäre, wie viele Frauen oder Männer auf dem Feld stehen.“
74 LEONIE: „Ich würde sagen das kommt auf … auf das Ziel an, was man verfolgt.
75 Also- wenn wir jetzt sagen würden, wir stellen unsere beste Mannschaft auf,
76 damit wir mit aller Gewalt gewinnen – naja selbst dann würd‘ ich sagen, wir
77 wären trotzdem ein gemischtes Team. Ja. Doch. (Pause) Also, wenn wir zu
78 `nem Turnier fahren, spielt eigentlich auch jeder. Weil wir halt auf den Erfolg
79 nicht unbedingt aus sind, sagen wir es soll halt mal jeder Spielzeit bekommen
80 und auch Spaß dran haben und wir wechseln da eigentlich auch …. Nahezu
81 jeden Satz durch. (Pause). Weil alle die mitgefahren sind, sich den Aufwand
82 gemacht haben, wollen da halt auch – mitspielen. Um nicht umsonst da zu
83 sein.“
84 DH: „Fair.“
85 LEONIE: „Fair! So sind se!“ (schmunzeln)
86 (pause)
87 DH: „Mir ist beim Volleyball aufgefallen - Zuspieler sind oft die kleinsten Leute.
88 Aber – so wirklich für Frauen und Männer gibt es keine spezifischen Positionen
89 – oder, was denkt ihr?“
90 LEONIE: „Naja vielleicht eher persönlich – äh – eine favorisierte – Position. Ich
91 glaub, häufig ist das relativ … Geschlechtsunabhängig. Also … Ich kann nicht
92 gut stellen und ich bin klein. Ich konnt‘s auch nie gut (lacht). Aber ich hab´
93 mittlerweile den Angriff für mich entdeckt, was auch eigentlich nicht zu meiner
94 Größe passt. Von daher.“
95 DH: „Auch nicht nur die Zuspieler, auch Liberos, Liberas sind ja auch oft…“
96 LEONIE: „Frauen.“
97 DH. „… oft die kleinen Leute. Könnte deswegen auch eine Frauenposition
98 sein?“
99 LEONIE: „Das find ich so schön, dass [unverständlich] Frauen Positionen
100 [unverständlich]wenn man´s so nennen möchte.“
101 DH: „Beim Mixed Volleyball kann man die Libera ja mit einem Mann wechseln,
102 sodass er vorne ist, deswegen könnte es eine Frauenposition sein?“
103 LEONIE: (zögerlich) „Mmh- jaaa – wobei wir eigentlich nicht mit Libero spielen.
104 Oder mit Spielerwechseln. Oder Positionswechseln spielen. Oder mit Trainer.“
105 DH: „Ob die Körpergröße über die Position entscheidet ist eher mit nein zu
106 beantworten? Weil es eher um persönlich präferierte Positionen geht?“
107 (allgemeines „joar“)
108 DH: „Spielen Frauen und Männer auf unterschiedliche Art Volleyball?“
109 (RIKE nickt, LEONIE schaut nachdenklich)
110 LEONIE: (Zu RIKE) „Ja?“
111 RIKE: (zustimmendes „Mmh“)
112 LEONIE: „Inwiefern? Ich hab´ grad nicht so `ne Idee.“
113 DH: „Woran würdest du das festmachen?“
114 RIKE: „Es gibt Männer – in unserer Mannschaft gibt es Männer die viel stärker
115 sind – als zum Beispiel ich, ich bin halt eine der schwächsten weil … ich hab
116 auch oft gefehlt aber … es gibt sie (deutet auf LEONIE), äh es gibt sie und es
117 gibt noch eine in der anderen Mannschaft – die haben halt ähm - deren Kräfte
118 und – man merkt halt den Unterschied zwischen Mann und Frau. Also meiner
119 Meinung nach. Dass die Männer - Ich denke, dass die Männer (unterdrückt ein
120 nießen) dass die Männer halt die Kraft haben in der Hand. Also - Okay es gibt
121 auch Frauen die Kraft haben aber meiner Meinung nach sind immer halt
122 Männer die – (aus der Halle hört man Jubeln) – zuschlagen können.“
123 „Okay … die älteren Männer dort 123 drüben habe ich kaum am Angriff
124 gesehen.“
125 RIKE: „Es kommt auch immer auf das Alter an. Ob man jung ist – oder ja, alt.
126 Zum Beispiel – ähm in unserer Mannschaft wo ich gespielt hab da gibt’s einen
127 Mann, der kann nicht schnell rennen. Im Gegensatz zu ihm kann ich schnell
128 rennen. Dafür kann er bessere Aufschläge machen.“
129 DH: „Schaut ihr euch gerne Bundesligaspiele an?“
130 RIKE: „Nein.“
131 LEONIE: „Ja, letzte Woche erst.“
132 DH: „Bei was?“
133 LEONIE: „United Volleys gegen Ludwigshafen. In Frankfurt. Männer.
134 Bundesliga. Vor ein paar Wochen war ein Champions League Spiel, da war die
135 Mannschaft auch. Zumindest ich glaub - (zu RIKE gewandt) da warst du mit?“
136 RIKE: „Nein ich war nicht dabei.“
137 LEONIE: „Naja das ist … Das ist nicht zu vergleichen mit unserer Spielklasse.“
138 DH: „Hast du auch ein Frauenvolleyball Bundesligaspiel im letzten Jahr
139 angeschaut?“
140 LEONIE: „ja. (lächelt) VCW. Und – wahrscheinlich nächste Woche wieder.“
141 DH: „Und beim Mixed-Volleyball – mal zuschauen?“
142 LEONIE: „Ne - will ich ja selber spielen - (pause) - ich hab´ eigentlich keine
143 Ahnung ob es da eine Liga gibt.“ (Pause)
144 DH: „Also – (zu LEONIE) dir ist es vor allem wichtig, ähm – dass du – dass du
145 die Zeiten an den Wochenenden nicht verplant hast – also du bist flexibler in
146 deiner Zeit. Deswegen bist du hier beim Freizeitsport in einer Mixed
147 Mannschaft?“
148 LEONIE: „Genau, also das hat 148 klar auch verschiedene Gründe - ähm weil Liga
149 Mannschaft – in der reinen Damenmannschaft war man ja schon jedes
150 Wochenende irgendwie beschäftigt und das konnte ich irgendwann mit meinen
151 persönlichen Abwesenheitszeiten nicht vereinbaren weil ich … oftmals ... bei
152 meinen Eltern bin oder … verreist oder sonstige Wochenendpläne habe und
153 da muss man ja auch der Mannschaft nicht im Weg stehen, das ist dann nicht
154 so einfach. Außerdem bin ich alt.“ (lacht)
155 DH: (Zu RIKE) „Du bist ja noch jünger, wieso spielst du Mixed?“
156 RIKE: „Mmh ... also ich hab‘ früher Fußball gespielt. Und danach wollt ich´s
157 nicht mehr machen … dann gabs ´ne alte Mitspielerin, die hat mich eingeladen,
158 dass ich mitspiele und ja …. Ich mag einfach die Leute hier und jetzt wäre es
159 für mich schwer, wenn ich auf einmal aufhören würde, würde ich einfach die
160 Leute hier vermissen und … den Spaß. Deswegen hab´ ich mich entschieden,
161 hier zu bleiben und auf Fußball zu verzichten.“
162 DH: „Beim Fußball, war das eine reine Mädels-Mannschaft?“
163 RIKE: „Nein, auch Mixed.“
164 LEONIE: „Das gibt’s?“
165 RIKE: „Ja, das gibt’s. Also ich hab´ mit meiner Schwester gespielt, hier in dem
166 Viertel sogar – die Mannschaft gibt es aber nicht mehr.“ (Pause)
167 DH: „Tragt ihr bei Spielen die gleiche Kleidung wie jetzt im Training? Enge
168 Hosen kann ich mal festhalten, und T-Shirt ...“
169 LEONIE: „joar.“
170 RIKE: „joar.“
171 DH: (Zu RIKE) „trägst du immer eine lange Hose?“
172 RIKE: „Ja, für mich ist es halt unangenehm in kurzen Hosen Sport zu machen.
173 Für mich ist das halt angenehmer ... Ich spiel auch in der Schule Volleyball und
174 da gibt’s nur Mädchen, und da hab` ich 174 auch eine lange Hose an. Ich mag das
175 so … ist Gewöhnungssache.“
176 DH: „Danke für das Gespräch!“
Transkript 2: Jens und Max
Transkript des zweiten Interviews am 26.02.2019 während des Trainings der Mannschaft Ameisenberg. Teilnehmende sind die beiden Männer Jens und Max (Max ist Gastspieler) Wir sitzen, um ruhig reden zu können, in der Männerumkleide (Teil 1). Es ist wärmer als in der Damenumkleide. Während des Gesprächs kommt jemand herein, deshalb wechseln wir den Ort und gehen in die Damenumkleide. (Ab dort beginnt Teil 2 der Aufnahme). Dauer des Gesprächs: 8:35 (1.Teil) und 17:45 Minuten (zweiter Teil). insgesamt 26:20 Minuten.
1 DH: „Spielt ihr schon immer Mixed Volleyball?“
2 MAX: „Ichhab´ immer Mixed Volleyball gespielt.“
3 JENS: „Ja ich auch. Also ich hab´ drei Vereine durch und äh – hab nur Mix
4 gespielt – beziehungsweise Gast … Gasttrainierender bei euch damals. Aber
5 an sich … nur Mixed.“
6 DH: „OK. Wieso spielt ihr hier in der Mixed Mannschaft? Beziehungsweise –
7 (Zu MAX gewandt) Wieso spielst du Mixed?“
8 MAX: „Naja äh … Grund natürlich ist, dass dort, wo ich wohne, äh, das, da war
9 halt ´ne Mixmannschaft und dann hat man mal da mitgespielt … das wars dann
10 und, ähm - ich bin auch nicht einer der unbedingt jetzt in … Liga spielen muss
11 und auf die Punkte achtet, also - Hauptsache - man hat Spaß - “
12 JENS: „Ja das seh´ ich ähnlich“ -
13 MAX: „- und das ist jetzt ob das jetzt nur Männer sind oder nur - oder gemixt –
14 wobei ich denke, beim Mixed ist es ähm - bisschen einfacher, bei nur Männern
15 dann kommt da kommt relativ schnell da vielleicht so ein Element rein … so …
16 wir wollen jetzt mal zeigen, dass wir´s können oder so ähnlich.“
17 JENS: (zustimmende Laute) „Ähm ich glaub´ – also ich bin zum einen aus der
18 Schule – mein Sportlehrer ist hier Vereinsmitglied bzw. Vorstand der hat halt
19 irgendwann gesacht´: komm mal mit - und seitdem spiel ich hier, und das war
20 halt auch ´ne Mixed Mannschaft … und, ähm ich seh´ das wie du - ähm mir ist
21 der Druck – also ich hab kein´ Bock auf übermäßig Druck in ´ner
22 Herrenmannschaft. Weil in den meisten Herrenmannschaften wie ich das
23 bisher gesehen hab´, war´s einfach so dass da, dass da nur Leistung gezählt
24 hat ... und die Komponente Spaß ähm – runtergefallen ist einfach ja. Und das
25 ist der Punkt wieso ich mich ähm - bisher nur für Mixmannschaften entschieden
26 hab.“
27 DH: „Ich hab´ vorhin gehört, wenn ihr Turniere spielt, ist der Turniermodus ist
28 bei euch vier Männer, zwei Frauen.“ (Pause)
29 JENS: „Joar.“
30 MAX: „Also das ist vorgegeben, dass mindestens zwei Frauen in einer
31 Mannschaft sein müssen, damit es nicht so dominant ist, wenn - also nur
32 Männermannschaften gibt. Aber es dürfen auch durchaus drei Frauen, oder
33 sogar vier mal zwei das äh ist gar keine Regel. Mindestens zwei – das war`s.“
34 JENS: „Bei den Mixed Turnieren wo wir zusammen waren, war ja mindestens
35 zwei Frauen beziehungsweise bei uns warn´s dann zwei Männer, weil wir ja
36 mit Klarenthal nach - ähm – das Freiluftturnier – ähm (denkt nach) -
37 Mensfelden! Aber ich hab´ auch schon auf ´nem Turnier mit drei Frauen und
38 drei Männern gespielt. Also (pause)“
39 DH: „Und ist es im Spiel anders? Wenn drei Frauen auf dem Feld stehen oder
40 wenn nur 2 Frauen auf´m Feld stehen?“
41 MAX: „Meistens hängt es von der individuellen Qualität ab, es gibt auch bei uns
42 Männer, die auch schwach spielen - sagen wir´s mal so und ... es gibt Männer,
43 die sind stark - und genauso ist es bei den Frauen. Je nachdem, wer jetzt da
44 ist wer sich angemeldet hat hast du den Einen oder den Anderen ... da … gibt’s
45 … kaum ein Unterschied zwischen …“
46 JENS: „Ja es ist das Gesamtniveau entscheidend. Da – da hast du Recht,
47 wenn die Frauen gut spielen, dann gibt es wahrscheinlich auch Männer die
48 schlechter spielen. Und auch umgekehrt. Ich persönlich hab´ festgestellt, dass
49 man mit zwei Frauen, vier Männern spielt, oftmals ´n bisschen mehr Druck im
50 Angriff ist. (man hört Jubeln aus der Halle) Also ähm weil Frauen tendenziell
51 einfach nicht ... den ... nicht so übermäßig gut angreifen – was jetzt nicht böse
52 gemeint ist, also aber es ist halt einfach Fakt. man – klar, generell die Liga –
53 is´n bisschen was Anderes – aber in der Hobby runde … sind meistens Frauen
54 im Spielerischen ´n bisschen schwächer.“
55 MAX: „Hat was zu tun auch mit der Größe zum Teil, dass die am Netz einfach
56 nicht so hoch kommen.“
57 JENS: (zustimmend) „genau“
58 DH: „Beim Mixed Volleyball ist ja Netz ja auch höher als bei den Frauen auf
59 Leistung.“
60 JENS: „Genau“
61 DH: „… aber niedriger als bei den Männermannschaften“
62 JENS: „Ja genau, zwei-achtunddreißig ist es Mixed, zwei-vierundzwanzig
63 Frauen und zwei-zweiundvierzig Männer. Quasi - man trifft sich in der Mitte.
64 Von daher sind Frauen oftmals durch die Körpergröße - bisschen benachteiligt.
65 (Pause) Was natürlich auch spielerisch ausgleichbar ist, ganz klar.“
66 MAX: „Wobei ich denke grad, bei Hobby-mannschaften bleiben ja die ganz
67 großen Leute raus – also ich bin ja auch kein Großer, das spielt mit eine Rolle,
68 dass man sagt: Okay ich kann ja nicht auf Topniveau spielen, von der Länge
69 her, dann passt das mit´m Mixed und äh… deswegen ähm, ist das so.“
70 JENS: „Wobei wir Kleinen, glaub ich, ganz gute Chancen haben – also ich zähl
71 mich jetzt einfach mal zu den Kleinen – bei den Herren bin ich wirklich
72 wahrscheinlich der Zwerg – da sin´ wir vielleicht gute Liberos oder so. Gute
73 Annahmespieler, dafürsind wir wahrscheinlich grottenschlecht am Netz.“
74 DH: „Und Zuspieler?“
75 JENS: „Ja gut, Zuspieler trau ich mir auch noch zu.“
76 DH: „Naja. Ähm …. Wenn es – äh – nicht die Regel gäbe, dass mindestens
77 zwei Frauen auf dem Feld stehen sollen. Wie würdet ihr das Team aufstellen?“
78 JENS: „Bezogen auf Turniere?“ (DH: „Ja.“) „Okay ... das ist schwierig ... da
79 kommt es für mich drauf an … will ich gewinnen - oder will ich Spaß haben und
80 ´nen guten Platz erzielen, oder will ich nur Spaß haben. Wenn ich nur Spaß
81 haben will, dann drei – drei; vier Frauen - zwei Männer is´ cool ... ich glaube …
82 Für mich der Faktor wäre zwei bis drei… auf jeden Fall. Weil´s einfach als
83 Mixed-Turnier fair ist, auch ´ne Frau aufzustellen. Wenn das als Mix Turnier
84 gilt. Also …“
85 MAX: „Ich wüsste gar nicht, wie man´s anders regeln könnte, bei ´nem Turnier
86 also … ob man da sagen kann: ,Okay wir machen ein Turnier okay da kann
87 auch eine reine Männermannschaft mitspielen´ - ich denke, dann verlieren die
88 andern sehr schnell das Interesse dann…. Brauchst du das Turnier eigentlich
89 nicht für Mixed-mannschaften zu machen.“
90 JENS: „Richtig … Stimmt, weil ... dann melden sich nur Mannschaften an – ‚äh
91 wir kommen übrigens mit sechs Männern´. Und das ist dann bei zwanzig
92 Mannschaften oder bei sechzehn Mannschaften wird das ähnlich sein und
93 dann hast du - vielleicht zwei oder drei die sagen: Wir gehen da als Mixed-
94 Mannschaftauch hin.“
95 MAX: „Ein bisschen Ehrgeiz hat man ja immer… das hat man gesehen wir
96 waren ja auch in Ingelheim und da war zweimal hintereinander ´ne sehr junge
97 Mannschaft äh – fast Schüler oder Studenten. Und auch die Frauen haben sehr
98 gut gespielt und die haben die meisten Teams einfach überflügelt also und ….
99 Das war da manchmal bisschen schwierig weil die haben´s dann auch so
100 richtig - ümm - ernst genommen so wooo (plustert sich auf) hrrmm -- aber gut,
101 gehört einfach dazu und sollen die auch 101 gewinnen … des´ is´ - letztendlich –
102 man hat doch seinen Spaß – und - kann man drüber stehen. Das find ich –
103 genauso wie im Verkehr – wenn einer ´nen Fehler macht oder so - einer meint
104 er muss rasen, dann rast er vorbei und – tschüss“
105 JENS: (lacht) „lass ihn doch!“
106 DH: „Letztendlich hat die Mannschaft gewonnen, weil sie die Jüngsten waren?“
107 MAX: „Das spielt ´ne Rolle natürlich, da kann man sich noch überlegen, ob man
108 noch ´nen Alters – ähmm ... Grenze – (Jemand kommt herein) Aah! Wir –
109 Jemand: „Sagt ihr auch das Richtige?“
110 MAX: „Wollen wir uns bei den Damen hinsetzen?“
111 DH: „Wir setzen uns eben rüber.“
112 MAX: „Der muss ja auch nicht hören was wir alles sagen!“ (lacht)
113 (Ende Teil 1 der Aufnahme)
114 (Teil 2)
115 (JENS bemerkt dass er am Knie blutet)
116 DH: „Wieso trägst du denn keine Knieschoner?“
117 J: „Weil ich die -eigentlich – nicht brauch´. Weil ich eigentlich immer schnell
118 genug bin. Aber - eben mal nicht (lacht) und sie behindern mich. Find ich.“
119 MAX: „Das war nur das nervöse Kratzen“ (lacht)
120 JENS: (zu M) „Aus Angst vor deinen Aufschlägen!“ (lacht)
121 (pause)
122 DH: „Machen wir mal weiter …. Spielen Männer und Frauen auf
123 unterschiedlicheArt und Weise Volleyball?“
124 JENS: „Ja. Kurz und knapp ja.“
125 MAX: „Wahrscheinlich ja hmm … joar 125 - ich weiß nicht ich überleg mir gerade
126 hm – wenn ich den Fernseher anschalte da finde ich, da ähnelt sich das
127 Männer- und Frauenvolleyball, da ähnelt sich ja sehr, mit der Technik und so
128 also, klar, es ist immer so, dass die Männer mit ihrer Muskelmasse, die sie
129 mehr haben, auch härter schlagen können. Vielleicht noch etwas schneller
130 sind, aber ich vermute einfach, dass auf diesem Niveau wo die Topspieler sind,
131 da sind alle so trainiert da sieht man kaum … Unterschied. Und hier sind die
132 so, denke ich, dass ´ne Anzahl etwas ängstlicher sind, es gibt ängstliche
133 Männer, aber Frauen im Schnitt einfach – wenn der Ball daher kommt…“
134 JENS: „Okay, also wenn man´s auf dem Topniveau sieht also Bundesliga, oder
135 Champions League oder so was, da geb´ ich dir Recht, aber auch da finde ich,
136 gibt’s Nuancen, die … die Technik … von Männern und Frauen einfach
137 unterscheiden. Ähm ich hab´ festgestellt, dass Frauen oftmals n bisschen …
138 weicher spielen, bisschen kontrollierter, und bei Männern hat man öfter diesen
139 Faktor: ,okay, ich hab jetzt Muskeln im Arm, dann nutz ich die halt.´“
140 MAX: „hau drauf!“
141 JENS: „genau und das … kommt bei Frauen nicht so häufig vor, aber ich geb´
142 dir Recht, ähm im Hobby-Mixed mit wenig Erfahrung und wenig Training, haben
143 einige Frauen oftmals bisschen ... ähm ... oder sind öfters ein bisschen
144 ängstlicher. Wenn dann ein fester Ball mal kommt. Oder, einfach mal den Ball
145 für sich fordern. Hat man eben auch ganz gut gesehen - da stand Natalia auf
146 der vier und hinten auf der fünf stand auch jemand (zu M: ich glaub von euch
147 jemand, ich weiß nicht) und – er ist von hinten ihr in den Ball reingesprungen,
148 da ist sie ein bisschen ängstlich zu sagen: ey - meiner. Und sie stand perfekt.
149 Nur ´n halben Schritt nach rechts machen müssen und sie hätte den Ball auf
150 die Arme gefallen bekommen - und er hat sie quasi weggedrückt, um den Ball
151 wegzunehmen also, ja ängstlich, aber - kommt auf die Spielklasse drauf an,
152 definitiv ja. Weil ich mein – diese Ängstlichkeit hast du in der Bundesliga nicht.
153 Da hacken die einfach ran. Ob Männer oder Frauen ist dann in dem Fall egal.“
154 MAX: „und es kann auch sein, dass vielleicht … 154 äh, hin und wieder doch – ich
155 rechne mich selber dazu – etwas mehr äh – Ehrgeiz und sagen: den Ball den
156 hab´ ich noch. Und ich vermute mal, sie springt grad mal nicht am Netz und
157 dann stör´ ich. Unter Umständen verhau ich den Ball sogar, aber dann ist es
158 eigentlich, mein Fehler, ich hätt´ sie einfach machen lassen müssen. Da hätt´
159 ich nicht … nicht – übergriffig werden ... sollen. Es passiert schon, dass ich
160 denke: den hab´ ich!“
161 DH: „Versetzt euch mal in eine Spielsituation – die gegnerische Mannschaft
162 führt schon fünf Punkte. Und – ihr beide in eurer Position, was macht ihr – wie
163 könnt ihr das Spiel noch drehen?“
164 JENS: „Boah – (pause) - weil Volleyball ein Teamsport ist, ist es halt schwierig,
165 ich kann alleine nicht das Spiel drehen … Was ich versuche ist, mein Team
166 anzufeuern, jeden einzelnen, um bisschen Ehrgeiz zu entwickeln, um zu sagen
167 der nächste Ball ist uns, den ham´ wir - und dann geht die Aufholjagd los. Als
168 Einzelner kann ich nur versuchen, mein Bestes zugeben, möglichst sauber
169 zum Zuspieler zu spielen -ähm - und dann hoffen, dass der Rest der
170 Mannschaft mitzieht und den Punkt holt.“
171 Mannschaft mitzieht und den Punkt holt.“
172 den Ball nicht richtig bekommen hat – auf ´ne Annahme – dass ich dann ein
173 bisschen näher auf diese Position zu geh, und zu schauen ob ich vielleicht …
174 diese Person entlasten kann, indem ich das übernehme und versuche - das
175 besser zu machen, aber dann … dann ist wieder dieser Gedanke ich kanns
176 besser - dabei. Aber ob das jetzt letztendlich ausschlaggebend ist – danach
177 dreht sich das Team ja weiter. Die Person spielt ja auch weiter mit insofern…
178 ist das nur ´ne kurze Einzelaktion.“
179 DH: „Spielt ihr bewusst in einer Hobbymannschaft, weil es euch um den
180 Spielspaß geht?“
181 MAX: „Es ist auch der Ehrgeiz, den ich nicht habe. Bei Männermannschaften
182 sortiert sich das auch relativ schnell nach Größe. Das ist – letztendlich – auch
183 natürliche Selektion, dass jetzt kleine – äh – Männer … runter gehen und
184 spielen jetzt in einer Mixed-Mannschaft. Weil 184 bei dieser Sportart hab´ ich eher
185 Chancen, mich einzubringen. Liga, das bringt mir auch nicht so viel, weil, ich
186 bin der Schwachpunkt da. Das will man ja auch nicht sein.“
187 JENS: „Es gibt einen Unterschied zwischen groß – große Männer sind oft in
188 der Annahme grottenschlecht, weil die nicht mit dem Arsch runterkommen, ihre
189 Knochen nicht auf den Boden bewegen, weil sie einfach zu langsam sind. Da
190 hat der kleine Mann einfach ein bisschen Vorteil. Aber generell geb´ ich dir
191 Recht, in Herrenmannschaften wird oft selektiert: Du bist groß – eins-neunzig
192 plus, oder was, oder eins-fünfundachtzig … und alles drunter kommt meist bei
193 zwei, zweiundvierzig Netzhöhe nicht gut mit.“
194 MAX: „Man sieht von sich aus, das bringt mir nicht so viel Spaß, da will ich
195 meine Zeit nicht für opfern.“
196 JENS: „Ja.“
197 DH: „Ihr schaut euch ja auch Bundesligaspiele an. Welches war das letzte
198 Spiel?“
199 JENS: „Das war letzte Woche Frankfurt... gegen Friedrichshafen … das war …
200 Bundesliga. Herren.“
201 MAX: „Ich mag das live nicht so ... ich finde große Menschenmassen
202 unangenehm … manchmal denke ich … die schalten ihr Gehirn aus, das ist
203 mir unangenehm. Ich guck ab und zu mal, wenn es zu seh‘n ist, Fernsehen -
204 und das genieß ich dann, weil da sieht man, wie man´s auf ´nem hohen Niveau
205 spielt… und man denkt sich: so muss ich´s machen, aber man weiß auch, da
206 komm ich nie hin. Wie beim Fußball - ich genieße auch guten Fußball und guten
207 Volleyball.“
208 DH: „Du genießt guten… Herren- oder Frauenvolleyball?“
209 MAX: „Was halt kommt. Ich finde nicht, dass das unterschiedlich ist … Ich
210 möchte selber nicht gegen die spielen (lacht) - insofern… Übrigens… denke
211 ich, die Akzeptanz – denke ich mal, ist größer geworden, auch für
212 Frauenfußball und so, dass man sich das mal anguckt, da sind wir ´n Stück
213 weiter gekommen in der Gesellschaft. Ob das 213 mit der Bezahlung so ist, glaube
214 ich nicht aber … ich glaube schon, dass, ähm vom Publikum her das mehr
215 angenommen wird. Dass es auch gute Frauenmannschaften gibt. Auch vom
216 Sponsor.“
217 DH: „Zu guter Letzt, noch eine Frage: Was macht gute Sportkleidung für euch
218 aus?
219 (Langes überlegen)
220 MAX: „Das Gute ist ja, du brauchst nicht viel zum Volleyball spielen: Hose,
221 Hemd, Schuhe, Socken… fertig isses. Und natürlich ein Handtuch für die
222 Dusche!“
223 JENS: „Ja da ist Volleyball in der Tat ein recht einfacher Sport aber … zielt
224 deine Frage auf die Qualität ab? Oder das Material? - Ich persönlich spiele
225 ohne Knieschoner. Für mich sind Knieschoner nicht essenziell. Da sind mir
226 gute Schuhe, ähm, deutlich wichtiger. Auch das Trikot, oder welche Hose ist
227 mir im Prinzip völlig wurscht, Hauptsache, ich kann mich frei bewegen und die
228 hängt mir nicht in den Kniekehlen – essenziell ist das Schuhwerk… sonst, wenn
229 die Schuhe Scheiße sind dann … rutschst du rum oder … knickst du um weil
230 sie zu griffig sind… aber … ob ich jetzt ein teures Trainingsshirt von irgend
231 ´nem Designer an hab´, oder ein nullachtfünfzehn-2€ T-Shirt … is´ völlig
232 Wurscht.“
233 DH: „Du hast es eben schon angesprochen, `Hauptsache sie hängt mir nicht in
234 den Kniekehlen´ - Meine Frage zielt mehr darauf ab, dass die typischen
235 Frauen- und Männerhosen sich unterscheiden. Kurz gefragt: Wieso sind eure
236 Hosen länger?“
237 JENS: „Ich glaub, mein Arsch sieht in ´ner Hotpant einfach scheiße aus! (lacht)
238 … Ne also – ich glaub, Männersporthosen haben mitunter den Punkt:
239 Bequemlichkeit. Also – wenn die Hose ganz kurz ist also Frauenhosenlänge,
240 die sind meistens nicht so bequem, find ich. Ich hab´ ein paar kurze Hosen die
241 mir so zu Mitte Oberschenkel gehen, da fühl ich mich meist nicht so wohl. Weil
242 – weiß nicht – ich fühl ich nicht
243 frei uns kann mich nicht frei genug bewegen. Ist wahrscheinlich ´ne Kopfsache,
244 wenn ich´s immer so machen würde wäre das normal für mich aber – ich denke,
245 ich hab´ mich einfach dran gewöhnt.“
246 MAX: „Was ich denke ist, dass mir enge Sachen tatsächlich unbequem wären,
247 un´...abhängig davon wie ich dann aussehe, lieber etwas größere Sachen die
248 ein bisschen rum flattern, es gibt enge Sachen die sind ja so dehnbar dass sie
249 wie eine zweite Haut anliegen, von daher, da spielt Bewegungsfreiheit ja keine
250 Rolle … ähm und was andere machen, ist deren Sache und wieso Frauen
251 vielleicht enge Sachen anziehen … vielleicht ist es auch etwas – modisches?
252 Dass sie sich besser drin fühlen wie sie aussehen, vielleicht denken sie da
253 mehr drüber nach? Kann man sich vorstellen – weil Mode ja auch eher eine
254 Frauensache ist und im Sport ist die Mode auch ein Faktor. Was jetzt hier so
255 ist -- ja weiß ich nicht aber ... Man sieht zum Beispiel natürlich ähm, beim
256 Beachvolleyball ist ein Körperbetonungsaspekt dabei. Und für die Frauen ist
257 das anders als … bei´n Männern. Die Männer zeigen ihre Muskeln und die
258 Frauen zeigen zum Beispiel … Lange Beine! Sagen wir´s mal so … aber das
259 ist … alles so ... mal kurz … rausgeflutscht.“ (lacht)
260 DH: „Danke für das Gespräch!“
Transkript 3: Jana
Bevor das Training startet, gehe ich auf eine kleine Gruppe von Leuten zu, die beim Netzaufbau zuschauen. Eine Person erklärt sich zum Gespräch bereit. Sie entgegnet mir, zu Forschungszwecken helfe sie gerne; sie versetzt sich in meine Person als Forscherin und erklärt: „Ich wäre auch froh, wenn ich jemand für ein Interview brauche und sich jemand bereit erklärt“. Wir setzen uns in eine Ecke der Halle, während diese sich nach und nach füllt. Länge der Aufnahme: 10:23 Minuten.
1 DH: „Spielst du abgesehen von dem Hochschulsport-Volleyball hier, auch im
2 Verein?“
3 JANA: „Nicht mehr. Also ich habe lange im Verein gespielt, ich hab´ in der
4 Grundschule angefangen – und hab dann so ziemlich mit dem Abi dann
5 aufgehörtim Verein zu spielen.“
6 DH: „Und im Verein; Das war Damen-Volleyball?“
7 JANA: „Äh Ja eigentlich immer, Am Anfang war das natürlich Jugend, dann
8 Damen, Talentförderung zwischendrin und dann Kader, alles was so
9 dazugehört…“
10 DH: „Jetzt spielst du nur hier?“
11 JANA: „Genau. Und halt im Sommer Beachvolleyball, aber halt nicht im
12 Verein.“
13 DH: „Und beim Beach, spielt ihr dann Frauen und Männer gemischt?“
14 JANA: „Ja, ich spiel meistens mit meinem Freund zusammen.“
15 DH: „Ihr seid dann eine Mannschaft?“
16 JANA: „Ja also … wir haben ab und zu Turniere gespielt, aber irgendwie haut
17 das dann nicht immer ganz hin … aber auch mal mit Frauen zusammen, ganz
18 gemischt, wie´s irgendwie grad´ passt.“
19 DH: „Du kennst dich ja hier aus, wie werden die Männer und Frauen aufgeteilt,
20 spielt ihr einen bestimmten Modus?“
21 JANA: „Wir machen ja nicht richtig Training, wir spielen eigentlich nur … also
22 am Anfang wird sich halt eingespielt und dann gibt’s im Prinzip meistens, also
23 in der Halle jetzt zwei, in der Halle drüben drei Felder, die dann halt nach
24 Leistung gestaffelt sind. Also es gibt ja – hier in der Halle – Zum Beispiel,
25 Dienstags ist Leistungstraining, Montags ist glaub ich Fortgeschrittenen und
26 Leistung, und so sind dann halt, also auf dem Leistungsfeld sollten eigentlich
27 alle das Läufersystem können – und – äh – und so staffelt sich das einfach
28 nach Leistung.“
29 DH: „Wie unterscheidet sich das Uni-Volleyball von dem Leistungsvolleyball,
30 das du früher gespielt hast - wenn man mal den Spielfluss bedenkt, die
31 Mannschaftszusammensetzung,… fällt dir noch ein Unterschied ein?“
32 JANA: „Vor allem, dass du eingespielt bist. Also, wir spielen hier immer in
33 verschiedenen Konstellationen, ich weiß gar nicht ob wir je in der selben
34 Konstellation gespielt haben. Dadurch, dass es halt jede Woche, jeden Tag
35 komplett andere Leute da sind … Anders als im Verein: da spielst du jede
36 Woche mit denselben Leuten und – das hast du halt hier nicht und dadurch ist
37 das Niveau generell nicht so hoch wie im Verein würd ich behaupten, weil du
38 … weil du auch komplett durchmischte Menschen hast, die verschiedene
39 Leistungsniveaus haben, du hast welche die extrem stark sind, grad die
40 Männer, dann hast du Frauen die auch stark sind, die sind aber nicht so stark
41 wie die stärksten Männer, die schwächsten Männer sind aber wiederum
42 schwächer als die stärksten Frauen, also es ist immer total durchmischt - das
43 ist halt Mixed. Aber es kommt halt jeder – teilweise sind Leute da, die noch nie
44 im Verein gespielt haben, es gibt welche die lange im Verein gespielt haben …
45 und dadurch ist es immer … also total tagesabhängig. Also - manchmal ist es
46 richtig gut und manchmal ist es halt eher - Hmmm! (lacht)“
47 DH: „Wenn du mal an die Spieler denkst, welche Voraussetzungen braucht ein
48 Spieler oder eine Spielerin hier, um zu punkten?“
49 JANA: „Meinst du auf dem Leistungsfeld?“
50 DH: „Ja, zum Beispiel.“
51 JANA: „Also, generell. Keine Ahnung - das ist schwer, bei Männern reicht
52 eigentlich schon, dass sie groß sind, wenn die dann blocken dann reicht das
53 schon (lacht) hmm - ich glaube… Ohne da gendern zu wollen oder so, als Frau
54 musst du glaub ich schon mehr können. Da musst du schon – ein gutes Auge
55 haben, gute Technik haben, ja – ansonsten brauchst du eine gewisse
56 Spielerfahrung, dass du gewisse, zum Beispiel Löcher auch siehst, dass du
57 weißt wohin du spielen musst, manchmal reichts auch einfach nur wenn du den
58 Ball halbwegs gescheit triffst. Die Technik muss halt relativ gut sitzen, sonst
59 kannst ja auch die Aufschläge nicht annehmen. Und – in allem musst du relativ
60 stark sein. Jeder hat irgendwo seine Stärken und seine Schwächen aber ….
61 Ja.“
62 DH: „Auch bei einem Trainingsspiel möchte man relativ ausgeglichene
63 Mannschaften auf die Feldhälften verteilen. Wie wird da in der Regel
64 vorgegangen?“
65 JANA: „Also zum einen, gucken dass es zahlenmäßig aufgeht – also das zum
66 einen. Und wenn es mit den Zahlen passt, einfach strikt nach Leistung. Je öfter
67 man hier ist, desto mehr kennst du die Leute und – weißt wer ist besser als der
68 andere – und dann teilweise auch nach Position natürlich – wenn man dann
69 zum Beispiel bemerkt: also wir brauchen dann hier noch ne Mitte zum Beispiel,
70 dann: hier auf die Seite - und dann fehlt noch Außen, dann kommt noch ´n
71 Außen rüber. Das ist ganz viel was da irgendwie so rein zählt.“
72 DH: „Okay, also jeder bekommt seine Position …“
73 JANA: „Wir versuchen es, ja. Aber es klappt auch nicht immer. Also manchmal
74 gibt’s auch einfach nur eine Mitte und du brauchst aber vier – und dann muss
75 halt irgendwer anders Mitte spielen. Also man versucht natürlich das was die
76 Leute gerne spielen wollen und was man selber gerne spielt, oder teilweise im
77 Verein spielt, auch zu erfüllen, oder – wenn man halt keinen Steller hat dann
78 … muss halt irgendwer anders stellen. Ja.“
79 (Kurze Unterbrechung, Jemand begrüßt uns beide)
80 DH: „Ist es denn sinnvoll, Männer und Frauen gleich aufzuteilen?“
81 JANA: „Ja, definitiv. Weil Frauen generell halt, grad im Block schwächer sind,
82 und wenn dann halt praktisch nur Kerle gegenüberstehen dann kannst halt
83 nicht … also … Grad für Männer ist die Netzhöhe ja auch ´nen Ticken niedriger
84 – Männer spielen ja höher – Damen spielen tiefer – das heißt für uns ist es
85 eigentlich schwerer und für die ist es einfacher…. Und deswegen macht das
86 definitiv Sinn zu gucken, dass Frauen auf beiden Seiten gleichmäßig verteilt
87 sind und nicht nebeneinanderstehen.“
88 DH: „Wieso nicht nebeneinander?“
89 JANA: „Weil du dann zwei Frauen am Block hast und so hast du dann ´nen
90 Kerlder dann den Block stellen kann.“
91 DH: „Also Frauen und Männer – bedingt durch Körpergröße, können besser
92 oder schlechter blocken?“
93 JANA: „Ja, da macht es sich vor allem bemerkbar.“
94 DH: „Aber so im Spiel – Spielen Frauen und Männer auf unterschiedliche
95 WeiseVolleyball?“
96 JANA: „Nö, das gar nicht. Das glaub ich nicht. Natürlich im Angriff machts dann
97 auch wieder was aus, wenn ich als Frau zwei riesen Kerle im Block gegenüber
98 hab, ist es für mich auch viel schwieriger, also dann hab´ ich sehr wenig
99 Optionen einfach, was den Angriff angeht. Und äh- als Kerl, wenn du jetzt
100 gegenüber ´nen Frauenblock hast, ist es halt – wie kein Block (lacht), eigentlich
101 ein bisschen traurig, aber ich glaub gerade was Annahme angeht, Stellen und
102 so Sachen, da kommts einfach – da geht’s nicht mehr um Mann oder Frau.
103 Also da kommts dann drauf an wer – Also Nein, da hat die Größe auch keinen
104 Vor- oder Nachteil.“
105 DH: „Ich denke gerade an das Wort – wenn Männer Frauen blocken – kommt
106 manchmal der Spruch Frauenblocker. Hast du das auch schonmal gehört?“
107 JANA: „Ja, ja . Also das – weil´s halt auch so´n bisschen – gemein ist, wenn
108 dann so zwei riesen Typen so ´ne Frau wegblocken, weil – dann hat man halt
109 kaum noch ´ne Chance. (lacht) … Man hat halt wenig Optionen und wir sind
110 ja im Training - also wenn wir vom Spiel reden – ähm - Ja sorry dann mach
111 alles was du kannst um zu gewinnen! Aber wenn du halt im Training bist, dann
112 willst du ja dass der Spielfluss bleibt, weiß nicht, grad´ wenn ´ne Frau vorn´
113 steht, die dann immer weg zu blocken, immer weg zu blocken, dann entsteht
114 und dann kannst du halt, also,
115 es macht halt, wenn du gut Volleyball spielst und lange Volleyball spielst
116 [unverständlich] angreifen aber wenn du dann nur in den Block haust, dann nur
117 noch legen kannst, ist es auch irgendwann … du willst ja auch mal was anderes
118 machen als immer nur hinter den Block legen. Und das weiß dann auch
119 irgendwann die andere Mannschaft und dann steht direkt auch hinten einer und
120 dann machst du nicht mehr wirklich ´nen Punkt. Das ist dann ein bisschen
121 witzlos.“
122 DH: „Ist das Wort schonmal gefallen, Frauenblocker?“
123 JANA: (bestimmt) „Ja. Ja. Schon. Klar, Klar!“
124 DH: „Das hört sich sehr eindeutig an. Fällt der Begriff in jedem Training?“
125 JANA: „Nein, das würd´ ich nicht behaupten. Also – teilweise sind auch kaum
126 Frauen da. Wir sind generell wenig Frauen auf dem Leistungsfeld. Also - auch
127 bedingt.“
128 DH: „Wieso seid ihr wenig Frauen? Woran liegt das, dass hier mehr Männer
129 sind?“
130 JANA: „Ich glaube halt zum Einen dass man als Mann nicht so viel Technik
131 haben muss, dass da oft die größere Kraft ausreicht, und du als Frau auch viel
132 … viel sicherer sein musst, und viel besser spielen musst, um hier spielen zu
133 können, ähm, als ein Mann, der hat glaub ich einfach viel mehr Kraft und die
134 meisten auch in der Grö– in der Höhe- und äh, ja. Ich glaub daran liegt´s und
135 ansonsten, weiß nicht. Glaub´, viele Frauen spielen jetzt im Verein – Volleyball
136 ist ja sonst eher so´n Frauen-Vereinssport, und die Frauen, die im Verein
137 spielen, kommen dann nicht mehr zum Uni-Volleyball.“
138 DH: „Vielen Dank für das Gespräch!
Transkript 4: Elli und Andrea
Es ist der 6. März, während des Trainings (ca. 20:30). Elli und Andrea haben sich zu einem Interview bereit erklärt. Wir gehen wegen der Geräuschkulisse in die Damenumkleide. Dauer der Aufnahme: 8:17 Minuten.
1 DH: (Zu ANDREA) „Bei dir weiß ich es ja eigentlich schon, du spielst noch nicht
2 lange Volleyball. Du hast bisher immer Mixed gespielt, oder?“
3 ANDREA: „Ja.“
4 DH: (zu ELLI) „Und du?“
5 ELLI: „Ja, nur Mixed. Immer schon Mixed. Seit zwanzig Jahren.“
6 DH: „Wow! Okay… Meine erste Frage bezieht sich auf die Modi. Wir haben ja
7 bei unseren Spielen entweder den Modus vier-zwei oder drei-drei. Welchen
8 Modus spielt ihr lieber?“
9 ELLI: „Emmm… (denkt nach) ich spiel gerne vier-zwei. (DH: Und wieso?) …
10 Äh. Das Spiel ist schneller (Stimme geht hoch) … n bisschen härter… ja das
11 sind die Gründe. … Weil - nur zwei Damen spielen und ja die Herren schlagen
12 halt einfach härter als die Damen. Deswegen spiel ich äh - vier-zwei … lieber.“
13 ANDREA: „Als Anfänger ist drei-drei natürlich etwas angenehmer. Da hat man
14 dann auch die entsprechenden Gegner dazu, deswegen find ich als Anfänger,
15 also als Neuling drei-drei etwas angenehmer.“
16 DH: „Wieso gibt es eurer Meinung nach die Mindestfrauenregel? Es heißt ja
17 meistens mindestens zwei Frauen und dann ergibt sich ein zwei Frauen, 4
18 Männer.“
19 ELLI: „Ja, Gut…. Damit die Mannschaften…. Du kannst ja auch theoretisch
20 sagen mindestens nur eine Frau. Das wär ja auch Mix … aber ich glaube äh…
21 damit man die Härte ein bisschen – ich vermute - rausnimmt deswegen sagt
22 man mindestens mal zwei Frauen, natürlich wenn man sagt, mindestens zwei
23 Frauen, spielen die (betont) meisten nur mit zwei Frauen. Damit sie die Härte
24 noch beibehalten. So glaub ich ja… Und wenn das nur eine Frau wäre… Dann
25 würde schon der Unterschied zu Herrenvolleyball sehr gering sein.“
26 DH: „… und das Herrenvolleyball? Ist das ... aggressiver?“
27 ELLI: „Schneller und härter… auch schneller und härter.“
28 DH: „Hattet ihr mal zu wenig Frauen für ein Spiel?“
29 ELLI: Ja ...und dann ... also - kann man nicht antreten. Dann muss das Spiel
30 abgesagt werden. Aber es kam in der Regel, ich sag mal in hundert Spielen
31 nur ein Spiel vor. … Ansonsten sind wir mit Frauen relativ sicher besetzt.
32 DH: …aber zu wenig Männer…
33 ELLI: „Hatten wir noch nie. Man kann ja auch mit vier Frauen spielen. Man kann
34 ja nicht mit fünf Herren spielen, wenn man nur eine Dame hat.“
35 DH: „Man dürfte ja auch mit sechs Frauen spielen.“
36 ELLI: „Richtig, theoretisch ja.“
37 DH: „Dann wäre es aber eigentlich kein Mixed.“
38 ELLI: (zögert) (grinst) „Mmmh. Ne eigentlich nicht…. Aber, das glaub ich ….
39 Ich weiß gar nicht, ob es in der Regel im Mixed…. also ich hab´ noch nie gehört
40 man muss mindestens soundso viel Männer haben, es geht immer um die
41 Damen.“
42 DH: „Spielen Frauen und Männer unterschiedliche Spiele? Würdest du sagen,
43 dass Männer generell schnell spielen? Jeder Mann spielt schneller als jede
44 Frau?“
45 ELLI: „Nein, nein. Ich würd´ sagen das ist Leistungsabhängig…. Also ...
46 grundsätzlich muss man sagen Volleyball ist eine der schwersten
47 Ballsportarten dies gibt, weil´s viel Technik ist – und natürlich, wenn man ähm
48 - die Technik nicht so beherrscht, ist eine Frau definitiv besser die die Technik
49 beherrscht als ´nen Mann. Muss man schon sagen. Also nein kann ich
50 verneinen.“
51 DH: „Es ist ja Freizeitsport…. In der Liga…. Außer Pokal geht es ja eigentlich
52 um nichts ... aber Leistung ist euch trotzdem wichtig?“
53 ELLI: „Ja. Wir haben mal ´ne Zeit, wo wir nach dem Sozialprinzip gespielt
54 haben, wir haben jetzt ´ne Zeit wo wir nach dem Leistungsprinzip spielen ...
55 Sozialprinzip spielst du, wenn man ehrlich ist – wie wir das immer so gemacht
56 haben, wenn wir einfach zu wenig Spieler hatten. Weil wir keine Wahl hatten.
57 Natürlich – umso mehr Leute kommen, umso höher ist die Konkurrenz, und
58 dann spielt man automatisch nach Leistung. Weil bei uns jeder gewinnen
59 möchte und das beste rausholen möchte. Ja.“
60 DH: „Wieso spielt ihr nicht in einer Liga? Es wäre ja nicht gemixt.“
61 ELLI: „Genau. Also - Jetzt bei mir persönlich, hieß es immer, ich bin zu klein
62 für die Liga, also Damenliga. Technik haben ´se immer gesagt ist gut aber
63 Körpergröße wird nicht reichen. Deswegen bleibt mir nicht viel übrig, als Mix zu
64 spielen.“
65 Zu ANDREA: „Wieso hast du dich für die Mixed-Mannschaft entschieden?“
66 ANDREA: „Ja, also, das ist die Mannschaft, die hier ist und ich find eigentlich
67 die Mixed-Mannschaft auch interessant, weil … da kriegt man auch mal andere
68 Bälle, die man annehmen muss. Und die stärker sind und man hat da ein …
69 besseres Verbesserungspotenzial ... da man auch, ähm - andere Bälle kriegt
70 als vielleicht leichtere Bälle ähm von den Damen. Aufgrund Kraft ... ja.“
71 DH: „Schaut ihr gerne Bundesliga?“
72 ELLI: „Hm, also ich schaue gerne Volleyball im Fernsehen, aber ich muss
73 sagen: die Übertragungsquote ist ja sehr gering. Ich guck jetzt nicht in der
74 Fernsehzeitung - heute Abend ist Bundesliga, weiß nicht, VC Wiesbaden oder
75 sowas spielt - sondern es ist meistens nur Zufall. Und es werden ja auch leider
76 nicht ... Europameisterschaft und sowas wird ja leider nicht so übertragen wie
77 in anderen Ballsportarten.“
78 DH: „Herren auch?“
79 ELLI: „Ja. Also wenn ich das seh´ guck ich auch Herren - Also Herren waren
80 wir auch ... bislang … wir waren auf Damenspielen und Herrenspielen bisher.
81 Bundesliga – also beides ist - find ich, sehr interessant. (pause) (laut:) Aber -
82 zum reinen Angucken find ich ist eigentlich Damen ... schöner (Stimme geht
83 hoch) weil man von den reinen Spielzügen mehr sieht, weil´s halt langsamer
84 ist, vom angucken her.“
85 DH: „… ich schaue auch lieber Damen“
86 ELLI: „(lacht) - Allein schon da in der Halle wenn sie die Angaben machen,
87 kannste ja gar nicht – äh das visuell aufnehmen.“
88 DH: „Manchmal sieht man den Ball nicht (Zu A.) Schaust du auch Spiele im
89 Fernsehen oder Live?“
90 ANDREA: „Ja, also wenn ich mal was sehe und ich die Möglichkeit habe dann
91 schalte ich auch ein …. Aber auch lieber die Damen, weil man den Ball bei den
92 Männern auch kaum verfolgen kann. (lacht)“
93 DH: Danke für euer Gespräch!
Transkript 5: Ben, Dennis, Simon und Klaus
Es ist der 6.März um 21:55. Wir haben das Training gerade beendet. Da ich Interviews angekündigt habe und erst die Frauen interviewt habe, warten die Männer darauf, dass wir beginnen. Während des Trainings hat nur das Gespräch mit den Frauen zeitlich gepasst, deswegen wird nun von mir erwartet, dass ich das Gespräch jetzt, nach dem Training, beginne. Ich frage vorsichtig noch mal nach, ob es zeitlich noch passt. Ich frage noch zwei weitere Männer aus der anderen Mannschaft, die gerade bei uns sitzen, ob sie sich dazu setzen möchten. Dennis bejaht. Es sitzen jetzt Ben, Dennis, Simon und Klaus bei mir. Ich werde zunächst gefragt, um was es denn geht. Als ich andeute, dass Geschlecht eine Rolle spielt, wird gewitzelt, Dennis fühle sich divers. Dauer der Aufnahme: 11:50 Minuten.
1 DH: Habt ihr mal in einer Leistungsmannschaft Volleyball gespielt, also nicht-
2 Mixed?
3 (Alle verneinen, außer Klaus.)
4 DH: „Nur du?“
5 KLAUS.: „Da gibt’s keine Frauen.“
6 DH: „Ja. Spielt ihr lieber den Modus vier-zwei oder drei-drei?“
7 BEN: „Macht für mich keinen Unterschied. Ich hab´ beides gleichzeitig
8 kennengelernt und ... das bisschen was da anzupassen ist … macht auf dem
9 Niveau für mich keinen Unterschied.“
10 DENNIS: „Wenn ich ganz ehrlich bin, spiel ich lieber vier-zwei.“ (DH: „Wieso?“)
11 „Ähm …. Also vom Spielspaß her, von der Mannschaft … äh… macht´s mir
12 auch Spaß, vom Spielspaß her, spiel ich lieber vier-zwei, ähm (pause) …
13 weil´s… klarer ist…. Also – ich weiß, es sind immer zwei Leute zum Blocken
14 vorne, sonst muss ich mich immer konzentrieren, weil, je nachdem, wer wo
15 steht, dass wir teilweise bisschen anders spielen, aber das liegt dann mehr an
16 unserer Mannschaft,als generellam System.“
17 KLAUS: „Ich spiel lieber vier Männer und zwei Frauen. Aber - wenn´ s nicht
18 anders geht, müssen wir auch so spielen. (lacht)“
19 DH: „Mal anders gefragt: Macht es denn einen Unterschied – also im Spiel? Ist
20 das Spiel … anders?“
21 KLAUS: „Aggressiver, ja. (DH: „und schneller?“). Schneller nicht unbedingt.
22 Aber aggressiver halt.“
23 DENNIS: „Also ich find – als Mannschaft mag ich beides, da kommt jeder, äh,
24 zum Zug. Rein vom Spiel her find ich auch vier-zwei angenehmer, weil ja - ich
25 weiß, es ist immer ein Doppelblock vorne.“
26 SIMON:„Bisschen härter.“
27 DH: „Geht´s euch beim Volleyball mehr um Leistung, oder Spielspaß?“
28 KLAUS: „um´s Gewinnen.“
29 SIMON:„Spielspaß.“
30 DENNIS: „Also ich würde – eigentlich den Spaß, aber wenn, ich sag mal so,
31 das Spiel nicht zu Stande kommt … Da geht der Spaß automatisch auch ´n
32 bisschen verloren. Eigentlich für die komplette Mannschaft, deswegen glaub
33 ich, brauch es - äh - beides. Ähm - Also das eine wird ohne das andere nicht
34 funktionieren.“
35 BEN: „Also für mich ist Leistung immer so mit Siegeswillen verbunden, find ich
36 ´n bisschen schwierig wenn der … Ball gut läuft und man dann hinterher
37 verliert, äh, wie Dennis grad gesagt hat, Wenn der Spielfluss dann da ist, dann
38 kommt auch der Spielspaß zustande, find ich eigentlich am wichtigsten …
39 Sodass das Niveau das Gleiche ist ungefähr, dass man sich weder
40 abschlachten lässt noch, dass man´s zu leicht hat und runterziehen lässt von
41 ´ner anderen Mannschaft.“
42 DH: „Wenn es die Regel (mindestens- zwei Frauen zB) nicht gäbe, würdet ihr
43 eine Mannschaft nur mit Männern aufstellen, oder gemischt?“
44 KLAUS: „Ne das ist keine Frage (lacht)“
45 DENNIS: „Es käme immer drauf an“
46 KLAUS: „Wenn ich die Regel ´net hätt´, dann würd´ ich in ´ner
47 Männermannschaftspielen.“
48 BEN: „Es hängt ja auch ganz stark am Kader, also an der Gesamtmannschaft,
49 wir ham´ ja - “
50 KLAUS: „Das ist ja die Klasse, die wir spielen.“
51 BEN: „Ja…“
52 KLAUS: „Das ist ´ne Hobby Mannschaft und dann spielt man halt mit zwei oder
53 drei Frauen.“
54 BEN: „Aber wenn ich das jetzt mal am Training messe, wo wir dann teilweise
55 auch mit fünf Männern, einer Frau spielen, oder mit zwei Stellern, ´ner Frau als
56 Angreiferin spielen äh – da gibt’s die Regel ja dann quasi nicht, also im Training
57 gibt’s die Regel ja eher nicht, da schaut man dann, dass es auf beiden Seiten
58 des Netzes – dann ungefähr gleich ist und – aber für´n Spielbetrieb find ich´s
59 schon wichtig.“
60 DH: „Wieso spielst du Mixed?“
61 KLAUS: „Wieso - (lacht) - weil ich kein Bock mehr hab´, zweimal oder viermal
62 in der Woche zu spielen. (lacht) und auch nicht mehr kann … Und auch nicht
63 mehr kann – ich mein - man baut ja von Jahr zu Jahr ab.
64 DH: „Gibt es denn einen Unterschied in den Spielweisen von Männern und
65 Frauen?“
66 DENNIS: „Jein.“
67 KLAUS: „Ja gut, doch!“
68 DENNIS: „– generell glaub ich, kommt es immer auf die Person drauf an. Und
69 jeder ist unterschiedlich – ob Mann oder Frau. Ähm … ich mein, generell ist so
70 dass einige Männer tendenziell größer sind als Frauen, tendenziell ´ne stärkere
71 Zugkraft im Arm haben, von daher gibt’s Unterschiede ….. ähm aber, pauschal
72 find ich, kann man´s – äh – also – eigentlich kommts immer drauf an und dafür
73 gibt’s aber auch andere Qualitäten. … ich mein es ist ganz wichtig, dass man
74 Charaktere in der Mannschaft hat, die Ruhe reinbringen, die keine Hektik
75 verbreiten, keinen Stress verbreiten und nicht andere Leute unruhig machen.
76 Und vielleicht neigen manche Männer eher dazu, das manchmal zu tun als
77 Frauen … Dass Männer vielleicht eher ´n bisschen emotionaler äh - sind und
78 Unruhe reinbringen ins Spiel aber …. Generell kommt´s immer auf´n Charakter
79 drauf an und der kann bei Mann und Frau so oder so sein, also und auch die
80 sportliche - ich sag mal so - Komponente ist auch immer unterschiedlich ...
81 wichtig ist, dass man als Mannschaft zusammen funktioniert.“
82 KLAUS: „Also wenn man, egal wo man guckt: Egal welche Liga, egal welche
83 Oberliga oder Bundesliga, egal welche …. Im Volleyball ist ... bei Männern,
84 also sechs-sechs, also sechs Männer oder auch sechs Frauen, immer die
85 Männer, egal welche Liga, immer stärker, immer schneller, immer höher, immer
86 kräftiger,immer… das ist einfach so. Das ist ganz klar. Das ist menschlich.“
87 BEN: „– man muss das ganze holistisch sehen. Ich sag´ mal - Wenn du zum
88 Volleyball kommst, als Mann, ordnest du dich ja in ´ne Liga ein. Männer sind
89 einfach genetisch grundsätzlich ´n bisschen größer und stärker ausgelegt.
90 (KLAUS: „Genau“) … ist ja nicht von der Hand zu weisen. Deswegen sind die
91 Ligen dann auch – sag´ ich mal, die sind ja begrenzt auf ´ne Größe … und
92 entsprechend stellt sich die Stärke damit zusammen. Und - das setzt sich im
93 Endeffekt durch, bis auf unsere Hobbyliga runter. Frauen, die zu uns – oder –
94 die sich in den Mannschaften rumtreiben: sag ich mal, ganz nonchalant,
95 (SIMON: „Mitspielen.“) die, die da mitspielen, die sind auf ´nem Niveau, wenn
96 sie besser wären, sowohl leistungstechnisch als auch genetisch - also wie auch
97 immer, könnten sie Liga spielen. Da gibt’s manchmal welche so, in manchen
98 Mannschaften, die haben: das mal gemacht, die machen das aus …
99 irgendwelchen Gründen nicht mehr, die könnten aber auch höher spielen. So
100 setzt sich dann die Gruppe zusammen. Und dann … wenn man´s noch größer
101 betrachtet, wenn dann jemand noch größer gewachsen wäre, würd er vielleicht
102 Basketball spielen oder … dann liegts an regionalen Sachen, dass die ganz
103 woanders landen.“
104 DH: „Zu guter Letzt möchte ich noch wissen – schaut ihr gerne Bundesliga?“
105 BEN: „Ja.“
106 KLAUS: (zustimmendes „hmm“)
107 (die anderen nicken)
108 DH: „Was schaut ihr euch da an…?“
109 KLAUS: „Och jetzt, was kommt.“
110 BEN: „Also – eher zufällig wenn´s mal kommt, ja.“
111 DH: „Im Fernsehen?“
112 SIMON: „Fernsehen, ja genau.“
113 BEN: „… oder wenn man mal zufällig mitkriegt, dass es gestreamt wird.“
114 KLAUS: „Bei sporteins immer Mittwochs und Sonntags! (lacht) - Mittwochs
115 kann ich´s ´net gucken.“
116 DH: „Männermannschaften oder Frauen?“
117 KLAUS: „Was kommt, ja.“
118 BEN: „Auch gern Champions League, oder …“
119 KLAUS: „Also da ist es natürlich auch immer wieder …. bei den Männern ist
120 Angabe, (betont) WENN die Annahme kommt, …. Annahme, Steller, Schlagen,
121 Tot. (pause) So. Und so wechselt das ständig hin und her. Bei den Frauen kann
122 das auch zehnmal hin und her gehen, weil da, der Boost einfach ´net so da ist.
123 Aber das ist das, was ich gesagt hab´.
124 DENNIS: „Aber ich muss sagen bei Frauen schau ich deswegen auch gern zu,
125 …“
126 KLAUS: „da kommt mehr Spiel …“
127 DENNIS: „ …weil, weil mehr, sozusagen… Spielraffinesse … gefragt ist, bei
128 den Männern ist schneller der Punkt da. Bei anderen Sportarten find ich oft den
129 Männersport interessanter, weil er ... technisch hochwertiger ist, aber das liegt
130 dann am Spiel. Also bei Handball, Fußball, mehr hin und her geht, dass es da
131 nicht direkt ´nen Punkt ist, und da find ich dann die Schnelligkeit wieder
132 spannend. Und beim Volleyball zuzugucken find ich´s dann bei den Damen
133 interessanter, weil halt mehr Spiel in dem Fall zustande kommt oder mehr …
134 Abwechslung, ich sag mal so, drin ist, als – äh - bei manchen anderen
135 Sportarten.“
136 Kann man sagen - Statt
137 als reine Männermannschaft hat so eine Mixmannschaft auch mehr Spiel?
138 Versteht ihr die Frage?“
139 BEN: „Doch durchaus, ich weiß wo du hin willst und ja …“
140 KLAUS: (murmelt zustimmende Geräusche)
141 BEN: „… mehr Spielfluss, mehr Sicherheit, in jedem Fall. …. Da ist dann auch
142 breiter gefächert, weil… die … Brutalität der Männer auf die Finesse der Frauen
143 trifft und sobald dann doch mal … einer runtergekratzt wird der sonst halt tot
144 wäre. Das machts auf jeden Fall interessant.“
145 DH: „Vielen Dank für das Gespräch!“
Feldforschungstagebuch
1 Feldtagebucheintrag vom 16.1.
2 Heute ist Mittwoch, der 16. Januar 2019; Von 20 bis 22 Uhr in der Halle meines
3 Vereins. Heute ist kein reguläres Training, sondern ein Wettkampfspiel gegen
4 ein Team aus Denberg4. Das Spiel findet im Rahmen der Liga „Mixed 1“ statt,
5 der Regel nach müssen in dieser Liga „mindestens zwei Frauen“ auf dem
6 Spielfeld stehen. Dieser „Modus“ wurde im Vorfeld als „Modus 4:2“ betitelt.
7 Genauer ausgedrückt, ist dies als höchstens vier Männer zu mindestens zwei
8 Frauen zu verstehen.
9 Ich möchte heute den Blick auf Zugehörigkeiten lenken. Diese sind auf
10 vielfältige Weise zu verstehen: Zugehörigkeit zu einer Sportmannschaft, oder
11 zu einer Kategorie (im Sinne von Humandifferenzierungen). Welche werden
12 thematisiert; und: Wie werden diese Zugehörigkeiten sichtbar gemacht? (Ich
13 werde feststellen, dass sie sichtbar und hörbar sind). Außerdem möchte ich
14 beobachten, wie die Vorgabe des Modus´ im Wettkampf bei meinem und dem
15 gegnerischen Team interpretiert wird. Die Modus-Regel lässt einen Spielraum,
16 was das Verhältnis Anzahl der Frauen zu Anzahl der Männer auf dem Spielfeld
17 angeht. Mögliche Konstellationen sind: Zwei Frauen zu vier Männern; drei zu
18 drei; vier zu zwei, fünf zu eins oder auch sechs Frauen. Abgesehen von dieser
19 Frage halte ich die teilnehmende Beobachtung explorativ, für Notizen habe ich
20 Papier und Stift dabei. Es gibt kein externes Publikum, das nicht aus Spielern
21 der beiden Teams besteht.
22 Da ich Teil des Teams bin und im Spiel zur Verfügung stehen möchte, nehme
23 ich auch als Spielerin an dem Geschehen teil. Anfangs habe ich es mir leicht
24 vorgestellt, die teilnehmende Beobachtung und den Wettkampf parallel zu
25 verrichten. Im Verlauf des Spiels schlüpfe ich jedoch nicht nur in die Rolle der
26 Spielerin und der Auswechselspielerin auf der Bank, sondern werde auch mit
27 einem (männlichen) Teammitglied auf der (zweiten) Schiedsrichterposition
28 ausgewechselt. Das schnelle Umdenken strengt an.
29 Aus der Damenumkleide heraus in die Halle eintretend, ist die
30 Teamzugehörigkeit ist die erste Kategorie, auf die mein Blick fällt. Anhand der
31 Trikotfarben registriere ich schnell, wo meine Teamkolleg*innen und wo die der
32 gegnerischen Mannschaft sich aufhalten. So werden die Teams auch für
33 Außenstehende leicht sichtbar; Jedoch haben wir kein externes Publikum. Das
34 einheitliche Bekleiden beschränkt sich auf die Trikots. Nur diese sind jeweils in
35 ihrer Form, Farbe und ihrem Material gleich. (Man bedenke diesen Umgang
36 mit einheitlicher Kleidung im Vergleich zu Spielen des Leistungssports: Bei den
37 Spielen, bei denen deutlich mehr Zuschauer erwartet werden als hier im
38 Hobbysportbereich, erstreckt sich die einheitliche Bekleidung auch über Hosen
39 und Knieschoner, auch oft Socken, in weniger Fällen bis über das
40 Schuhwerk5 ). Nicht einheitlich ist die sonstige Kleidung der Spielerinnen und
41 Spieler einer Mannschaft. Es lässt sich aber ein sehr sichtbares Beispiel von
42 geschlechtsspezifischer Kleidung erkennen. Dies sind die Sporthosen. Es ist
43 auffällig, dass die Männer weitere und längere Hosen tragen, während die der
44 Frauen kürzer und enger sind. Die Teamzugehörigkeiten sind außerdem durch
45 das Netz sichtbar, das die beiden Feldhälften und damit auch die
46 MannschaftenimSpieltrennt.
47 Hörbar sind die Mannschaftszugehörigkeiten während des Spiels durch Jubeln
48 und „Schlachtrufe“, mit denen die eigene Mannschaft motiviert und die
49 gegnerischeMannschafteingeschüchtert werden soll.
50 Im Wettkampf- Das Schiedsgericht:
51 Die Person, die das Erste Schiedsgericht stellt, muss eine möglichst gute Sicht
52 aufdas Spielgeschehen haben. Dazu steht sie auf einem Sprungkasten6 und
53 nimmt so eine um etwa 1 Meter erhöhte Position ein, die genau zwischen den
54 Mannschaften an einem Ende des Netzes positioniert ist und diese Grenze
55 zwischen den Teams gut überwacht. Geahndet werden Übertritte über die
56 Mittellinie unter dem Netz, „Übergriffe“ bei denen der Ball komplett über der
57 Feldhälftedes Gegners gespielt wird, sowie Netzberührungen.
58 Am gegenüberliegenden Ende steht das Zweite Schiedsgericht, hinter dem
59 mindestens eine Person sitzt, die den Spielstand überwacht, durch die
60 Punktetafel nach außen hin kommuniziert und gleichzeitig für die
61 Wettkampforganisation in ein Dokument überführt, das von beiden Parteien
62 unterschrieben werden muss.
63 Rollenreflexion:
64 Als Forschende bin ich für die Personen des anderen Teams nicht erkennbar;
65 nur für mein Team: denn diese Personen wissen wofür ich mir Notizen mache.
66 Meine Zugehörigkeit zum Team wird zum einen durch das Trikot, zum anderen
67 durch die Bewegungen und die Position meines Körpers in der Halle, auf dem
68 Spielfeld und der Auswechselbank, sichtbar. Selbst auf der Bank sitzend wird
69 meine Bereitschaft deutlich - durch die restlichen Sportklamotten wie Schuhe,
70 Hose, den Haarzopf, und möglicherweise auch durch mein vom Sport erhitzt
71 anmutendes Gesicht.
72 Das gegnerische Team ist mit nur zwei Frauen angereist, die beide mitspielen
73 (müssen). Eine der Frauen nimmt die Position der Zuspielerin ein, die andere
74 Frau spielt auf der Position der Außenangreiferin.
75 Unsere (zwei) Zuspielerinnen sind Frauen. Insgesamt zu elft, finden sich bei
76 uns vier Frauen und sieben Männer wieder. Jedoch haben wir das
77 Schiedsgericht zu stellen, welches aus fünf Personen besteht. Zwischenzeitlich
78 sind wir drei Frauen auf unserem Spielfeld.
79 Von meinen bisherigen (Damenvolleyball-)Erfahrungen kannte ich die Situation
80 nicht, dass bei Heimspielen das Schiedsgericht selbst gestellt wird. Dass
81 die/der Schiedsrichter*in über ein Spiel des eigenen Teams richtet, spiegelt
82 den „lockeren“ Charakter des Hobbyvolleyballs wider, der möglichweise zum
83 einen aus Unlust auf Professionalisierung, zum anderen aus Personalmangel
84 resultiert. Außerdem muss das Schiedsgericht keine Qualifikation nachweisen.
85 Den Wechsel zwischen Spielfeld und Schiedsgericht empfinde ich als
86 besonders anstrengend. Wir wechseln im Spiel mehrmals die
87 unterschiedlichen Positionen, auch die des Schiedsgerichts. Fast jedes
88 Teammitglied nimmtam Wettkampf auf dem Spielfeld teil.
89 Im Verlauf des Spiels fällt mir eine Situation besonders auf: Ein Spieler meines
90 Teams blockt eine gegnerische Frau im Angriff und macht einen Punkt. Keine
91 ungewöhnliche Situation, jedoch stellt er sich danach ans Netz, grinst und hält
92 ihr die Hand zum Abklatschen hin. Sie reagiert darauf nicht und es bleibt unklar,
93 ob sie seine Geste wahrgenommen oder ob sie sie ignoriert hat. Für mich bleibt
94 unklar, wie die Geste zu interpretieren ist.
95 Feldtagebucheintrag vom 26.2.
96 Datum: Dienstag der 26. Februar 2019, von 20 bis 22 Uhr in einer kleinen,
97 älteren Sporthalle, inder regelmäßig Team Ameisenberg das Training abhält.
98 Dieses Team nimmt unregelmäßig, etwa einmal im Jahr, an (Turnier-)
99 Wettkämpfen teil. Ich möchte bei diesem gemischtgeschlechtlichen
100 Freizeitteam beobachten, welche Differenzen im Trainingsablauf relevant
101 werden und welche nicht. Da außerhalb von Wettkämpfen keine Regel besteht,
102 die einen Mindestanteil der Frauen auf beiden Seiten angibt, möchte ich gezielt
103 beobachten, ob die Geschlechterdifferenz in den Hintergrund rückt. Ist das
104 Geschlecht in dieser Freizeitmannschaft strukturgebend, oder wird diese
105 Differenz gar nicht gebraucht?
106 Ich habe mich für eine offene Beobachtung entschieden und bin in der Halle
107 relativ mittig und in Alltagsklamotten sitzend, mit Block, Stift und Tonbandgerät
108 deutlich als nicht-Trainierende für alle erkennbar. Da ich meine Kontaktperson
109 vorher nach Erlaubnis gefragt hatte (die er weitergeleitet hatte), wissen alle im
110 Voraus Bescheid. Im Verlauf des Trainings stelle ich mich nochmal jedem vor.
111 Da ich die Erfahrung gemacht habe, mit einer aktiven Teilnahme wenig
112 entscheide ich mich für eine
113 Beobachtung; ich möchte außerdem Gruppengespräche mit den Teilnehmern
114 führen. Mir verschafft der Gedanke, die Menschen von ihrer Freizeitaktivität
115 abzuhalten, leichtes Unwohlsein. Über dieses kann ich leichter dadurch
116 drüberstehen, dass zwei der Gesprächspartner alte Bekannte sind. Ich
117 versuche außerdem deshalb, die Gespräche nicht zu langwierig zu gestalten.
118 Aus dem Gedächtnisprotokoll:
119 Ich stelle mich fünf Minuten vor Beginn vor die Halle. Meinen Kontaktmann J.
120 kenne ich daher, dass er einige Jahre regelmäßig bei den Trainings in meinem
121 damaligen Volleyball-Damenteam als Trainingsunterstützung mittrainiert hat.
122 Zwei Männer mittleren Alters kommen kurz nach mir an. Ich frage Sie, ob sie
123 Volleyballer sind und wir stellen uns vor (Sie sind Gastspieler). Es kommen
124 weitere, Frauen und Männer, alle klatschen sich zur Begrüßung mit den
125 Händen ab. Auch ich werde so begrüßt. Es wird geredet und gelacht, die
126 Stimmung ist gut. Einige bleiben mit mir draußen vor der Halle stehen, davon
127 die zwei Gastspieler aus einem anderen Stadtteil, die die kurz nach mir
128 eingetroffen waren, mein Kontaktmann J. und K., die ich ebenfalls von früher
129 kenne. Mehrere Menschen sind gleichzeitig gekommen, klatschen ab und
130 gehen direkt in die Halle weiter. Nach der Begrüßung und ein paar
131 ausgetauschten Fragen gehen wir in das Gebäude. Ich gehe zwei Frauen im
132 Gang nach, in die Umkleide, unweit sehe ich eine WC-Tür mit dem Symbol
133 einer Frau. In der Umkleide ziehe ich meine Schuhe und Jacke aus, behalte
134 aber meine Jeans und meinen Pullover an. Dann gehe ich durch den Gang
135 Richtung Halle. Die Frauenumkleide ist näher am Haupteingang des
136 Gebäudes, die Männerumkleide ist der Sporthalle näher. An der
137 Männerumkleide vorbei (dessen Tür offensteht) husche ich in Richtung der
138 Halle, in der einige Menschen sind. Die Personen sind in der ganzen Halle
139 verstreut und bilden sich zu kleinen Gruppen zusammen, zu zweit, dritt, viert…
140 Das Netz ist schon aufgebaut.
141 Aus den Feldnotizen:
142 auf die Bank. Es wird allgemein
143 aufgewärmt - vor allem wird geredet und gelacht. Eine jüngere Frau und ein
144 etwas älterer Mann spielen sich mit zwei Bällen ein. Eine Frau und ein Mann
145 machen neben dem Halleneingang Sit-ups7 und unterhalten sich. Auf einer
146 Bank sitzen zwei Männer und eine Frau und reden. Einer isst Gummibärchen.
147 Auf der anderen Seite des Netzes wärmen sich zwei Männer auf, sie reden mit
148 einer etwas älteren Frau in Jacke, die auf der Bank sitzt. Ich bekomme zu
149 verstehen, dass sie sonst mitspielt, nur heute nicht.
150 Nach etwa 20 Minuten beginnt das Einpritschen8: Jeweils zwei Leute wärmen
151 sich mit dem Ball zusammen auf: viermal spielt eine Frau und ein Mann
152 zusammen; zweimal zwei Männer. Es sind mehr Männer als Frauen. Die
153 Kleidung der Frauen besteht zweimal aus langen, engen Sporthosen, auch
154 sehe ich zwei kurze enge Hosen - wobei kurz heißt, dass zwischen Hose und
155 Knie mehr als eine Hand Abstand ist und so weite Teile des Oberschenkels
156 sichtbar ist. Die Farben der Hosen sind meist schwarz, auch sehe ich einige in
157 grau und eine blau-gemusterte Hose. Die Kleidung der Männer unterscheidet
158 sich vor allem durch weiteren Stoff: ich sehe nur eine enge, kurze Hose, die
159 anderen sind weiter geschnitten. Bei sieben Männern ist die Hose leicht kürzer
160 als knielang, zwei der Hosen sind knielang. Fünf Männer haben keine
161 Knieschoner an - (vier Männer und alle vier Frauen haben Knieschoner an).
162 Die Farben der Männerhosen sind gemischt: Schwarz, rot, grau, blau.
163 Nach wiederum zehn Minuten pfeift einer: Einschlagen. Auf der einen Seite des
164 Netzes steht eine Zuspielerin, auf der anderen ein Zuspieler. Die anderen
165 Spieler*innen spielen den Ball zur/m Zusteller*in und bekommen den Ball
166 gestellt, um ihn über das Netz zu schlagen. Die beiden Zuspieler*innen
167 wechseln nach fünf Minuten mit jeweils dem gleichen Geschlecht.
168 Nach dem Einspielen kommen alle kurz zu mir zusammen, ich stelle mich
169 nochmal vor und beantworte Fragen, was ich hier mache. Danach verteilen
170 sodass sich jeweils zwei Frauen und vier
171 Männer auf beiden Seiten gegenüberstehen. Es sind insgesamt genau 12
172 Personen. Die Frau in der Jacke überlegt laut, ob die Frauen gerecht verteilt
173 sind. Sie sagt, die beiden Frauen auf der einen Seite seien stärker als die
174 beiden auf der anderen Seite. Der Kommentar findet keinen Anklang; Es wird
175 nicht getauscht und das Spiel fängt an.
176 Es herrscht gute Stimmung. Ich schaue eine Weile zu und nach einem Satz
177 spreche ich zwei Frauen an. Eine davon kenne ich aus alten Zeiten, die andere
178 ist jünger, sie geht wahrscheinlich noch zur Schule. Wir gehen der
179 Geräuschkulisse wegen in die Frauenumkleide, ich nehme das Gespräch auf.
180 (siehe Transkript 1)
181 Nach dem Gespräch gehen wir in die Halle zurück, wo gerade der erste Satz
182 zu Ende gespielt wurde. Ich frage nach zwei Männern und es kommen schnell
183 zwei zu mir. Wieder gehen wir für das Gespräch aus der Halle, diesmal setzen
184 wir uns in die Männerumkleide.
185 (siehe Transkript 2)
186 Feldtagebucheintrag 6.3.
187 Ich möchte heute Gespräche mit meinem Team führen. Dazu nehme ich das
188 Aufnahmegerät mit zum Training. Zu Anfang spreche ich mein Vorhaben an.
189 Um mich als Störfaktor möglichst gering zu halten, außerdem weil die die
190 Anwesenden diese Umgebung gewohnt sind und sie zum Thema passt,
191 möchte ich die Gespräche wieder während des Trainings abhalten. Auch
192 wurde mir bereits in Gesprächen deutlich gemacht, dass vor -und nachher
193 keine Zeit, beziehungsweise Lust besteht.
194 Dieses Vorgehen ist nicht optimal. Erstens werden die
195 Gesprächspartner*innen während des Gesprächs kalt, was den
196 Trainingsverlauf beeinflusst. Dass ich die Gesprächspartner*innen von ihrem
197 Hobby abhalte, kann dazu führen, dass die Erzählungen kürzer ausfallen, um
198 nicht zu viel Zeit zu verlieren.
199 ich während des Trainings, jedoch
200 reicht die Trainingszeit nicht mehr für das Gespräch mit den Männern, weshalb
201 wir das Gespräch erst nach dem Training anfangen. Meine Bedenken, ich halte
202 meine Teammitglieder auf, werden dadurch gemildert, dass ausgesagt wird,
203 vor dem Duschen brauche es sowieso eine gewisse Zeit, um
204 „Nachzuschwitzen“.
205 Feldtagebucheintrag vom 8.3.
206 Heute hatten wir ein Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft aus D. Nach
207 mehreren Fehlern in der Annahme nahmen wir eine Auszeit. Ein Teamkollege
208 sagte, wir machten zu viele Fehler, wobei die Aufschläge doch
209 „Mädchenaufschläge“ seien. An der Angabe war ein älterer Mann. Ich
210 bemerke: man muss kein Mädchen sein, um Mädchenaufschläge zu machen.
211 Diese zeichnen sich nicht unbedingt durch den Aufschlagspieler aus, wohl eher
212 durch die Geschwindigkeit und Flugbahn des Balls.
213 Nach dem Spiel (und dies ist keine Ausnahme) teilt ein Teamkollege Bier aus.
214 Ein Spieler der gegnerischen Mannschaft bekommt auch eines gereicht und es
215 wird miteinander geredet. Der Mann berichtet darüber, dass sich die
216 Mannschaft neue Trikots zulegen möchte. Das größte Problem sei dabei,
217 einheitliche Trikots für Männer und Frauen zu finden.
218 Eintrag vom 12.3.: Volleyball im allgemeinen Hochschulsport
219 Die Räumlichkeiten kenne ich bereits, da ich hier auch schon einige Male
220 mitgespielt habe. Während des laufenden Semesters muss ein gültiger
221 Studienausweis vorgezeigt werden, um die Anlage (Darin befinden sich
222 mehrere Sporthallen) betreten zu dürfen. Zu den Damenumkleiden geht es die
223 Treppe hoch. Ich ziehe meine Schuhe und Jacke aus. Straßenschuhe sind in
224 jeder Sporthalle ein Tabu. Auf dieser Ebene ist auch der Eingang in die Halle,
225 in der Volleyball gespielt wird.
226 In der Halle, bevor das Training startet – das Netz wird gerade aufgebaut -
227 gehe ich auf eine Gruppe von Leuten zu, die beim Netzaufbau unbeteiligt
228 einem Gruppengespräch, jedoch erklärt sich nur
229 eine Person bereit. Wir setzen uns in eine Ecke der Halle und führen das
230 Gespräch. (siehe Transkript Jana)
231 Nach dem Gespräch bleibe ich in der Halle, beobachte das Training und mache
232 mir Notizen: Das Einspielen ist „bunt gemischt“: Erst finde ich fünf
233 „Einspielpaare“, die aus einer Frau und einem Mann bestehen, ein rein
234 weibliches, sowie fünf rein männliche „Einspielpaare“. Die Halle füllt sich
235 kontinuierlich, und so verändert sich die Anzahl der Spieler*innen und
236 erschwert das Zählen. Kurz darauf zähle ich sieben gemischtgeschlechtliche
237 „Einspielpaare“. Die Männer sind deutlich in der Überzahl: Jetzt befinden sich
238 fünfzehn Männer und sechs Frauen in der Halle. Auch ich habe hier einige
239 Male trainiert. Es war immer sehr leicht, jemanden zum Einspielen zu finden.
240 Ob Frau oder Mann spielt dabei keine Rolle. Auch ist es nicht wichtig, dass sich
241 dabei nur zwei zusammenfinden. Die Anzahl der Spieler*innen ist nicht immer
242 gerade – und jede*r muss sich einspielen. Es wird eingeschlagen. Dafür
243 braucht es Zuspieler. Hier sind heute zwei Netze aufgebaut; es wird auf zwei
244 Feldern gespielt. Insgesamt werden vier Zuspieler gebraucht. Diese stehen auf
245 der Position 2 (am Netz) und stellen den Ball zum Schlagen. Ich zähle drei
246 Zuspieler und eine Zuspielerin.
247 Ich habe Zeit, die Klamotten zu begutachten. Es fällt auf, dass die Männer
248 etwas längere und lockerere Sporthosen tragen, als die Frauen. Mein Blick fällt
249 auf die Knieschoner. Nicht alle haben Knieschoner an und es scheint mir, dass
250 von den Männern weniger mit Knieschonern spielen. Ich zähle nach: Frauen
251 mit Knieschonern: vier; ohne: zwei. Männer mit Knieschonern: vier; ohne: elf.
252 Die Mehrheit der Frauen trägt Knieschoner, die Mehrheit der Männer trägt
253 keine.
254 Ich bleibe am Rand der Halle und warte, bis sich ein Spiel ergibt. Von hier habe
255 ich einen guten Blick über die beiden Felder, auf die sich die Spielerinnen und
256 Spieler verteilen. Ich habe mich nicht vorher angekündigt. Nicht alle wissen,
257 dass ich wegen eines Forschungsinteresses hier beobachte. Meine heutige
258 Forschung ist nur für diejenigen, die ich am Anfang gefragt habe, offen – wobei
259 Interviewpartnerin eine nähere Ahnung davon
260 haben kann, was mein Forschungsinteresse betrifft; Die Personen, die danach
261 die Halle betreten haben, wissen nicht von der Forschung und nehmen mich,
262 wenn sie mich in der großen Halle überhaupt bemerken, als wartende Person
263 wahr.
264 Es wird sich zum Spiel aufgestellt. Jede der zwölf Personen - wie aus dem
265 vorangegangenen Gespräch hervorgegangen ist – soll auf ihrer persönlich
266 favorisierten Position spielen. Ich kann hören, das auf dem „Leistungsfeld“
267 darüber geredet wird, dass eine „Mitte“ fehlt. Es gibt eine kurze Diskussion und
268 ein Spieler erklärt sich bereit, die Position zu wechseln. Das „Leistungsfeld“ ist
269 mit neun Männern und drei Frauen besetzt. Eine Frau auf der einen Seite des
270 Netzes, zwei auf der Anderen. Die Seite mit zwei Frauen gewinnt.
271 Auf dem anderen Feld spielen zehn Personen fünf-gegen-fünf, davon sieben
272 Männer und drei Frauen. Eine Frau kommt etwas später dazu und spielt auf
273 der Seite mit, auf der bisher eine Frau und vier Männer waren.
274 Eintrag vom 29. März
275 Bei einem Mixed-Trainingsspiel heute mit einer anderen Mannschaft meines
276 Vereins, habe ich überwiegend mit mir unbekannten Personen trainiert. Im
277 Spiel war ich gerade auf der Position 4, als ich gefragt wurde, ob ich blocke. Im
278 Damenvolleyball mussten Spielerinnen auf der Position 4 immer blocken, doch
279 beim Mixed wird es von Frauen nicht zwangsläufig verlangt.
[...]
1 Die Namen der Vereine, Orte sowie die der Personen wurden aus Datenschutzgründen verfremdet.
2 Der Paartanz erfordert eine Teilnahme beider Geschlechter; die Zusammensetzung der Teams folgt einer heterosexuellen Matrix (Müller 2006: 398).
3 Alle Namen von Personen, Orten und Vereinen wurden geändert.
4 Alle Namen von Vereinen, Stadtteilen und Personen wurden anonymisiert.
5 In der 1. Bundesliga präsentiert sich in der Saison 2018/2019 das Team der „Ladies in Black Aachen“ kleidungstechnisch am einheitlichsten. Hier stimmen nicht nur Trikots, Sporthosen und Knieschoner (wie bei den meisten Teams der 1. BL Frauen sowie Herren) überein, die „Ladies in Black Aachen“ präsentieren sich sogar mit einheitlichem Schuhwerk. (siehe Mannschaftsfoto © Andreas Steindl)
6 Ein Sportgerät; auch Turmkasten genannt.
7 Bauchmuskeltraining
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit über Mixed-Volleyball?
Diese Arbeit untersucht Humandifferenzierungen im Hobbybereich des Sports, insbesondere im Kontext von gemischtgeschlechtlichen Volleyballmannschaften. Es wird analysiert, wie die Kategorie Geschlecht in diesem Sport eine Rolle spielt, inwieweit Geschlechterdifferenzen betont werden und welche anderen Kategorien als leistungsrelevant angesehen werden.
Welche Methoden wurden für die Datenerhebung verwendet?
Es wurde eine teilnehmende Beobachtung durchgeführt, bei der die Forscherin selbst aktiv an Trainings und Spielen teilnahm und gleichzeitig Beobachtungen festhielt. Zusätzlich wurden informelle Gespräche und themenzentrierte Interviews mit den Mitgliedern der Volleyballmannschaften geführt.
Welche theoretischen Grundlagen werden für die Analyse verwendet?
Die Analyse basiert auf Theorien zur Humandifferenzierung, insbesondere auf den Erkenntnissen der Mainzer Forschungsgruppe Un/doing Differences. Der Fokus liegt auf der Kontingenzperspektive, die besagt, dass erst eine tatsächlich vollzogene Differenzierung einen Unterschied erzeugt.
Welche Formen der Differenzierung werden im Mixed-Volleyball beobachtet?
Neben der Geschlechterdifferenzierung, die in offiziellen Regeln, der materiellen Kultur (z.B. Umkleiden) und in sozialen Interaktionen (z.B. Aufteilung der Teams) sichtbar wird, spielen auch Alter, Körpergröße und Leistung eine Rolle. Es wird analysiert, wie diese Differenzierungen im Trainings- und Spielbetrieb zur Anwendung kommen.
Inwiefern beeinflusst der Leistungssport den Mixed-Volleyball?
Der Leistungssport dient als Vorbild und vermittelt Bewegungsformen, Wettkampfinteraktionen und Bekleidungsformen. Die Geschlechtersegregation im Leistungssport, mit ihren binären Geschlechterkategorien und der Unterbindung des Leistungsvergleichs zwischen den Geschlechtern, beeinflusst auch den Freizeitsport.
Welche Rolle spielt die Körpergröße im Mixed-Volleyball?
Eine geringe Körpergröße kann im Ligabetrieb ein Ausschlusskriterium darstellen. Im Mixed-Volleyball kann sie die Wahl der Positionen beeinflussen, wobei kleinere Spieler*innen oft als Zuspieler*innen oder Liberos eingesetzt werden.
Welche alternativen Leistungsklassen werden diskutiert?
Es werden zwei Vorschläge für alternative Leistungsklassen formuliert: Zum einen eine Liga, die die Inklusion nicht durch die Geschlechterzugehörigkeit, sondern durch eine (maximale) Körpergröße beschränkt, und zum anderen eine Aufhebung der binären Geschlechtlichkeit durch eine Regel, die Teams aus zwei Frauen und zwei Männern vorgibt, wobei das Geschlecht der zwei übrigen Spieler*innen egal ist.
Wie wird die Geschlechterdifferenz in der materiellen Kultur und in sozialen Interaktionen sichtbar?
Die Geschlechterdifferenz wird durch die Architektur der Sporthallen (getrennte Umkleiden), die Kleidung (längere Hosen für Männer, kürzere für Frauen) und in der Sprache (z.B. der Begriff "Mädchenaufschläge") hervorgebracht. Auch bei der Aufteilung der Mannschaften wird darauf geachtet, dass Frauen gleichmäßig verteilt sind und nicht nebeneinander stehen.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit?
Die Arbeit zeigt, dass die binär gedachte Kategorie Geschlecht den Sport auch im Hobbybereich, in dem die Geschlechter nicht segregiert werden, durchdringt. Obwohl andere leistungsrelevante Kategorien wie Körpergröße eine Rolle spielen, wird die Geschlechterdifferenz oft als Leitdifferenz verwendet. Die Forschung bietet Denkanstöße für alternative Leistungsklassen, die eine bessere Inklusion ermöglichen.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter, die zur Analyse der in der Sprachvorschau enthaltenen OCR-Daten verwendet werden?
Die Schlüsselwörter sind: Gender, Geschlecht, Sport, Soziologie, Ethnologie, Mixed-Volleyball, Humandifferenzierung, Leistungsklassen, soziale Ungleichheit, Kategorisierung, Teilhabe, Inklusion.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Unterschiede und Unterscheidungen beim Mixed-Volleyball, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513551