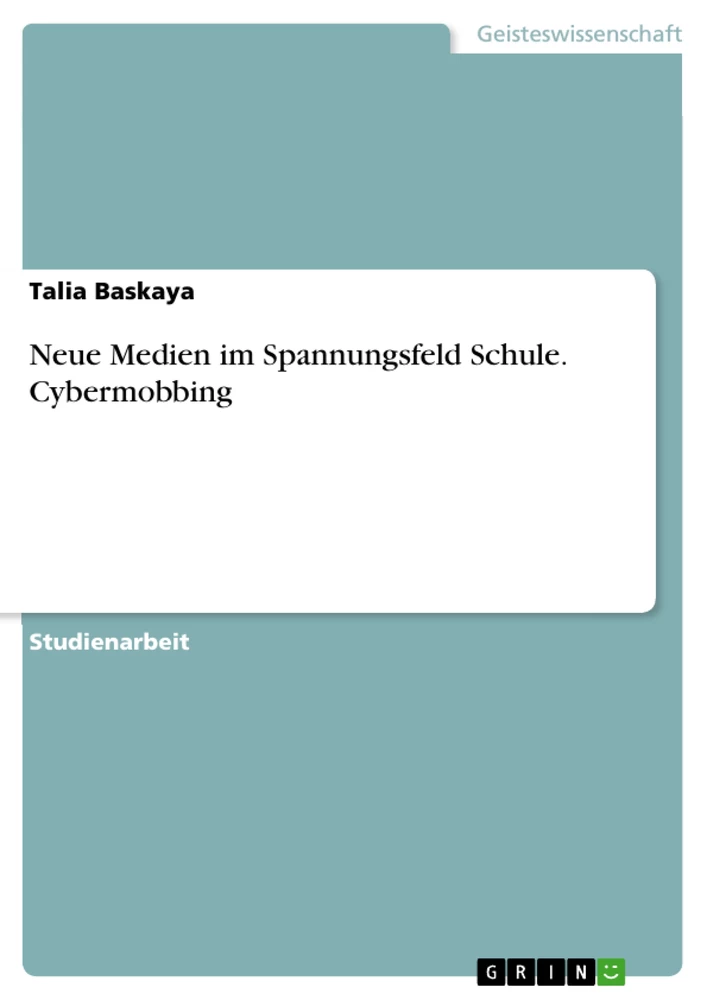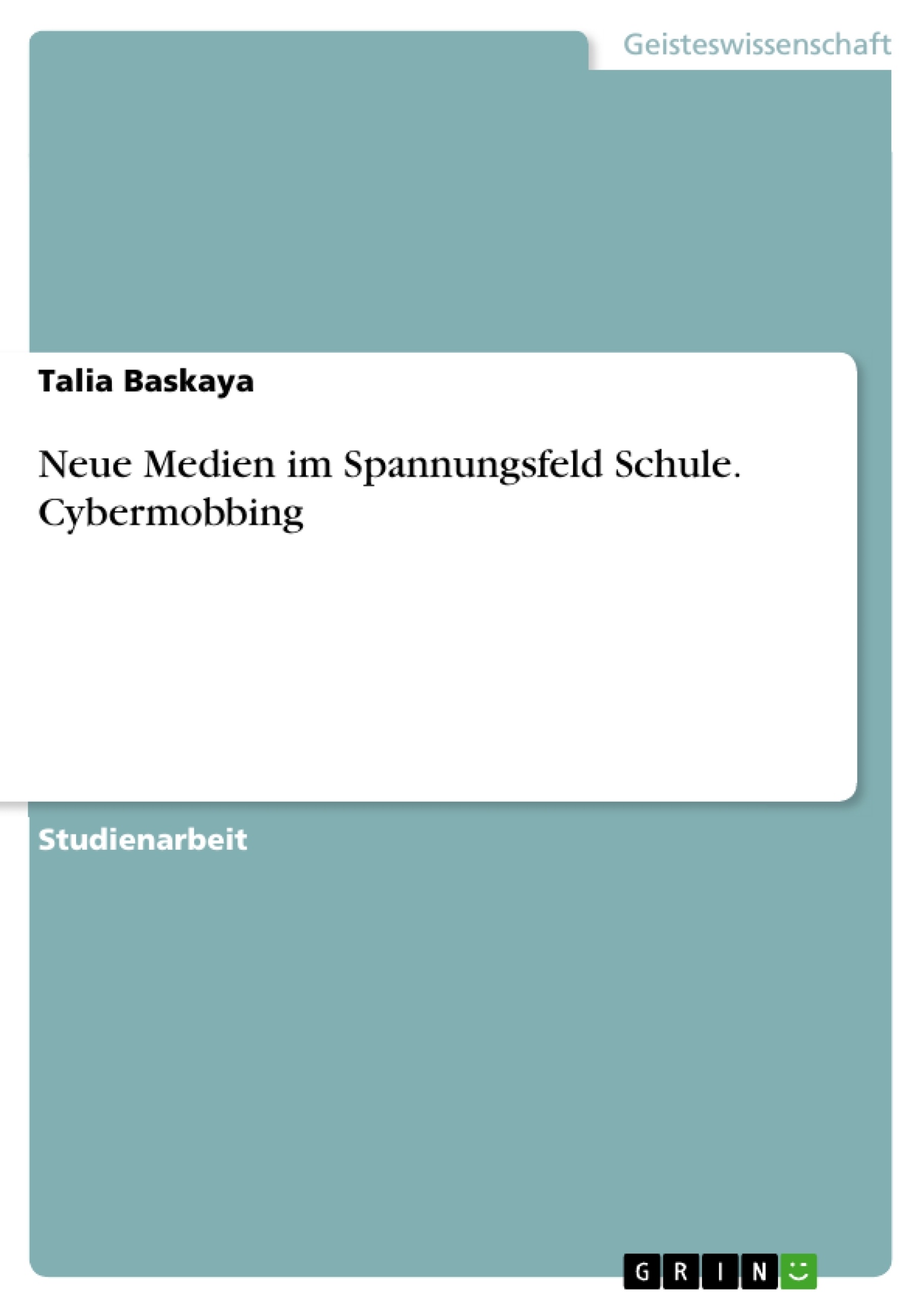Die altbekannten Konflikte, die von Schikane, Mobbing und Bullying ausgehen, verlagern sich heutzutage immer mehr auf die interaktiven Medien, welche wir täglich nutzen. Während Computer, Smartphones und damit vor allem das Internet zu einem großen Teil unseres Alltages wurden, übertrugen sich Probleme wie Stalking oder Mobbing in die virtuelle Welt und schufen gleichzeitig auch neuere Formen der Schikane. Die folgende Ausarbeitung wird sich auf die Texte „Mobbing im Medienkontext“ von Christa Kodelej, „Das Phänomen Cyberbullying – Genderaspekte und medienethische Konsequenzen“ von Catarina Katzer sowie „The Dark Side of Cyberspace“ von Cynthia Carter und C. Kay Weaver beziehen und außerdem mit den Studien der Internetseite www.eukidsonline.net, der Aufklärungsbroschüre bezüglich Happy Slapping des Jugendstadtrats Neukölln und dem Zeitungsartikel „Die Eltern pöbeln mit“ von SPIEGEL online aus dem Jahr 2011 beschäftigen. Zunächst werden die Formen von Belästigung durch neue Medien dargelegt, im weiteren Verlauf sollten ebenso die möglichen Motive behandelt werden. Ferner werden die Begriffe Mobbing und Bullying differenziert und die Unterschiede zu traditionellem Mobbing dargelegt. Hinzu kommt ein Ausblick auf die Auswirkungen, Möglichkeiten der Prävention und ebenso die Gesetzeslage, um schlussendlich die Hauptthematik Cybermobbing und -bullying anhand aktueller Beispiele abzuschließen. Im Laufe der folgenden Hausarbeit wird der Begriff „Mobbing“ synonym für Mobbing sowie Bullying verwendet. Eine entsprechende Differenzierung findet im Laufe der Ausarbeitung statt, jedoch wird die Verwendung vermieden, um einen konstanten Lesefluss sicherstellen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formen der Belästigung
- Motive
- Begriffserklärung
- Auswirkungen
- Prävention
- Gesetzeslage
- Fazit und aktuelle Bezüge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Cybermobbing, seine Formen, Motive und Auswirkungen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis dieses Phänomens im Kontext neuer Medien zu entwickeln und Präventionsmöglichkeiten aufzuzeigen.
- Formen von Cybermobbing (Cyberhate, Cyberstalking, sexuelle Belästigung, Cyberpädophilie)
- Motive von Tätern (Anonymität, Machtdemonstration, Rache, Gruppenzwang)
- Auswirkungen auf Opfer (psychische Belastung, soziale Isolation)
- Präventionsmaßnahmen (technische und soziale Strategien)
- Relevanz der Gesetzeslage
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Cybermobbings ein und verortet es im Kontext der zunehmenden Nutzung interaktiver Medien. Sie benennt die zentralen Quellen der Arbeit und skizziert den Aufbau der Untersuchung, der sich mit den Formen der Belästigung, den Motiven der Täter, der Begriffsbestimmung, den Auswirkungen, Präventionsmöglichkeiten und der Gesetzeslage auseinandersetzt. Die Arbeit verwendet den Begriff "Mobbing" synonym für Mobbing und Bullying, wobei eine explizite Differenzierung im weiteren Verlauf stattfindet.
Formen der Belästigung: Dieses Kapitel beschreibt die vielfältigen Formen von Online-Belästigung, die sich aus der Nutzung neuer Medien ergeben. Es differenziert zwischen Cyberhate (mit Beispielen wie Happy Slapping, Nicknapping und Hass-Webseiten), Cyberstalking (einschliesslich Computerstalking), sexueller Belästigung und Cyberpädophilie. Besonders wird die Ausweitung traditioneller Mobbingformen in den digitalen Raum herausgestellt und die Rolle sozialer Netzwerke, Videoplattformen und Chatrooms in diesem Zusammenhang analysiert. Der Text betont die leicht zugängliche Verbreitung solcher Inhalte und die oft schwer zu entdeckenden Hass-Webseiten, die insbesondere Kinder und Jugendliche gefährden. Die Beispiele verdeutlichen, wie verschiedene Formen der Online-Belästigung kombiniert werden können und welche weitreichenden Auswirkungen sie haben.
Motive: Dieses Kapitel untersucht die Beweggründe von Tätern beim Cybermobbing. Die Anonymität des Internets, die Leichtigkeit der Ausführung, die geringe Wahrscheinlichkeit einer Bestrafung und das Fehlen von direkter Konfrontation werden als entscheidende Faktoren genannt. Der Text diskutiert die Rolle von Empathiemangel und die Abwertung der eigenen Handlungen durch Täter. Weiterhin werden Motive wie Machtdemonstration, Angst vor eigener Viktimisierung, Rache, der Wunsch nach Anerkennung, Selbsterleichterung und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls beleuchtet. Die Frage nach einem typischen Opferverhalten und die besondere Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch Täuschung und den Zugang zu Hass-Webseiten werden ebenfalls thematisiert.
Begriffserklärung: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Differenzierung der Begriffe "Mobbing" und "Bullying". Es bezieht sich auf die Definition von Heinz Leymann, die Mobbing als einen zermürbenden, sich wiederholenden Handlungsablauf beschreibt, der ein Machtungleichgewicht schafft und zur Isolation des Opfers führt. Der Fokus liegt dabei auf dem spezifischen Kontext neuer Medien und der Definition von Cyberbullying als gezielte, schädigende Handlung mit wiederholter Nutzung elektronischer Medien.
Schlüsselwörter
Cybermobbing, Cyberbullying, neue Medien, Internet, soziale Netzwerke, Mobbing, Bullying, Anonymität, Prävention, Gesetzeslage, Opfer, Täter, Motive, Auswirkungen, Cyberhate, Cyberstalking, sexuelle Belästigung, Happy Slapping, Nicknapping, Hass-Webseiten.
Häufig gestellte Fragen zu: Cybermobbing - Formen, Motive und Auswirkungen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Cybermobbing. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Einleitung, Formen der Belästigung, Motive, Begriffserklärung, Auswirkungen, Prävention, Gesetzeslage, Fazit und aktuelle Bezüge) sowie eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Welche Formen von Cybermobbing werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Formen von Cybermobbing, darunter Cyberhate (mit Beispielen wie Happy Slapping, Nicknapping und Hass-Webseiten), Cyberstalking, sexuelle Belästigung und Cyberpädophilie. Es wird die Ausweitung traditioneller Mobbingformen in den digitalen Raum und die Rolle sozialer Netzwerke, Videoplattformen und Chatrooms analysiert.
Welche Motive haben Cybermobbing-Täter?
Die Motive von Tätern werden als vielschichtig beschrieben. Anonymität des Internets, Leichtigkeit der Ausführung, geringe Wahrscheinlichkeit der Bestrafung und Fehlen direkter Konfrontation werden als entscheidende Faktoren genannt. Weitere Motive sind Machtdemonstration, Angst vor eigener Viktimisierung, Rache, der Wunsch nach Anerkennung, Selbsterleichterung und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Empathiemangel und die Abwertung der eigenen Handlungen durch die Täter werden ebenfalls diskutiert.
Wie werden die Begriffe "Mobbing" und "Bullying" definiert?
Das Dokument bezieht sich auf die Definition von Heinz Leymann, die Mobbing als einen zermürbenden, sich wiederholenden Handlungsablauf beschreibt, der ein Machtungleichgewicht schafft und zur Isolation des Opfers führt. Cyberbullying wird als gezielte, schädigende Handlung mit wiederholter Nutzung elektronischer Medien definiert.
Welche Auswirkungen hat Cybermobbing auf die Opfer?
Die Auswirkungen auf Opfer werden als schwerwiegend beschrieben und umfassen psychische Belastung und soziale Isolation.
Welche Präventionsmaßnahmen werden genannt?
Das Dokument erwähnt sowohl technische als auch soziale Strategien zur Prävention von Cybermobbing, geht aber nicht im Detail darauf ein.
Wie wird die Gesetzeslage zum Thema Cybermobbing behandelt?
Das Dokument erwähnt die Relevanz der Gesetzeslage, geht aber nicht im Detail auf spezifische Gesetze ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Cybermobbing, Cyberbullying, neue Medien, Internet, soziale Netzwerke, Mobbing, Bullying, Anonymität, Prävention, Gesetzeslage, Opfer, Täter, Motive, Auswirkungen, Cyberhate, Cyberstalking, sexuelle Belästigung, Happy Slapping, Nicknapping, Hass-Webseiten.
Wie ist der Aufbau des Dokuments?
Das Dokument beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und den Aufbau der Arbeit skizziert. Es folgen Kapitel zu den Formen der Belästigung, den Motiven der Täter, der Begriffserklärung, den Auswirkungen, Präventionsmöglichkeiten und der Gesetzeslage. Das Dokument schließt mit einem Fazit und aktuellen Bezügen (nicht im Detail beschrieben).
- Quote paper
- Talia Baskaya (Author), 2016, Neue Medien im Spannungsfeld Schule. Cybermobbing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513421