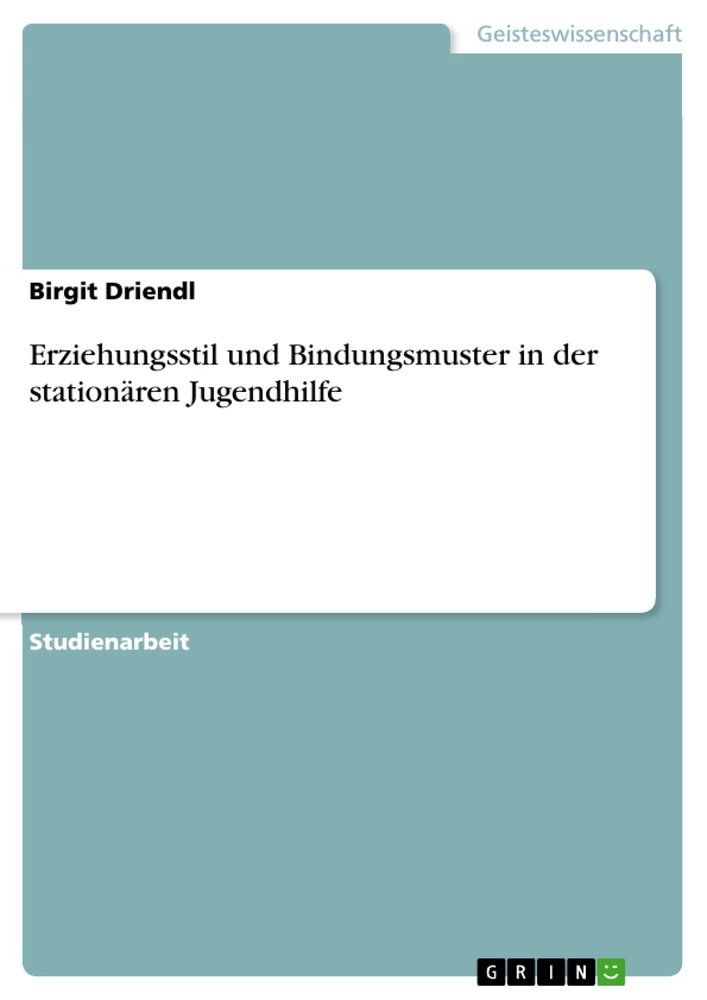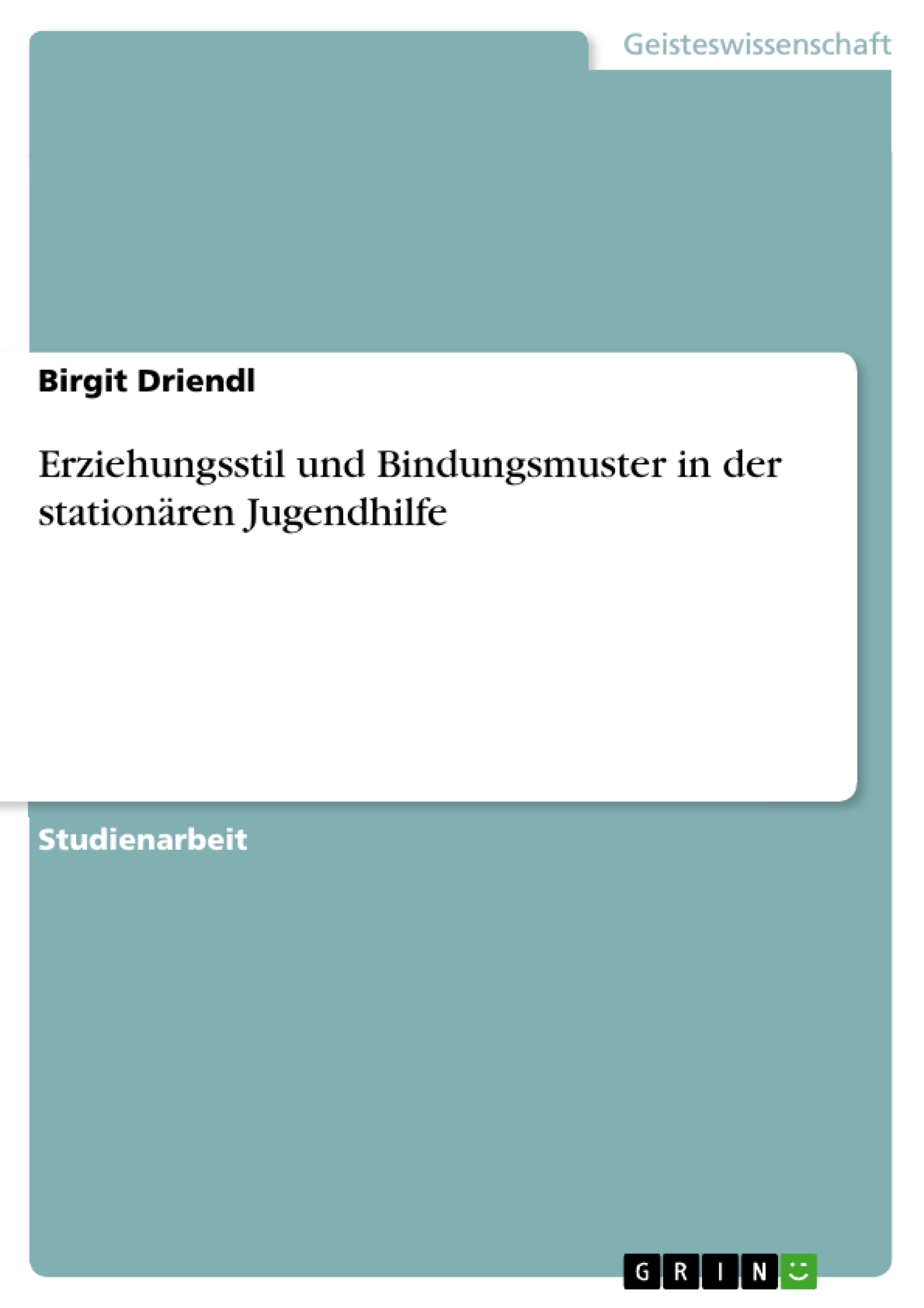Diese Arbeit untersucht, welche Bindungsmuster Jugendliche in stationärer Jugendhilfe haben und ob der Erziehungsstil der Fachkräfte einen Einfluss auf die Entwicklung der Bindungsfähigkeit haben kann. Relevant ist dies, weil es zu verstehen gilt, welchen Einfluss frühe Bindungen auf die Entwicklung des Kindes haben.
Die Bindungstheorie, welche von dem englischen Psychoanalytiker und Kinderpsychiater John Bowlby (1907-1990) bereits in den 1950er und 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts formuliert und in den nächsten Jahrzehnten durch die Erkenntnisse der Bindungsforschung weiterentwickelt wurde, beschäftigt sich mit dem Einfluss von Bindungserfahrungen auf die Anpassungsfähigkeit und somit auf die Entwicklung seelischer Gesundheit bzw. Krankheit. Die Bindungstheorie beschäftigt sich mit den Bedingungen und Kriterien, welche sowohl zu einer gesunden Persönlichkeit als auch zu Entwicklungsbeeinträchtigungen und Störungen der Persönlichkeit führen, und thematisiert damit nicht nur die Inhalte und Probleme der sozialen Arbeit, sondern bietet auch effektive Lösungsansätze an. Deshalb stellt die Bindungstheorie den Bezugsrahmen für das Thema dieser Arbeit dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bindungstheorie nach John Bowlby
- 2.1 Bindungsverhalten - Explorationsverhalten
- 2.2 Feinfühligkeit und Bindungsqualität
- 3. Definition Heimerziehung und rechtliche Grundlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie der Erziehungsstil von Fachkräften die Bindungsmuster von Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe beeinflusst. Sie untersucht die Auswirkungen früher Bindungserfahrungen auf die Entwicklung des Kindes und stellt die Bindungstheorie nach John Bowlby vor. Die Arbeit analysiert die Problematik der Bindungsunsicherheit und -störung in der Heimerziehungspraxis und erforscht die Rahmenbedingungen, die für eine sichere Bindungsentwicklung erforderlich sind.
- Einfluss früher Bindungserfahrungen auf die Entwicklung des Kindes
- Bindungstheorie nach John Bowlby
- Bindungsunsicherheit und -störung in der Heimerziehungspraxis
- Rahmenbedingungen für eine sichere Bindungsentwicklung
- Bedeutung von Feinfühligkeit und stabilen Bezugspersonen in der stationären Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Relevanz des Themas Bindung in der stationären Jugendhilfe dar. Sie gibt einen Überblick über die Forschungsmethodik und die Struktur der Arbeit. - Kapitel 2: Bindungstheorie nach John Bowlby
Dieses Kapitel beleuchtet die Bindungstheorie nach John Bowlby. Es beschreibt das Konzept des Bindungsverhaltens, die Bedeutung der Feinfühligkeit für die Entwicklung einer sicheren Bindung und die Auswirkungen unterschiedlicher Bindungsqualitäten auf die psychosoziale Entwicklung. - Kapitel 3: Definition Heimerziehung und rechtliche Grundlage
Kapitel 3 definiert den Begriff der Heimerziehung und beleuchtet die rechtlichen Grundlagen in Bezug auf das SGB VIII. Es analysiert die Herausforderungen der Heimerziehung im Kontext von Schichtdienst, Fluktuation und den daraus resultierenden Schwierigkeiten, stabile Bezugspersonen zu etablieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern Bindungstheorie, Heimerziehung, Bindungsunsicherheit, Bindungsqualität, Feinfühligkeit, Erziehungsstil, Fachkräfte und Jugendhilfe. Die zentralen Konzepte sind die Entwicklung einer sicheren Bindung in der Kindheit, die Bedeutung stabiler Bezugspersonen und die Herausforderungen, die aus der Arbeit in stationären Einrichtungen resultieren. Weitere wichtige Begriffe sind Explorationsverhalten, psychopathologische Auffälligkeiten und die Auswirkungen von Bindungserfahrungen auf die psychosoziale Entwicklung.
- Quote paper
- Birgit Driendl (Author), 2019, Erziehungsstil und Bindungsmuster in der stationären Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513288