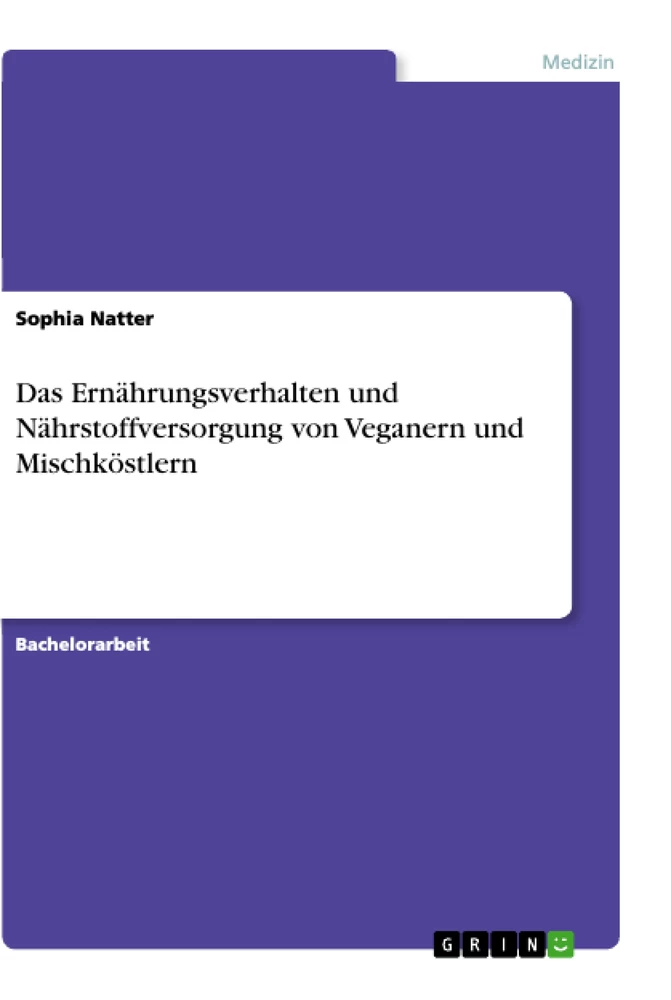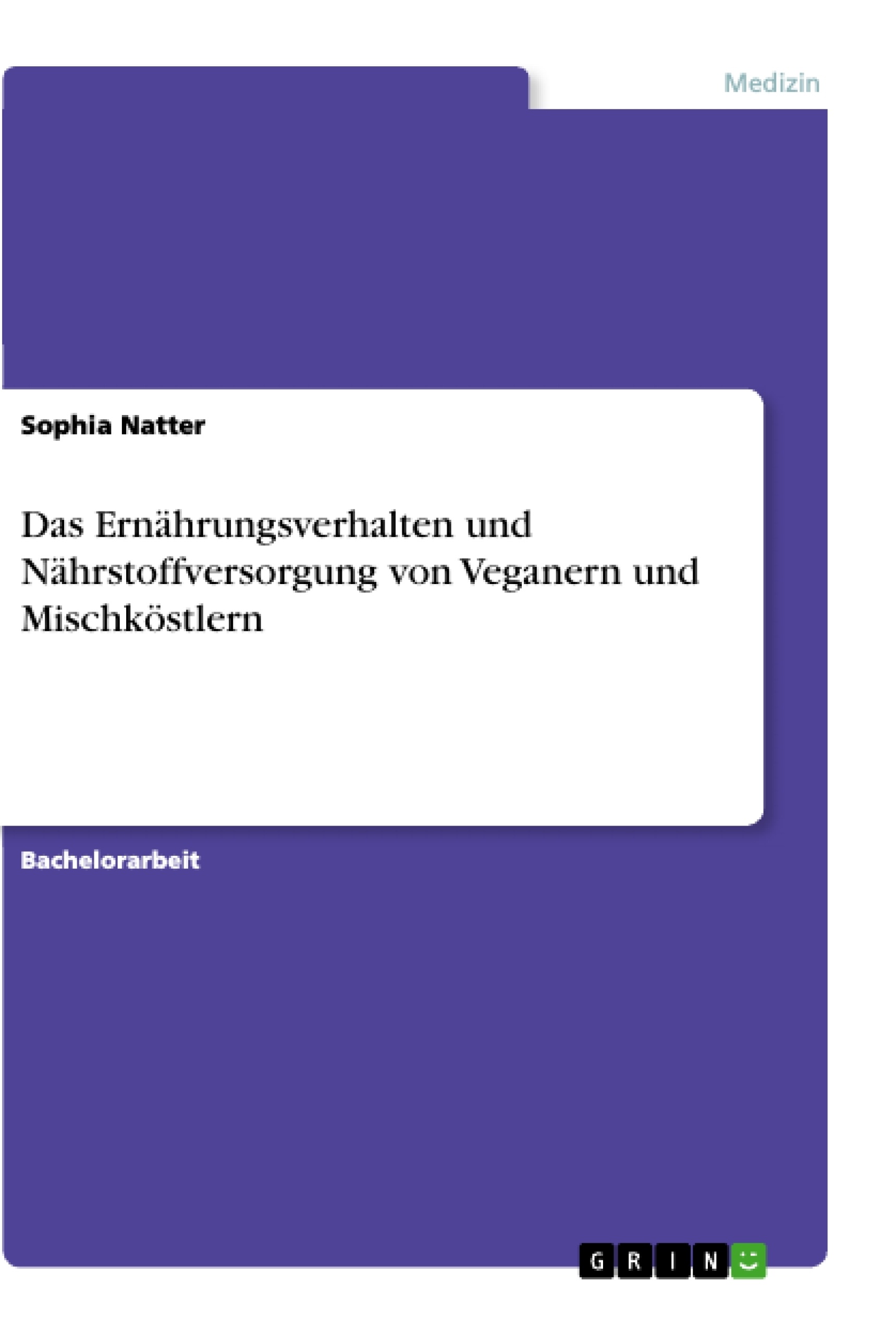Diese empirische Arbeit vergleicht die Versorgung von Nährstoffe zwischen sich vegan und sich omnivor ernährenden Menschen. Fünfzehn Veganer/innen und fünfzehn Mischköstler/innen protokollierten zur Sammlung der auszuwertenden Daten drei Tage lang ihre Ernährung und füllten einen Fragebogen bezüglich ihres Lebensstils und ihres Gesundheitsverhaltens aus.
Die vegane Ernährung boomt. Die rasante Entwicklung der Popularität des Veganismus wird bestätigt von unterschiedlichen Studien. Im Jahr 2008 ernährten sich, laut der nationalen Verzehrsstudie II, 80.000 Menschen in Deutschland vegan. Acht Jahre später hatte sich die Zahl der sich vegan ernährenden Deutschen mehr als versechszehnfacht auf insgesamt 1,3 Millionen. Der stark wachsenden Ernährungsform begegnet auch Kritik. Sie steht im Verdacht unterschiedliche Nährstoffe in nicht ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen und somit zu einem Mangel an bestimmten Nährstoffen zu führen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung verfasste 2016 eine Position zur veganen Ernährung in welcher sie betonte, dass eine ausreichende Bedarfsdeckung bestimmter Nährstoffe mit einer rein pflanzlichen Ernährung nicht oder nur schwer möglich sei. Inwieweit die Aussage auch empirisch belegbar ist, untersucht diese Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Definition Veganismus und Mischkost
- 3.1.1 Definition Veganismus
- 3.1.2 Definition Mischkost
- 3.2 Entwicklung und Häufigkeit des Veganismus
- 3.3 Entwicklung und Häufigkeit der Mischkost
- 3.4 Motive für eine vegane Ernährung
- 3.4.1 Gesundheitliche Motive
- 3.4.2 Ethisch-moralische Motive
- 3.4.3 Religiös-spirituelle Motive
- 3.4.4 Ökologische Motive
- 3.4.5 Soziale Motive
- 3.5 Motive für eine omnivore Ernährung
- 3.6 Studienlage zu gesundheitlichen Auswirkungen der veganen Ernährung
- 3.6.1 Positionen zur veganen Ernährung und ihr Einfluss auf die Gesundheit
- 3.6.2 Darstellung potenzieller Nährstoffmängel für vegan lebende Menschen
- 3.6.4 Makronährstoffe
- 3.6.4.1 Lipide, bezogen auf Omega 3
- 3.6.4.2 Protein
- 3.6.5 Fettlösliche Vitamine
- 3.6.5.1 Vitamin A
- 3.6.5.2 Vitamin D
- 3.6.6 Wasserlösliche Vitamine
- 3.6.6.1 Riboflavin (B2)
- 3.6.6.2 Niacin (B3)
- 3.6.6.3 B12
- 3.6.7 Mineralstoffe
- 3.6.7.1 Calcium
- 3.6.7.2 Eisen
- 3.6.7.3 Jod
- 3.6.7.4 Selen
- 3.6.7.5 Zink
- 3.6.4 Makronährstoffe
- 3.7 Studienlage zu gesundheitlichen Auswirkungen der omivoren Ernährung
- 3.1 Definition Veganismus und Mischkost
- 4 Methodik
- 4.1 Beschreibung der Auswahl und Rekrutierung der Versuchsgruppe
- 4.2 Beschreibung der Versuchsgruppe
- 4.3 Ein- und Ausschlusskriterien der Teilnehmenden
- 4.4 Entwicklung des Anamnese-Fragebogens
- 4.5 Entwicklung der Ernährungsprotokolle
- 4.6 Beschreibung der Vorgehensweise zur Auswertung des Anamnese-Fragebogens und des Ernährungsprotokolls
- 4.6.1 Beschreibung der Vorgehensweise zur Auswertung der Fragebögen
- 4.6.2 Beschreibung der Vorgehensweise zur Auswertung der Ernährungsprotokolle
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Ergebnisse der Fragebögen
- 5.2 Ergebnisse der Ernährungsprotokolle
- 6 Diskussion
- 6.1 Kritische Betrachtung der erhobenen Ergebnisse
- 6.2 Bewertung der Methodik
- 6.2.1 Datenschutz
- 6.2.2 Auswahl der Medien/Systeme
- 6.2.3 Aussagekraft der empirischen Arbeit
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Nährstoffbedarf von Veganern im Vergleich zu Mischköstlern. Das Hauptziel ist es, zu überprüfen, ob Veganer ihren Bedarf an ausgewählten Nährstoffen ausreichend decken können und ob sich die Nährstoffversorgung zwischen beiden Gruppen unterscheidet. Die Arbeit trägt somit zur aktuellen Diskussion um die gesundheitlichen Auswirkungen veganer Ernährung bei.
- Vergleich der Nährstoffversorgung von Veganern und Mischköstlern
- Analyse potenzieller Nährstoffmängel bei veganer Ernährung
- Bewertung der Deckung des Nährstoffbedarfs anhand der DGE-Empfehlungen
- Methodische Betrachtung der Datenerhebung und -auswertung
- Diskussion der Ergebnisse im Kontext der aktuellen wissenschaftlichen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung beschreibt den starken Anstieg veganer Ernährung in Deutschland und die damit verbundene kritische Auseinandersetzung mit möglichen Nährstoffmängeln. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach dem Vergleich der Nährstoffversorgung zwischen Veganern und Mischköstlern und skizziert die Methodik der Untersuchung.
2 Zielsetzung: Dieses Kapitel definiert das zentrale Ziel der Arbeit: die Untersuchung der Nährstoff- und Energiebedarfsdeckung bei Veganern im Vergleich zu Mischköstlern. Zwölf kritische Nährstoffe werden spezifisch betrachtet, und die Vergleichsdaten werden mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) abgeglichen.
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über Definitionen von Veganismus und Mischkost, die Entwicklung und Häufigkeit beider Ernährungsformen, sowie die dahinterstehenden Motive. Es wird ausführlich auf die Studienlage zu den gesundheitlichen Auswirkungen veganer Ernährung eingegangen, einschließlich potenzieller Nährstoffmängel und der Positionen verschiedener Organisationen zu diesem Thema. Die Studienlage zur gesundheitlichen Auswirkungen einer omnivoren Ernährung wird ebenfalls beleuchtet.
4 Methodik: Hier wird die Methodik der empirischen Arbeit detailliert beschrieben. Dies beinhaltet die Auswahl und Rekrutierung der Probanden (Veganer und Mischköstler), die Entwicklung eines Anamnese-Fragebogens und Ernährungsprotokolle, sowie die Vorgehensweise bei der Auswertung der gesammelten Daten. Die Methoden zur Datenerhebung und -analyse werden genau erklärt.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung. Die Ergebnisse der Fragebögen (z.B. BMI, Motive, Lebensstil, Gesundheit) und die Ergebnisse der Ernährungsprotokolle (Nährstoffzufuhr) für beide Gruppen werden im Detail dargestellt und analysiert.
6 Diskussion: Die Diskussion analysiert die erhobenen Ergebnisse kritisch, bewertet die Methodik der Studie und diskutiert die Aussagekraft der Ergebnisse im Kontext der bestehenden Literatur und der Forschungsfrage. Aspekte wie Datenschutz und die Auswahl der verwendeten Methoden werden kritisch hinterfragt.
Schlüsselwörter
Veganismus, Mischkost, Nährstoffversorgung, Energiebedarf, DGE-Empfehlungen, Nährstoffmängel, empirische Untersuchung, Ernährungsverhalten, Gesundheit, Lebenstil.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Nährstoffversorgung von Veganern im Vergleich zu Mischköstlern
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Nährstoffversorgung von Veganern im Vergleich zu Personen mit einer Mischkost. Sie konzentriert sich auf die Frage, ob Veganer ihren Bedarf an wichtigen Nährstoffen ausreichend decken und ob sich die Nährstoffversorgung zwischen beiden Gruppen unterscheidet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist der Vergleich der Nährstoff- und Energiebedarfsdeckung zwischen Veganern und Mischköstlern. Die Arbeit analysiert potenzielle Nährstoffmängel bei veganer Ernährung und bewertet die Deckung des Nährstoffbedarfs anhand der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).
Welche Nährstoffe werden speziell untersucht?
Die Arbeit betrachtet zwölf kritische Nährstoffe, die bei veganer Ernährung potenziell unzureichend aufgenommen werden können. Die konkreten Nährstoffe werden im Kapitel 3 detailliert aufgeführt (z.B. verschiedene Vitamine und Mineralstoffe).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung und Problemstellung, Zielsetzung, Gegenwärtiger Kenntnisstand, Methodik, Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung. Der Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Methodik. Es wurden Veganer und Mischköstler rekrutiert, Anamnese-Fragebögen und Ernährungsprotokolle entwickelt und die Daten anschließend ausgewertet. Die detaillierte Beschreibung der Methodik, einschließlich der Auswahl der Probanden und der Datenauswertung, findet sich in Kapitel 4.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Fragebögen (z.B. BMI, Motive, Lebensstil, Gesundheit) und der Ernährungsprotokolle (Nährstoffzufuhr) für beide Gruppen. Eine detaillierte Analyse dieser Ergebnisse findet sich ebenfalls in diesem Kapitel.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse kritisch, bewertet die Methodik der Studie und hinterfragt die Aussagekraft der Ergebnisse im Kontext bestehender Literatur. Aspekte wie Datenschutz und die Auswahl der Methoden werden kritisch beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Veganismus, Mischkost, Nährstoffversorgung, Energiebedarf, DGE-Empfehlungen, Nährstoffmängel, empirische Untersuchung, Ernährungsverhalten, Gesundheit, Lebensstil.
Welche Definitionen von Veganismus und Mischkost werden verwendet?
Die Arbeit liefert präzise Definitionen von Veganismus und Mischkost im Kapitel 3.1. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die gesamte Untersuchung.
Wie wird die Studienlage zu den gesundheitlichen Auswirkungen von veganer und omnivorer Ernährung berücksichtigt?
Kapitel 3 bietet einen ausführlichen Überblick über die Studienlage zu den gesundheitlichen Auswirkungen beider Ernährungsformen. Es werden verschiedene Positionen und potenzielle Nährstoffmängel bei veganer Ernährung diskutiert.
Wie werden die Daten ausgewertet?
Die Vorgehensweise zur Auswertung der Fragebögen und Ernährungsprotokolle wird detailliert in Kapitel 4.6 beschrieben. Die Methoden zur Datenerhebung und -analyse werden genau erklärt.
- Quote paper
- Sophia Natter (Author), 2019, Das Ernährungsverhalten und Nährstoffversorgung von Veganern und Mischköstlern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512878