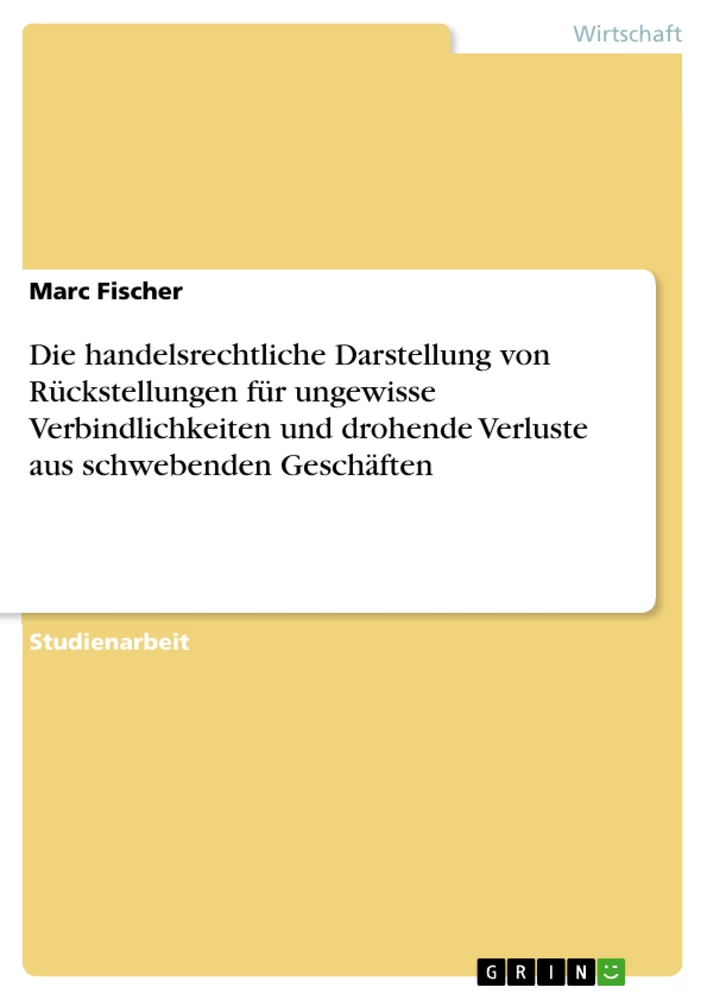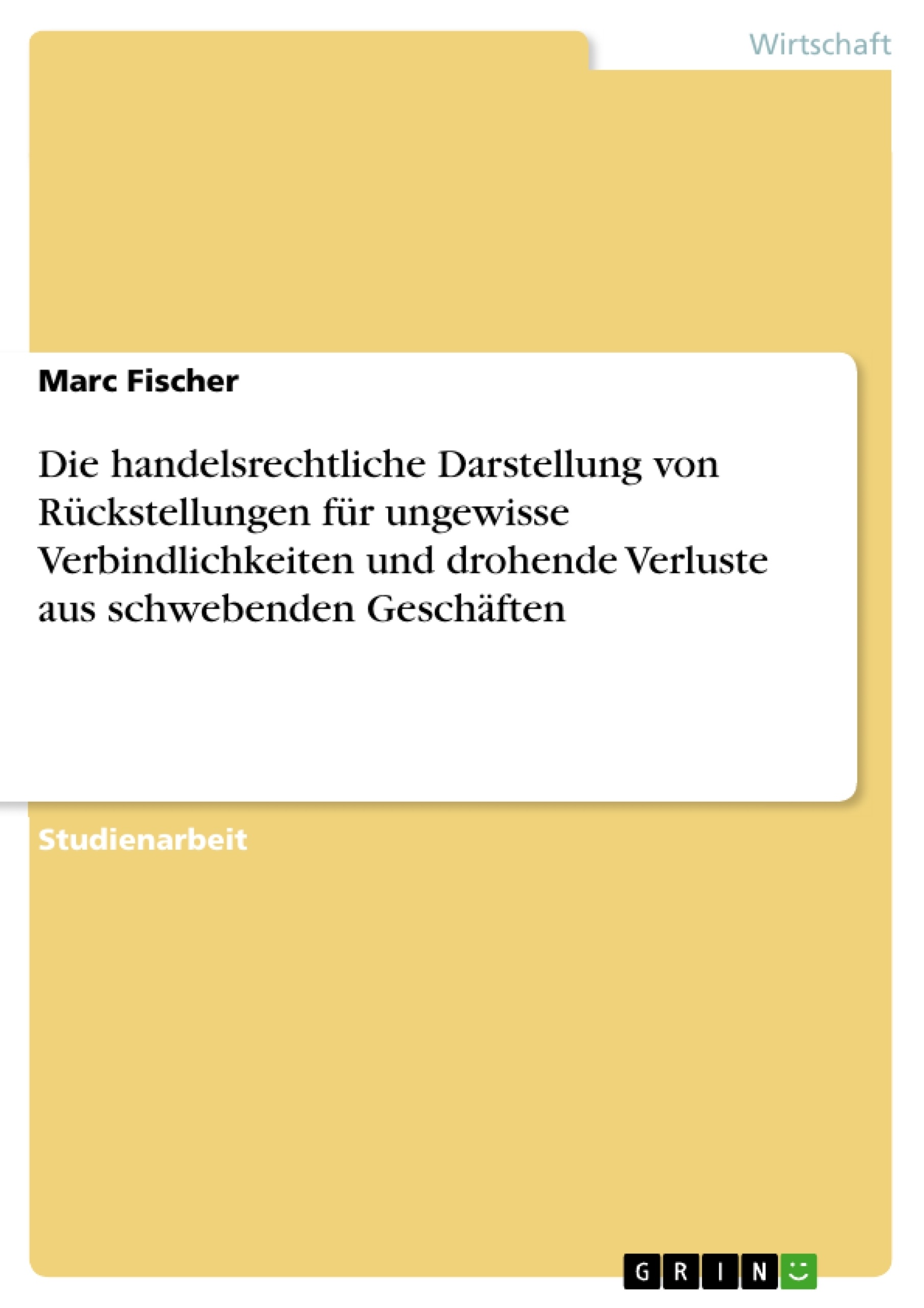Für ein Unternehmen soll ein System eingeführt werden, mit dem die geleisteten Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen erfasst werden können und somit auch eine angemessene Beurteilung der Verbindlichkeiten zum Jahresabschluss erfolgen kann. Als Ergänzung zu den Pauschalwertrückstellungen sollen auch die Möglichkeiten von Einzelwertrückstellungen untersucht werden, damit die drohenden Verbindlichkeiten möglichst exakt dargestellt werden können. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich lediglich mit der handelsrechtlichen Darstellung dieser Rückstellungen, womit steuerrechtliche Aspekte und die internationale Rechnungslegung außer Acht bleiben. Durch den Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit hat sich eine freiere Bilanzierung nach Steuerrecht ergeben, wodurch sich diese von der handelsrechtlichen Bilanzierung entfernt hat. In der internationalen Rechnungsstellung werden Rückstellungen in dem Standard IAS 37 geregelt. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen der Bilanzierung von Rückstellungen nach Handelsrecht erläutert, welche dann mithilfe konstruierter Beispiele dargestellt werden.
Nach § 249 Abs. 1 HGB müssen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet werden. Diese Aufwendungen sind nach dem Prinzip der periodengerechten Abgrenzung dem Geschäftsjahr der Entstehung der Verbindlichkeit zuzuordnen. Im Gegensatz zu dem Realisationsprinzip, nach welchem nur realisierte Gewinne ausgewiesen werden dürfen, wird bei Rückstellungen das Imparitätsprinzip angewandt, welches den Ausweis von nicht realisierten, aber zu erwartenden Verlusten verlangt.
Für Sach- und Rechtsmängel nach § 633 BGB besteht nach § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB eine zweijährige gesetzliche Gewährleistungsfrist, soweit diese nicht durch allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) oder vertragliche Einzelabsprachen eingeschränkt wird. § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB verlangt die Bildung von Rückstellungen für diese drohenden Verpflichtungen. Abgesehen von gesetzlichen Ansprüchen können Unternehmen auch freiwillige Garantieverpflichtungen nach § 443 BGB anbieten, für welche nach § 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 HGB ebenfalls eine Rückstellung zu bilden ist. Nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB sind Rückstellungen mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen. Als Grundlage dieser Beurteilung dienen vor allem Erfahrungswerte aus der Branche oder dem eigenen Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Gewährleistung
- Garantie
- Rückstellung
- Bewertungsgrundlagen und -kriterien
- Rückstellungsarten
- Einzelwertrückstellungen
- Pauschalwertrückstellungen
- Allgemeine Bewertungskriterien
- Prinzip der periodengerechten Abgrenzung
- Imparitätsprinzip
- Bewertungskriterien der Ansatzhöhe
- Vernünftige kaufmännische Beurteilung
- Erfüllungsbetrag
- Zeitliche Bewertungskriterien
- Bestimmung der Restlaufzeit
- Abzinsung
- Rückstellungsarten
- Analyse
- Darstellung der Unternehmenssituation
- Dokumentation von geleisteten Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen
- Auswertung
- Berechnung Einzelwertrückstellungen
- Berechnung Pauschalwertrückstellungen
- Verbuchung der Rückstellungen
- Darstellung mittels Rückstellungsspiegel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit untersucht die Abbildung drohender Verbindlichkeiten durch die Bildung von Gewährleistungs- und Garantierückstellungen in der Handelsbilanz eines kleinen und mittelständischen Unternehmens (KMU). Ziel ist es, die notwendigen Bewertungsgrundlagen und -kriterien zu erläutern und anhand eines Praxisbeispiels die Berechnung und Verbuchung dieser Rückstellungen zu demonstrieren.
- Definition und Abgrenzung von Gewährleistung, Garantie und Rückstellungen
- Bewertungskriterien für die Bildung von Rückstellungen nach Handelsrecht
- Berechnung von Einzel- und Pauschalwertrückstellungen
- Verbuchung und Darstellung der Rückstellungen in der Bilanz
- Anwendung der theoretischen Grundlagen auf ein reales KMU-Beispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Abbildung drohender Verbindlichkeiten durch Gewährleistungs- und Garantierückstellungen in der Handelsbilanz eines KMU ein. Sie skizziert die Relevanz des Themas für die Unternehmensführung und die korrekte Darstellung der Finanzlage. Die Arbeit wird als Ganzes vorgestellt und die Ziele sowie der Aufbau werden kurz umrissen.
Definitionen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe Gewährleistung, Garantie und Rückstellung. Es differenziert zwischen den Begriffen und erläutert deren Bedeutung im Kontext der Bilanzierung. Die rechtlichen Grundlagen und die Unterscheidung zwischen vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen werden beleuchtet. Die Definitionen bilden die Grundlage für die folgenden Kapitel.
Bewertungsgrundlagen und -kriterien: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen und handelsrechtlichen Grundlagen für die Bewertung von Rückstellungen. Es differenziert zwischen den verschiedenen Arten von Rückstellungen (Einzel- und Pauschalwertrückstellungen) und erläutert die Prinzipien der periodengerechten Abgrenzung und des Imparitätsprinzips. Wichtige Bewertungskriterien wie die "vernünftige kaufmännische Beurteilung" und der "Erfüllungsbetrag" werden ausführlich diskutiert. Die zeitlichen Bewertungskriterien, insbesondere die Bestimmung der Restlaufzeit und die Abzinsung, werden ebenfalls behandelt.
Analyse: Die Analyse beginnt mit einer Darstellung der Unternehmenssituation des betrachteten KMU. Anschließend erfolgt eine detaillierte Dokumentation der geleisteten Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen des Unternehmens, die als Grundlage für die nachfolgenden Berechnungen dient. Hier werden relevante Daten des Unternehmens und Informationen zu vergangenen Gewährleistungsfällen aufbereitet und analysiert.
Auswertung: In diesem Kapitel werden die in der Analyse gewonnenen Daten verwendet, um Einzel- und Pauschalwertrückstellungen zu berechnen. Die Verbuchung der Rückstellungen wird Schritt für Schritt erläutert, und es wird ein Rückstellungsspiegel erstellt, der die Entwicklung der Rückstellungen übersichtlich darstellt. Die Berechnungen und die Darstellung verdeutlichen die praktische Anwendung der im vorherigen Kapitel beschriebenen Bewertungskriterien.
Schlüsselwörter
Gewährleistungsrückstellungen, Garantierückstellungen, Handelsbilanz, KMU, Bewertungsgrundlagen, Bewertungskriterien, Einzelwertrückstellungen, Pauschalwertrückstellungen, periodengerechte Abgrenzung, Imparitätsprinzip, Abzinsung, Erfüllungsbetrag, kaufmännische Beurteilung, Bilanzierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Projektarbeit: Gewährleistungs- und Garantierückstellungen in KMU
Was ist der Gegenstand dieser Projektarbeit?
Die Projektarbeit untersucht die Abbildung drohender Verbindlichkeiten durch die Bildung von Gewährleistungs- und Garantierückstellungen in der Handelsbilanz eines kleinen und mittelständischen Unternehmens (KMU). Sie erläutert die notwendigen Bewertungsgrundlagen und -kriterien und demonstriert anhand eines Praxisbeispiels die Berechnung und Verbuchung dieser Rückstellungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Gewährleistung, Garantie und Rückstellungen; Bewertungskriterien für die Bildung von Rückstellungen nach Handelsrecht; Berechnung von Einzel- und Pauschalwertrückstellungen; Verbuchung und Darstellung der Rückstellungen in der Bilanz; Anwendung der theoretischen Grundlagen auf ein reales KMU-Beispiel.
Welche Arten von Rückstellungen werden unterschieden?
Es wird zwischen Einzelwertrückstellungen und Pauschalwertrückstellungen unterschieden. Die Arbeit erläutert die jeweiligen Berechnungsmethoden und Anwendungsszenarien.
Welche Bewertungskriterien werden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die Prinzipien der periodengerechten Abgrenzung und des Imparitätsprinzips. Wichtige Bewertungskriterien wie die "vernünftige kaufmännische Beurteilung" und der "Erfüllungsbetrag" werden ausführlich diskutiert. Die zeitlichen Bewertungskriterien, insbesondere die Bestimmung der Restlaufzeit und die Abzinsung, werden ebenfalls behandelt.
Wie wird die Berechnung und Verbuchung der Rückstellungen dargestellt?
Die Arbeit zeigt Schritt für Schritt die Berechnung von Einzel- und Pauschalwertrückstellungen anhand eines Praxisbeispiels. Die Verbuchung der Rückstellungen wird erläutert und ein Rückstellungsspiegel zur übersichtlichen Darstellung erstellt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die notwendigen Bewertungsgrundlagen und -kriterien für die Bildung von Gewährleistungs- und Garantierückstellungen in KMU zu erläutern und anhand eines Praxisbeispiels die Berechnung und Verbuchung dieser Rückstellungen zu demonstrieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst die Kapitel Einleitung, Definitionen (Gewährleistung, Garantie, Rückstellung), Bewertungsgrundlagen und -kriterien, Analyse (Unternehmenssituation, Dokumentation der Verpflichtungen), Auswertung (Berechnung und Verbuchung der Rückstellungen, Rückstellungsspiegel) und Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Gewährleistungsrückstellungen, Garantierückstellungen, Handelsbilanz, KMU, Bewertungsgrundlagen, Bewertungskriterien, Einzelwertrückstellungen, Pauschalwertrückstellungen, periodengerechte Abgrenzung, Imparitätsprinzip, Abzinsung, Erfüllungsbetrag, kaufmännische Beurteilung, Bilanzierung.
- Quote paper
- Marc Fischer (Author), 2019, Die handelsrechtliche Darstellung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/512564