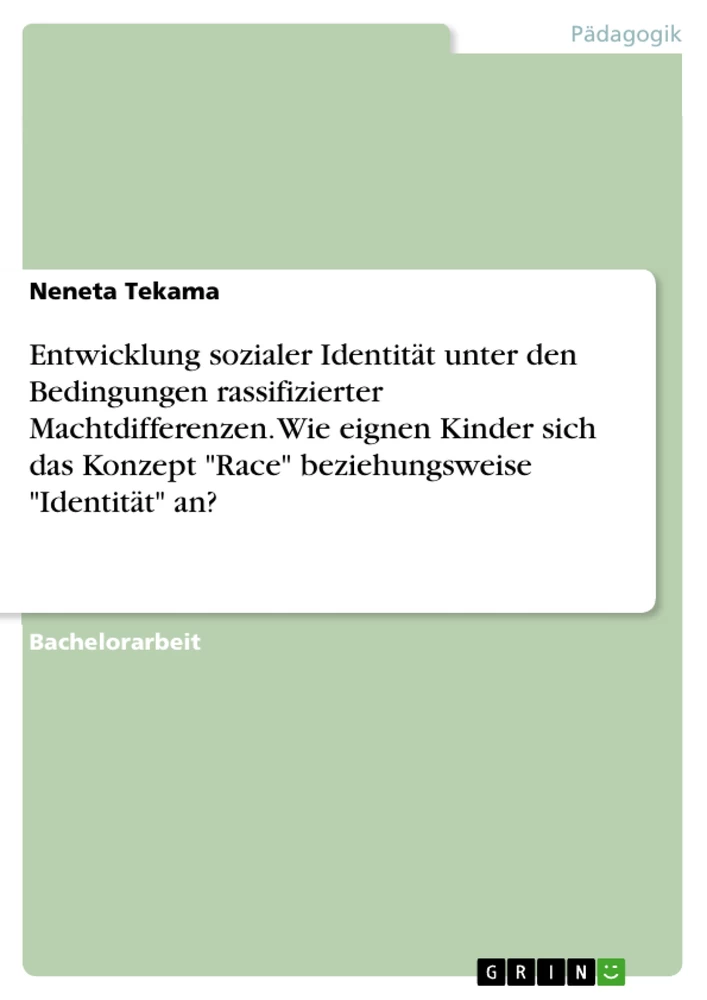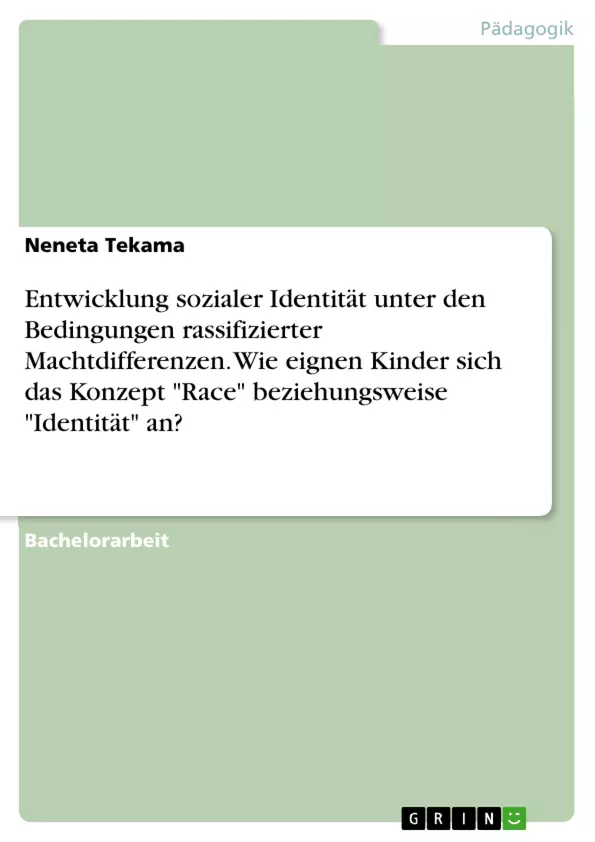Diese Arbeit stellt sich folgende Fragen: Wie eignen Kinder sich das Konzept "Race" beziehungsweise "Identität" an und welches pädagogische Handeln ist erforderlich, um rassifizierte Machtdifferenzen zu verstehen und adäquat zu reagieren? Wie und ab wann nehmen Kinder soziale Macht wahr? Identität ist keine statische Größe im Leben eines Individuums, sondern ein Konzept, das einem lebenslangen Wandlungsprozess unterliegt. Im Laufe einer Biografie stellt sich das Individuum immer wieder zentrale Fragen: "Wer bin ich?", "Was unterscheidet mich von anderen?", und im Kontext dieser Arbeit besonders relevant: "Was unterscheidet die anderen von mir?"
Die Identität eines Menschen ist wandelbar, Veränderungen unterzogen und wird bestimmt und beeinflusst von der Sozialisation eines Individuums sowie einschneidenden Erlebnissen, Erfahrungen, Beziehungen zu Mitmenschen und erlebten Verhaltensweisen. Diese Individualität ist es, die unsere Gesellschaft zu einer bunten, vielfältigen und interessanten Gesellschaft macht. Doch können aus den differenten Identitäten auch Vorurteile entstehen, die sich in Form von Rassismus, Gewalt, Ausgrenzung und Mobbing niederschlagen. Menschen identifizieren sich selbst als "schwarz" oder "weiß", es entstehen rassifizierte Machtverhältnisse und das Konzept von Race gewinnt an Bedeutung. Doch kein Mensch wird mit dem Wissen dieses Konzepts geboren. Es stellt sich daher die zentrale Frage, wie Kinder unter den Bedingungen rassifizierter Machtdifferenzen ihre soziale Identität entwickeln und ob Kinder rassifizierte Machtdifferenzen verstehen beziehungsweise sie sich sogar selbst aneignen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Verortung
- Identitätsbegriff nach Tajfel / Turner 1986
- Rassifizierung und Rassismus
- Soziale Identität und Ausländerfeindlichkeit
- Definition und Entstehung
- Beschaffenheit von Rassifizierung
- Rassismus und Weiße Hegemonie
- Postmoderner Rassismus: Leugnung und Dethematisierung
- Kinder und Differenz
- Kindliche Wahrnehmung sozialer Macht: Power-Consciosness bei Kindern
- Soziale Identität und Zugehörigkeitskonzeption von Kindern im Kontext rassifizierter Machtdifferenzen
- Forschungsstand
- Differenzforschung
- Differenzforschung im pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Kontext
- Exkurs: Vermittlung von positiven Konstruktionen des Weißseins und negativen Konstruktionen des Schwarzseins in Kinderliteratur
- Pädagogisches Handeln im Kontext rassifizierter Machtdifferenzen
- Anti-Bias-Ansatz
- Definition
- Chancen und Risiken
- Zwischenfazit
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Alltagserfahrungen von Kindern
- Das Selbstbild in Beziehung zur Bezugsgruppen-Identität
- Schulung des einfühlsamen Umgangs miteinander
- Förderung des kritischen Reflektierens
- Befähigen, für sich oder andere einzutreten
- Anti-Bias-Ansatz
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung sozialer Identität von Kindern unter den Bedingungen rassifizierter Machtverhältnisse. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen zu verstehen, die Kinder in Bezug auf die Aneignung von „Race“ und sozialer Identität im Kontext von Rassismus und Diskriminierung erleben.
- Rassifizierung und Rassismus als prägende Faktoren in der Entwicklung von sozialer Identität
- Kindliche Wahrnehmung von sozialer Macht und die Bedeutung von „Power-Consciosness“
- Zugehörigkeitskonzeptionen und deren Entwicklung im Kontext rassifizierter Machtdifferenzen
- Aktuelle Rassismusforschung und die Bedeutung von Differenzforschung im pädagogischen Kontext
- Pädagogisches Handeln im Kontext rassifizierter Machtdifferenzen und der Anti-Bias-Ansatz als möglicher Lösungsansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Thematik der sozialen Identität und deren Entwicklung unter den Bedingungen rassifizierter Machtverhältnisse einführt. Es werden Fallbeispiele präsentiert, die die Notwendigkeit einer tieferen Auseinandersetzung mit dieser Thematik beleuchten.
Das zweite Kapitel widmet sich der theoretischen Verortung des Themas und beleuchtet verschiedene Konzepte wie den Identitätsbegriff nach Tajfel / Turner, Rassifizierung und Rassismus sowie die Entstehung und Beschaffenheit von Ausländerfeindlichkeit.
Kapitel 3 bietet einen Überblick über den Forschungsstand in Bezug auf Rassismus und Differenzforschung. Hierbei werden sowohl deutsche als auch angloamerikanische Forschungsansätze in den Blick genommen.
Das vierte Kapitel widmet sich der Vermittlung von positiven Konstruktionen von Weißsein und negativen Konstruktionen von Schwarzsein in der Kinderliteratur.
Kapitel 5 fokussiert auf pädagogisches Handeln im Kontext rassifizierter Machtdifferenzen. Es wird aufgezeigt, wie durch die sogenannte „Farbenblindheit“ eine Dethematisierung rassistischer Diskriminierung stattfindet und wie dies zu einer Stabilisierung von rassifizierten Machtdifferenzen führen kann. Außerdem werden konkrete Handlungsempfehlungen im pädagogischen Kontext vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: soziale Identität, Rassifizierung, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Machtverhältnisse, Kindliche Wahrnehmung, „Power-Consciosness“, Zugehörigkeit, Differenzforschung, pädagogisches Handeln, Anti-Bias-Ansatz, Kinderliteratur, Farbenblindheit, Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen
Ab wann nehmen Kinder soziale Macht wahr?
Kinder entwickeln bereits früh ein Bewusstsein für soziale Machtverhältnisse, oft bezeichnet als "Power-Consciousness", und nehmen Differenzen in ihrem Umfeld wahr.
Wie eignen sich Kinder das Konzept "Race" an?
Niemand wird mit diesem Wissen geboren; Kinder lernen soziale Kategorien und rassifizierte Machtdifferenzen durch Sozialisation, Medien und ihr Umfeld.
Was ist der Anti-Bias-Ansatz in der Pädagogik?
Es ist ein Ansatz zur vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung, der darauf abzielt, Schieflagen und Diskriminierung aktiv entgegenzuwirken.
Welche Rolle spielt Kinderliteratur bei der Identitätsbildung?
Kinderliteratur kann positive Konstruktionen des "Weißseins" und negative Konstruktionen des "Schwarzseins" vermitteln und so Vorurteile unbewusst festigen.
Was ist mit "Farbenblindheit" im pädagogischen Kontext gemeint?
Es beschreibt die Dethematisierung von Rasse und Rassismus (Leugnung von Differenz), was paradoxerweise dazu führen kann, dass bestehende Machtverhältnisse stabilisiert werden.
- Quote paper
- Neneta Tekama (Author), 2019, Entwicklung sozialer Identität unter den Bedingungen rassifizierter Machtdifferenzen. Wie eignen Kinder sich das Konzept "Race" beziehungsweise "Identität" an?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511974