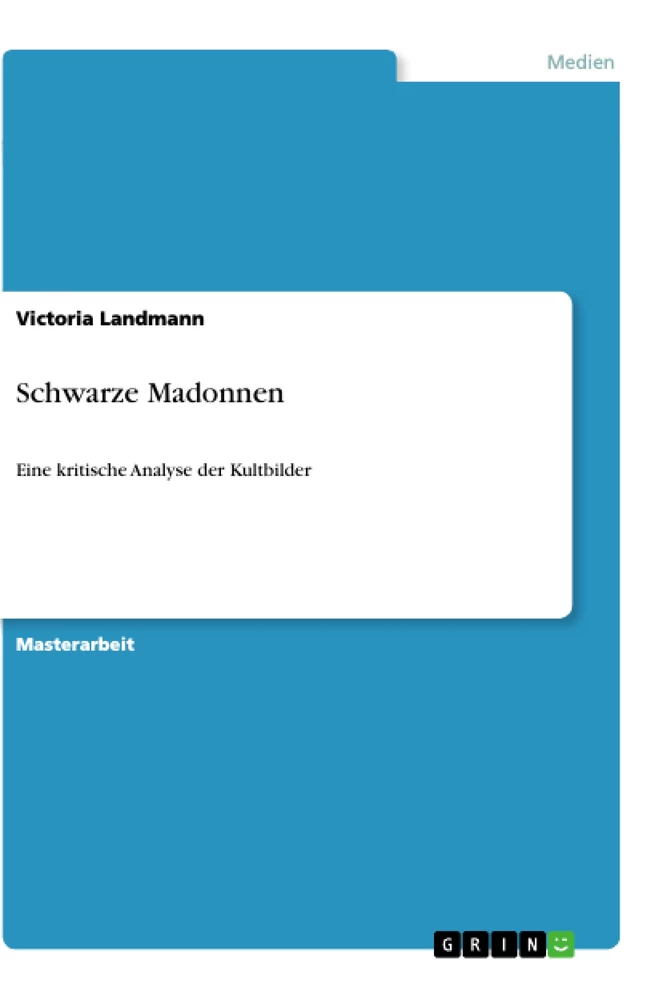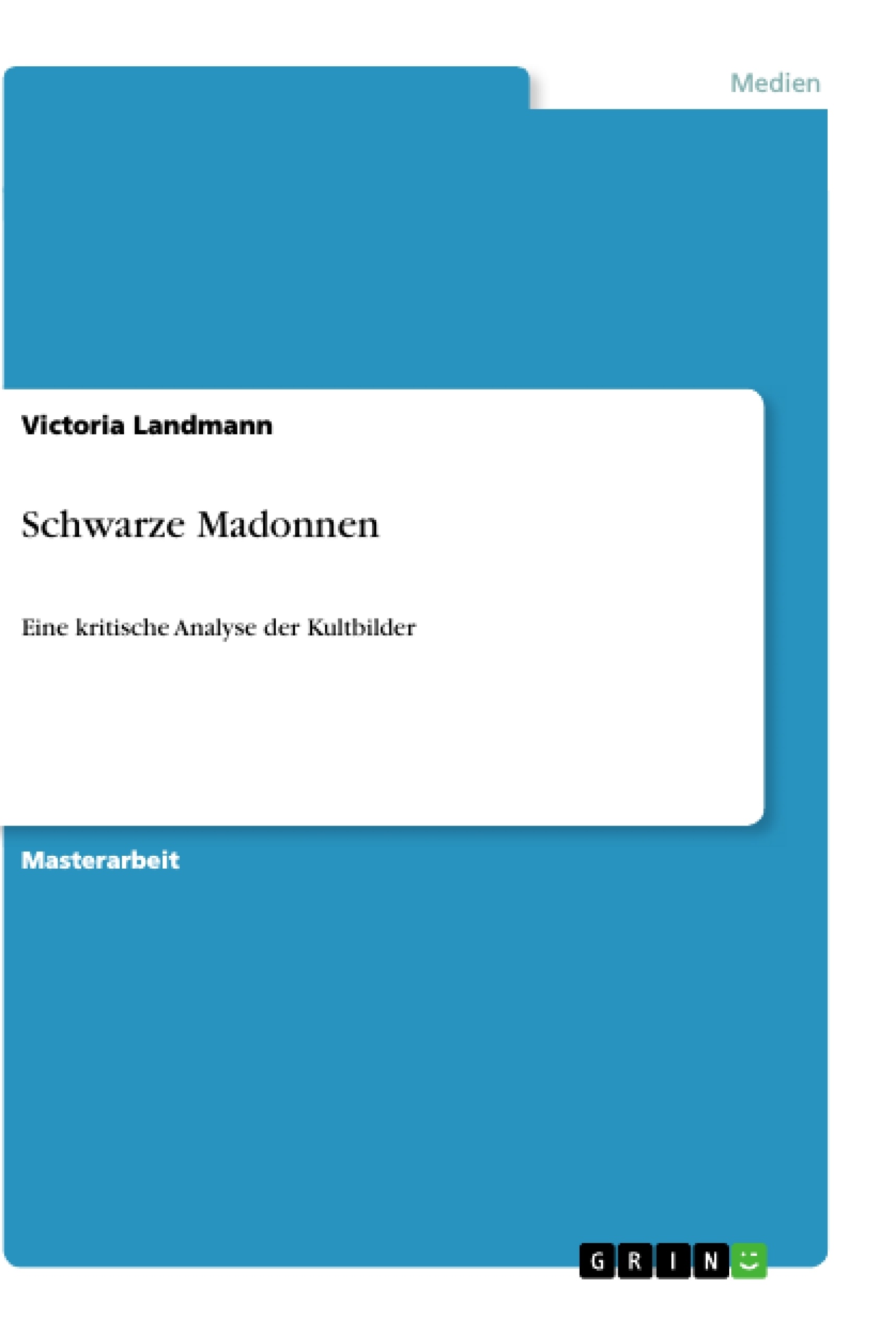Jeder kennt das menschliche Bedürfnis durch den Besuch eines gewissen Ortes einem Menschen näher zu sein, wie etwa das Haus von Goethe in Weimar oder von Schiller in Marbach zu besuchen. So verhält es sich auch im sakralen Bereich mit Stätten, an denen die Jungfrau Maria Wunder vollbracht haben soll. Diese sogenannten Gnaden- oder Kultbilder, die häufig die Muttergottes mit Kind abbilden, sind insbesondere in Wallfahrtskirchen, Kapellen oder bestimmten heiligen Orten zu finden. Bekannt, und allgemein akzeptiert, sind die Bildwerke der Muttergottes von der Romanik bis etwa zum Barock, deren Inkarnat eine helle oder polychrome Fassung aufweist.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird den sogenannten Schwarzen Madonnen beigemessen, deren Hautfarbe braun oder sogar schwarz ist. Durch ihre außergewöhnliche Färbung und prunkvolle Inszenierung, ziehen sie Gläubige aus aller Welt an und waren Auslöser von zahlreichen Wallfahrten, die noch heute im großen Rahmen praktiziert werden. Auch erlangten sie durch prominente Würdenträger eine besondere Verehrung und wurden in einigen Ländern sogar zu National- oder Regionalheiligen hochstilisiert. Weshalb ist die abendländische Madonna schwarz, und warum üben gerade diese schwarzen Bildwerke eine besondere Faszination auf die Gläubigen aus? Diese Frage wurde von der kunsthistorischen Forschung bislang unzureichend beantwortet und soll daher in dieser Arbeit analysiert und kritisch beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Vorgehensweise
- 2 Forschungsstand
- 3 Herkunft und allgemeine Quellenlage
- 4 Geographische Verortung und Anzahl
- 5 Das Bildwerk der Schwarzen Madonna
- 5.1 Schwarze Madonna, ein Kult- und Gnadenbild
- 5.2 Abgrenzung zu Reliquien
- 5.3 Typen Schwarzer Madonnen
- 5.3.1 Einführung
- 5.3.2 Thronende Madonnen
- 5.3.3 Stehende Madonnen
- 5.3.4 Lukasbilder
- 6 Gründe der dunklen Farbigkeit der Bildwerke
- 6.1 Problematik
- 6.2 Physische Beschaffenheit der Werke
- 6.2.1 Ursprüngliche Schwarzfärbung durch Beschaffenheit des Holzes
- 6.2.2 Schwarze Madonnen aus dunklem Stein oder Marmor
- 6.2.3 Schwarzfärbung durch äußere Einwirkungen
- 6.3 Bewusste Schwarzfärbung
- 6.4 Quellenlage zur Ursprünglichkeit der Schwärzung
- 6.5 „Weiße“- Schwarze Madonnen
- 7 Mögliche Gründe der bewussten Schwarzfärbung
- 7.1 Die Symbolfarbe Schwarz
- 7.2 Hinweise in der Bibel
- 7.3 Vorchristliche Begründungen der Schwärzung
- 7.4 Zeitliche Phänomene
- 7.5 Volksfrömmigkeit und finanzielle Aspekte
- 8 Die Schwarze Madonna von Altötting
- 8.1 Einführung
- 8.2 Provenienz
- 8.3 Datierung
- 8.4 Stifter
- 8.5 Quellenlage
- 8.6 Gnadenkapelle
- 8.7 Beschreibung der Figur
- 8.8 Ausarbeitung und Bestimmungszweck
- 8.9 Fassung und Konservierung
- 8.10 Stilistische Einordnung
- 8.11 Zeugnisse der Schwärzung
- 8.12 Atlas Marianus zur Schwarzfärbung
- 8.13 Repliken
- 8.14 Volksfrömmigkeit und Verehrung
- 8.15 Die Bedeutung des Hauses Wittelsbach für das Gnadenbild
- 9 Ausblick
- 9.1 Schwarze Madonnen weltweit
- 9.2 Schwarze Sakralbildwerke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Schwarzen Madonnen, ihre Entstehung, ihre Verbreitung und die Gründe für ihre dunkle Farbigkeit. Die Analyse betrachtet kunsthistorische, religiöse und soziokulturelle Aspekte. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den bestehenden Theorien zur Schwärzung der Bildwerke.
- Die unterschiedlichen Typen Schwarzer Madonnen und ihre ikonographischen Merkmale
- Die verschiedenen Theorien zur Entstehung der dunklen Farbigkeit (natürliche Prozesse vs. bewusste Färbung)
- Die Rolle der Schwarzen Madonnen im Kontext des Marien- und Reliquienkultes
- Der Einfluss von historischen Ereignissen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf die Verehrung der Schwarzen Madonnen
- Die Bedeutung der Schwarzen Madonna von Altötting als Fallstudie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Vorgehensweise: Die Arbeit untersucht die Schwarzen Madonnen, deren dunkle Hautfarbe im Gegensatz zu den üblichen hellen oder polychromen Darstellungen der Madonna steht. Die Arbeit beleuchtet die unzureichend beantwortete Frage nach den Gründen für die außergewöhnliche Faszination dieser Bildwerke und untersucht geographische Verbreitung, Anzahl, Herkunft, Klassifizierung in Typen sowie verschiedene Möglichkeiten der Schwärzung, von der natürlichen Verfärbung bis hin zur bewussten Gestaltung. Abschließend wird die Schwarze Madonna von Altötting als Fallbeispiel detailliert analysiert.
2 Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den bestehenden Forschungsstand zum Thema Schwarze Madonnen, indem es verschiedene wichtige Publikationen und Forschungsansätze aus der Kunstgeschichte und angrenzenden Disziplinen erwähnt. Es werden sowohl umfassende Übersichtswerke als auch spezialisierte Studien zu bestimmten Aspekten, wie der fassungstechnischen Untersuchung der Schwärzung, der bewussten Schwärzung oder der Altöttinger Madonna, diskutiert. Der kritische Umgang mit belletristischer Literatur zum Thema wird hervorgehoben.
3 Herkunft und allgemeine Quellenlage: Die genaue Herkunft der Schwarzen Madonnen ist aufgrund mangelnder und fragwürdiger Quellenlage oft ungeklärt. Zahlreiche Legenden ranken sich um ihre Auffindung, darunter Geschichten von Wiederentdeckungen nach langer Zeit der Verborgenheit oder den Kreuzzügen. Die Arbeit beleuchtet das Problem der spärlichen Primärquellen und analysiert frühe Studien, die sich mit kultischen und ikonographischen Aspekten der Schwarzen Madonnen beschäftigten, unter Berücksichtigung deren methodischer Grenzen.
4 Geographische Verortung und Anzahl: Schwarze Madonnen sind in vielen katholischen Regionen Europas und darüber hinaus verbreitet. Das Kapitel beschreibt die geographische Konzentration in bestimmten Gebieten Europas (Süd- und Mittelfrankreich, Belgien, Italien) und diskutiert die Schwierigkeiten bei der Erstellung einer umfassenden Übersicht aller existierenden Exemplare. Es werden die bekanntesten Beispiele Schwarzer Madonnen genannt, sowie die Problematik von Repliken und die historischen Zerstörungen von Bildwerken.
5 Das Bildwerk der Schwarzen Madonna: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Kultbild" im Vergleich zum "Andachtsbild" und untersucht die Bedeutung der Schwarzen Madonnen als Kult- und Gnadenbilder. Es werden die Kriterien und Merkmale dieser Bildwerke erläutert, ihre Verbindung zum Reliquienkult diskutiert und die verschiedenen Typen Schwarzer Madonnen (thronende, stehende, Lukasbilder) klassifiziert und anhand von Beispielen detailliert beschrieben.
6 Gründe der dunklen Farbigkeit der Bildwerke: Das Kapitel analysiert die verschiedenen Möglichkeiten der dunklen Farbigkeit Schwarzer Madonnen. Es werden natürliche Ursachen wie die Beschaffenheit des verwendeten Holzes (z. B. dunkles Holz, Verfärbungen durch Alterungsprozesse), äußere Einwirkungen (z. B. Kerzenruß, Oxidation) und die bewusste Schwärzung der Figuren untersucht. Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der ursprünglichen Farbigkeit und diskutiert die Problematik von "weißen" Schwarzen Madonnen, die nachträglich gereinigt wurden.
7 Mögliche Gründe der bewussten Schwarzfärbung: Dieses Kapitel widmet sich den möglichen Gründen für eine bewusste Schwarzfärbung der Madonnen. Es werden die Symbolik der Farbe Schwarz, biblische Interpretationen (Hohelied der Liebe), vorchristliche Bezüge zu heidnischen Göttinnen, zeitliche Phänomene (z. B. Romantik, Gegenreformation), und die Rolle der Volksfrömmigkeit und finanzieller Aspekte untersucht und diskutiert.
8 Die Schwarze Madonna von Altötting: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Analyse der Schwarzen Madonna von Altötting, einschließlich Provenienz, Datierung, möglichen Stiftern, Quellenlage, der Geschichte der Gnadenkapelle, Beschreibung der Figur, ihrer Ausarbeitung und ihres Bestimmungszwecks, sowie der Fassung und Konservierung, stilistischen Einordnungen, Zeugnissen der Schwärzung, dem Bezug zum Atlas Marianus und der Rolle von Repliken. Der Einfluss der Wittelsbacher und die Volksfrömmigkeit werden ebenfalls untersucht.
Schlüsselwörter
Schwarze Madonnen, Marienverehrung, Kultbild, Gnadenbild, Reliquienkult, Ikonographie, Farbsymbolik, mittelalterliche Skulptur, Volksfrömmigkeit, Altötting, Wittelsbacher, Gegenreformation, Atlas Marianus, Provenienz, Schwärzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Schwarze Madonnen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Phänomen der Schwarzen Madonnen. Sie untersucht deren Entstehung, Verbreitung, die Gründe für ihre dunkle Farbigkeit und die Bedeutung im Kontext von Marienverehrung und Volksfrömmigkeit.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit betrachtet kunsthistorische, religiöse und soziokulturelle Aspekte. Es werden verschiedene Theorien zur Schwärzung der Bildwerke kritisch analysiert, die unterschiedlichen Typen Schwarzer Madonnen klassifiziert und deren ikonographische Merkmale untersucht. Die Rolle im Marien- und Reliquienkult, der Einfluss historischer Ereignisse und die Bedeutung der Volksfrömmigkeit werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung und Vorgehensweise; Forschungsstand; Herkunft und allgemeine Quellenlage; Geographische Verortung und Anzahl; Das Bildwerk der Schwarzen Madonna; Gründe der dunklen Farbigkeit der Bildwerke; Mögliche Gründe der bewussten Schwarzfärbung; Die Schwarze Madonna von Altötting; Ausblick.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Schwarzen Madonnen umfassend zu untersuchen und die Gründe für ihre dunkle Farbigkeit zu ergründen. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Theorien und der Analyse kunsthistorischer, religiöser und soziokultureller Aspekte.
Welche Theorien zur dunklen Farbigkeit werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl natürliche Ursachen (Beschaffenheit des Holzes, äußere Einwirkungen) als auch die bewusste Schwärzung der Bildwerke. Es werden verschiedene Theorien diskutiert, die von der Symbolik der Farbe Schwarz über biblische Interpretationen bis hin zu vorchristlichen Bezügen reichen.
Welche Rolle spielt die Schwarze Madonna von Altötting?
Die Schwarze Madonna von Altötting dient als Fallstudie. Das Kapitel widmet sich ausführlich ihrer Provenienz, Datierung, Geschichte, stilistischen Einordnung, der Volksfrömmigkeit um sie herum und dem Einfluss der Wittelsbacher.
Welche Arten von Schwarzen Madonnen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Typen Schwarzer Madonnen, darunter thronende, stehende und Lukasbilder. Diese Typen werden anhand von Beispielen und ihren ikonographischen Merkmalen beschrieben.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Quellen, darunter kunsthistorische Publikationen, spezialisierte Studien, sowie die Auseinandersetzung mit der oft unzureichenden und lückenhaften Quellenlage zu den einzelnen Madonnen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schwarze Madonnen, Marienverehrung, Kultbild, Gnadenbild, Reliquienkult, Ikonographie, Farbsymbolik, mittelalterliche Skulptur, Volksfrömmigkeit, Altötting, Wittelsbacher, Gegenreformation, Atlas Marianus, Provenienz, Schwärzung.
Wo finde ich weitere Informationen zu Schwarzen Madonnen?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick und verweist auf weitere Literatur und Forschungsansätze. Zusätzliche Informationen können in spezialisierten kunsthistorischen Publikationen und Studien gefunden werden.
- Quote paper
- Victoria Landmann (Author), 2018, Schwarze Madonnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/511818