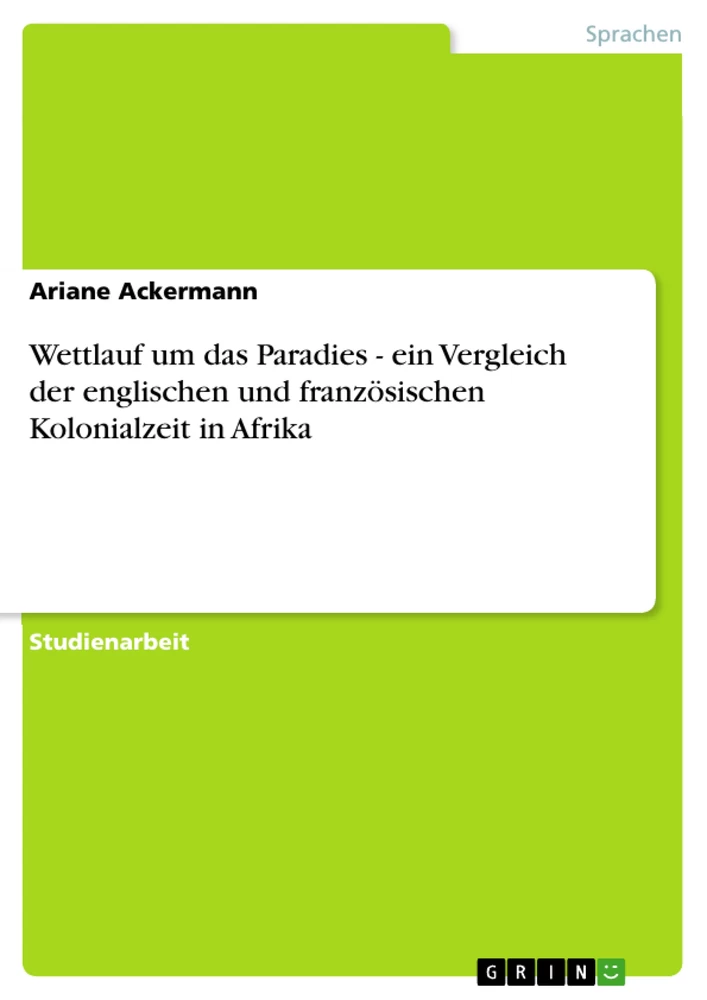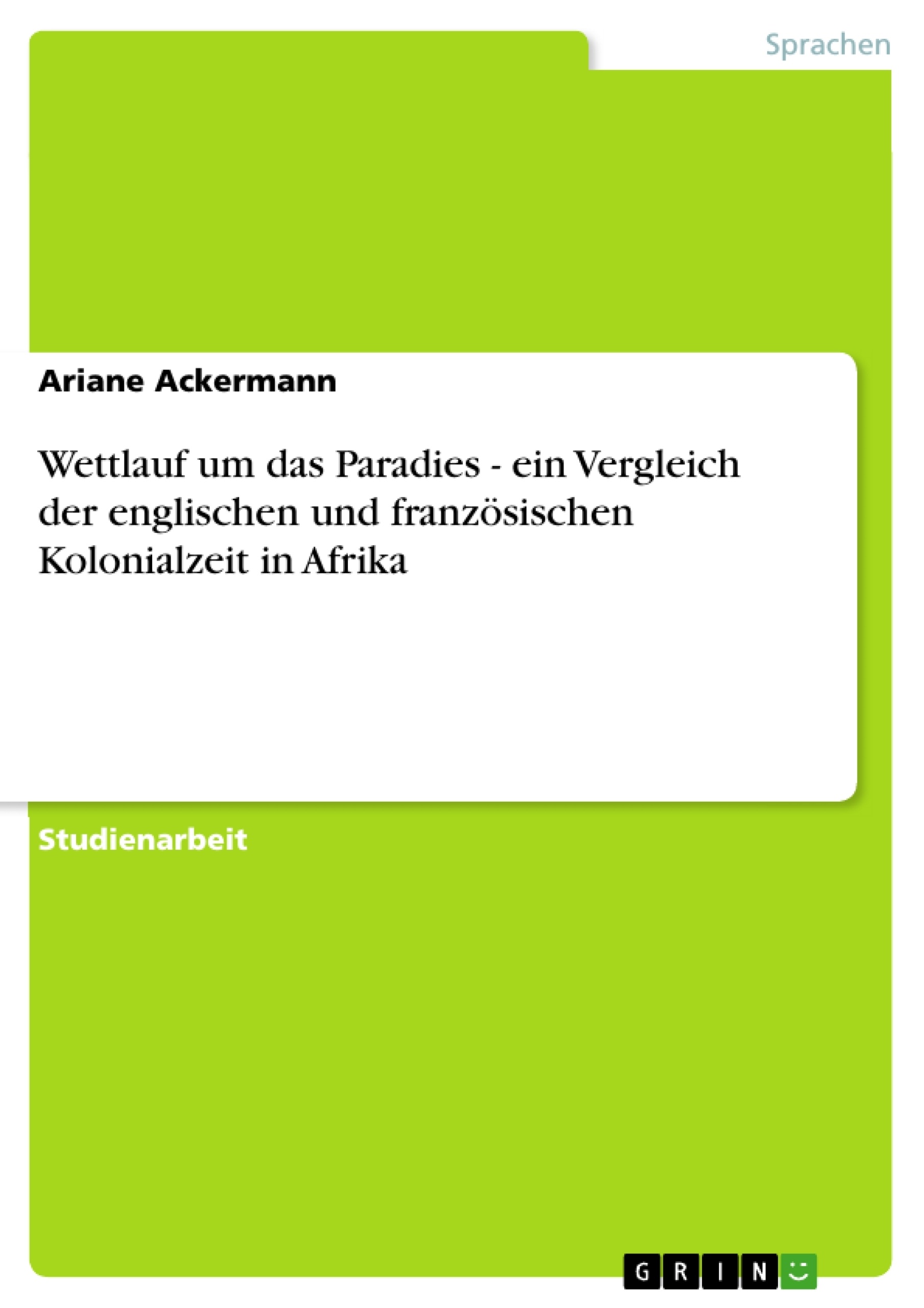Unter der Voraussetzung des binären europäischen Denkens legitimierten Frankreich und England die Eroberung Afrikas. Wir waren gebildet, zivilisiert, vernünftig und weiß, die Anderen waren ignorant, barbarisch, irrational und schwarz2 Ihr deklariertes
Ziel in Afrika waren die drei Cs, wie Livingstone sie nannte: Commerce, Christianity und Civilization. Dazu kam allerdings noch ein Viertes: Conquest – Eroberung. Sie verlief wie ein Wettlauf, als ob jedes kleine Stück afrikanischen Bodens eine Goldgrube wäre. Die Realität sah allerdings anders aus. Mit dem Profit verbanden sich auch hohe Kosten, vor allem im Verwaltungsapparat, wobei beide Nationen unterschiedliche, ihrer eigenen Tradition kongruenten Strategien verfolgten. Die Kosten waren jedoch nicht nur finanzieller Art, sondern führten zu einem Kulturverlust
der indigenen Afrikaner und damit zu einer Akkulturation3, der Überlagerung beziehungsweise Vermischung der Überlegenen und Unterlegenen.
Erst in den vergangenen Jahren erforschte man die Geschichte des bis dahin als geschichtslos geltenden Kontinents Afrika und man stellt fest, dass die prekolonialen Kulturen in einer nicht-europäischen Form hoch entwickelt waren. Dieses Bemühen hat von europäischer Seite die Abwendung des eurozentristischen Denkens erfordert
und damit den Weg zur Wiederaufarbeitung dieses historischen Kapitels bereitet.
1 Auszug aus Rudyard Kipling: The White Man’s Burden. McClure’s Magazine 12. 1899.
http://boondocksnet.com/ai/kipling/kipling.html 04.07.2004
2 das binäre System des We und the Others gilt als maßgebliche Voraussetzung für den Kolonialismus in den post-colonial studies. Bei B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin: Key Concepts of Post-Colonial Studies. Routledge.
London.1998.
3 J. E. Mabe (Hrsg.): Das kleine Afrika – Lexikon. Bonn bei bpb. 2004.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Afrika vor der europäischen Kolonisierung
- 1.1 Genereller Überblick
- 1.2 Politische Organisationsformen
- 1.2.1 Zentralisierte Herrschaftsform
- 1.2.2 Dezentrale Gesellschaftsformen
- 2 Am Vorabend der europäischen Kolonialzeit
- 2.1 Der Beginn der Erschließung Afrikas durch die Europäer
- 2.2 Frankreichs und Englands Weg in den Imperialismus – Voraussetzungen und Ideen im Vergleich
- 2.2.1 Natürliche Voraussetzungen
- 2.2.2 Staatsysteme im Vergleich
- 2.2.3 Liberalismus und Aufklärung als geistige Basis
- 3 Der Wettlauf um Afrika
- 3.1 Hauptfaktoren zur Eroberung
- 3.2 Historischer Verlauf der Aufteilung Afrikas
- 3.2.1 Der Wettlauf beginnt
- 3.2.2 Die Aufteilung Afrikas
- 4 Verwaltung und Organisation der Kolonien
- 4.1 Genereller Überblick
- 4.2 „Der Staat bin Ich!“ – Frankreich und die direkte Verwaltung
- 4.3 „Teile und herrsche!“ - Großbritannien und die indirekte Verwaltung
- 5 Das Ende der Kolonialzeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Vergleich der englischen und französischen Kolonialzeit in Afrika. Ziel ist es, die unterschiedlichen Strategien und Vorgehensweisen beider Kolonialmächte aufzuzeigen und deren Auswirkungen auf die afrikanischen Gesellschaften zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die präkoloniale Situation Afrikas, den Beginn der Kolonisierung, den Wettlauf um Afrika, die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen und das Ende der Kolonialzeit.
- Präkoloniale afrikanische Gesellschaften und ihre politischen Strukturen
- Der europäische Imperialismus und seine ideologischen Grundlagen
- Der Wettlauf um Afrika und die Aufteilung des Kontinents
- Vergleich der französischen und britischen Kolonialverwaltung
- Auswirkungen der Kolonialisierung auf die afrikanischen Kulturen
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung zitiert Rudyard Kipling und beschreibt die europäische Sicht auf Afrika als "ignorant, barbarisch, irrational und schwarz," im Gegensatz zu der europäischen Überlegenheit. Sie betont das Motiv der Eroberung (Conquest) neben Commerce, Christianity und Civilization und kündigt den Vergleich der französischen und britischen Kolonialstrategien an, die mit hohen Kosten, sowohl finanziell als auch kulturell, verbunden waren. Die Einleitung weist auch auf die neuere Forschung hin, die die prekolonialen afrikanischen Kulturen als hochentwickelt darstellt und eine Abkehr vom eurozentristischen Denken fordert.
1 Afrika vor der europäischen Kolonisierung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den afrikanischen Kontinent vor der Kolonialisierung. Es hebt die große Vielfalt an Lebensräumen, Ökosystemen und Kulturen hervor und betont die Existenz hochentwickelter politischer und kultureller Strukturen, wie beispielsweise das alte Ägypten, Meroe und Axum. Das Kapitel widerlegt die eurozentristische Vorstellung eines "verwilderten" und "unterentwickelten" Kontinents und betont die Existenz von etwa 1500 Sprachen und Dialekten als Beweis für die kulturelle Vielfalt.
1.2 Politische Organisationsformen: Dieses Unterkapitel beschreibt die unterschiedlichen politischen Organisationsformen in Afrika vor der Kolonialisierung. Es werden zentralisierte und dezentrale Systeme vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf den unterschiedlichen Rollen von Monarchen und Senaten liegt. Es wird gezeigt, dass diese Systeme, obwohl unterschiedlich, nicht spezifisch "afrikanisch" sind, sondern auch in anderen Weltregionen vorkommen. Die ideale Rolle der politischen Elite zum Schutz und Wohl der Bevölkerung wird mit der Realität despotischer Tendenzen kontrastiert.
2 Am Vorabend der europäischen Kolonialzeit: Dieses Kapitel beschreibt den Beginn der europäischen Erschließung Afrikas und vergleicht die Wege Frankreichs und Englands in den Imperialismus. Es untersucht die natürlichen Voraussetzungen, die unterschiedlichen Staatsysteme und den Einfluss des Liberalismus und der Aufklärung auf die imperialistischen Bestrebungen beider Nationen. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Voraussetzungen und Ideen, die zur unterschiedlichen Kolonialpolitik führten.
3 Der Wettlauf um Afrika: Dieses Kapitel analysiert den Wettlauf um Afrika und seine Hauptfaktoren. Es beschreibt den historischen Verlauf der Aufteilung Afrikas, beginnend mit dem Beginn des Wettlaufs und seiner Entwicklung bis zur endgültigen Aufteilung des Kontinents. Die Bedeutung der wirtschaftlichen Interessen und strategischen Überlegungen wird dabei hervorgehoben.
4 Verwaltung und Organisation der Kolonien: Dieses Kapitel untersucht die Verwaltung und Organisation der Kolonien durch Frankreich und Großbritannien. Es vergleicht die direkte Verwaltung der Franzosen mit dem Prinzip "Der Staat bin ich!" mit der indirekten Verwaltung der Briten und ihrem "Teile und herrsche!"-Ansatz. Die unterschiedlichen Auswirkungen dieser Verwaltungsstrategien auf die afrikanischen Gesellschaften werden analysiert.
5 Das Ende der Kolonialzeit: [This section is omitted as per the instructions to exclude the conclusion or final chapter to avoid spoilers.]
Schlüsselwörter
Kolonialismus, Frankreich, England, Afrika, Imperialismus, Verwaltung, direkte Verwaltung, indirekte Verwaltung, präkoloniale Gesellschaften, Kultur, Akkulturation, Eurozentrismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der englischen und französischen Kolonialzeit in Afrika
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die englischen und französischen Kolonialstrategien in Afrika. Sie untersucht die präkoloniale Situation Afrikas, den Beginn der Kolonisierung, den Wettlauf um Afrika, die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen beider Kolonialmächte (direkte vs. indirekte Verwaltung) und das Ende der Kolonialzeit. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Auswirkungen der Kolonialisierung auf die afrikanischen Gesellschaften.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: präkoloniale afrikanische Gesellschaften und deren politische Strukturen; der europäische Imperialismus und seine ideologischen Grundlagen; der Wettlauf um Afrika und die Aufteilung des Kontinents; ein Vergleich der französischen und britischen Kolonialverwaltung; und die Auswirkungen der Kolonialisierung auf die afrikanischen Kulturen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt: Einleitung, Afrika vor der europäischen Kolonisierung (mit Unterkapiteln zu politischen Organisationsformen), Am Vorabend der europäischen Kolonialzeit, Der Wettlauf um Afrika, Verwaltung und Organisation der Kolonien (mit Fokus auf die direkte und indirekte Verwaltung), und Das Ende der Kolonialzeit (dieses Kapitel ist in der Vorschau ausgelassen). Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Welche Quellen werden verwendet? (Nicht explizit in der Vorschau genannt, aber implizit vorhanden)
Die Vorschau nennt keine expliziten Quellen. Es ist jedoch implizit, dass die Arbeit auf historischen Quellen, wissenschaftlicher Literatur und möglicherweise auch auf archäologischen Funden basiert, um die präkolonialen afrikanischen Gesellschaften darzustellen und den europäischen Imperialismus zu analysieren.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen? (Nur teilweise beantwortbar aufgrund der fehlenden Zusammenfassung des letzten Kapitels)
Die Vorschau enthält keine expliziten Schlussfolgerungen. Aus den Kapitelzusammenfassungen lässt sich jedoch ableiten, dass die Arbeit die unterschiedlichen Strategien und Auswirkungen der französischen und britischen Kolonialherrschaft aufzeigen und die eurozentristische Sichtweise auf die präkoloniale afrikanische Geschichte kritisch hinterfragen wird.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kolonialismus, Frankreich, England, Afrika, Imperialismus, Verwaltung, direkte Verwaltung, indirekte Verwaltung, präkoloniale Gesellschaften, Kultur, Akkulturation, Eurozentrismus.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen Strategien und Vorgehensweisen der englischen und französischen Kolonialmächte in Afrika aufzuzeigen und deren Auswirkungen auf die afrikanischen Gesellschaften zu analysieren.
Wie wird der Eurozentrismus in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit kritisiert die eurozentristische Sichtweise auf Afrika und betont die Existenz hochentwickelter präkolonialer afrikanischer Kulturen und politischer Systeme. Sie widerlegt die Vorstellung eines „verwilderten“ und „unterentwickelten“ Kontinents.
- Quote paper
- Magister Artium Ariane Ackermann (Author), 2004, Wettlauf um das Paradies - ein Vergleich der englischen und französischen Kolonialzeit in Afrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/51180