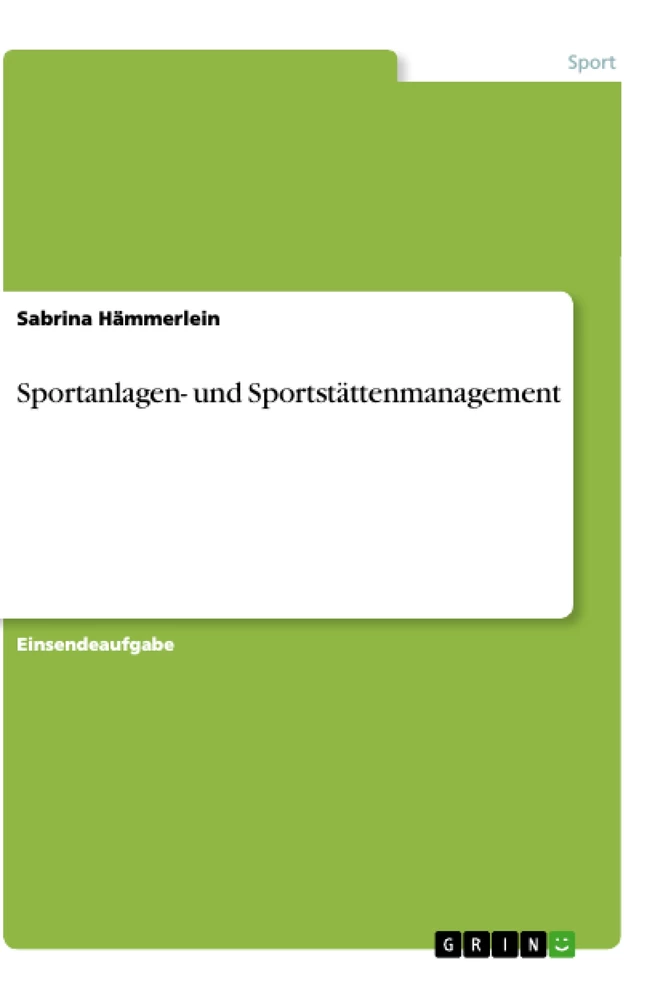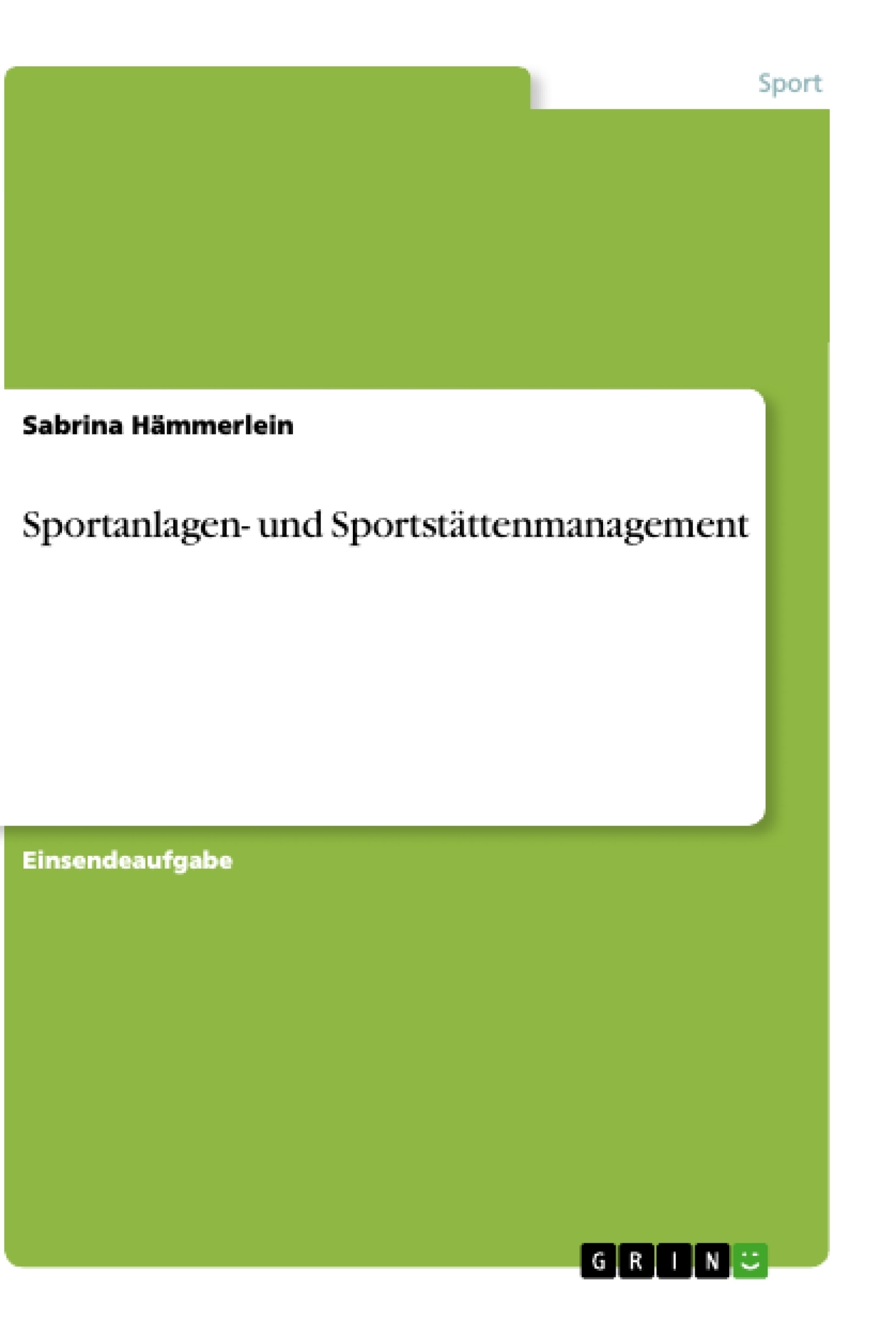In dieser Einsendeaufgabe wird anhand von Fallbeispielen auf den Sportanlagen- und Sportstättenbau, die kommunale Sportentwicklungsplanung, die Finanzierung und den Betrieb von Sportanlagen sowie auf die digitale Vermarktung von Sportanlagen eingegangen. Beim Bau einer Sportstätte müssen wesentliche Schritte in die Planung eingebunden werden. Diese sollen nachfolgend erklärt, und mit Hilfe des PLANNET-Diagramms und der Netzplantechnik dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Sportanlagen- und Sportstättenbau
2 Kommunale Sportentwicklungsplanung
2.1 Grundformel zur Berechnung des Sportstättenbedarfs
2.2 Berechnung des Sportstättenbedarfs
2.3 Förderinteresse
3 Finanzierung und Betrieb von Sportanlagen
3.1 Investition und Finanzierung
3.2 Auslastungsanalyse einer Sportanlage
3.3 Auslastungsoptimierung
3.4 Nachhaltigkeit von Sportstätten
4 Digitale Vermarktung von Sportanlagen und Sportstätten
5 Literaturverzeichnis
6 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
6.1 Abbildungsverzeichnis
6.2 Tabellenverzeichnis
1 Sportanlagen- und Sportstättenbau
Beim Bau einer Sportstätte müssen wesentliche Schritte in die Planung eingebunden werden. Diese sollen nachfolgend erklärt, und mit Hilfe des PLANNET-Diagramms und der Netzplantechnik dargestellt werden.
Der Bau einer Sportanlage bedarf einer guten Planung, um diesen umzusetzen, nachfolgend sind die einzelnen Phasen dargestellt und nach der Reihenfolge der Umsetzung geordnet.
Tab. 1: Phasen der Planung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zunächst werden die Schritte mit Hilfe der PLANNET-Technik dargestellt. Die PLANNET-Technik zeigt die jeweiligen Schritte des Projekts und stellt die terminliche Abhängigkeit zwischen den jeweiligen Vorgängen mit Hilfe von Verbindungsschritten dar. Es werden zusätzlich Pufferzeiten beachtet, welche sich im Zuge der Planung ergeben (Olfert, 2008, S.105). In der bearbeiteten Aufgabe können die Standortwahl und die Sportverhaltens- und Nutzungsanalyse parallel durchgeführt werden. Daraus ergibt sich für die Standortwahl eine Pufferzeit von zwei Monaten, welche in der nachfolgenden Abbildung hellgrau dargestellt wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1:PLANNET-Diagramm (eigene Darstellung)
Nicht zu vergessen bei dieser Darstellung ist, dass der Betrieb der Sportstätte über die 12 Monate hinaus geht, wie in Tabelle 1 dargestellt ist.
Da Balkendiagramme eher für kleinere Projekte verwendet werden und für größere, komplexe Projekte nicht geeignet sind (Corsten & Corsten, 2000, S.149), wird nachfolgend die Netzplantechnik dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Netzplantechnik (eigene Darstellung)
Mit der Netzplantechnik können zeitliche Abhängigkeiten, sowie Puffer und Prozessfolgen dargestellt werden. Zusätzlich bezieht sie Zeit, Kosten und Kapazitäten mit ein (Paul,2009, S.3).
Diese Technik hat die Vorteile, dass sie relativ einfach anwendbar sind und in verschiedenen Bereichen wie in der Planung sowie Abwicklung von Projekten, oder der Darstellung von Produktionsabläufen (Zimmermann und Stache, 2001, S. 6). Aus der oberen Darstellung geht hervor, dass zwei Vorgänge nach dem ersten Schritt gleichzeitig stattfinden, was man auch Scheinvorgänge nennt. Daraus entsteht ein Puffer von 2 Monaten für die Standortwahl.
Zusammenfassend kann man sagen, dass aus den Diagrammen folgendes hervorgeht: Nach 38 Monaten kann frühestens mit dem Betrieb der Sportanlage begonnen werden, für diese dann eine Nutzungsdauer von mindestens 12 Monaten eingeplant wird.
2 Kommunale Sportentwicklungsplanung
2.1 Grundformel zur Berechnung des Sportstättenbedarfs
Im Rahmen der kommunalen Sportentwicklungsplanung wurde ein Memorandum erstellt, welcher ein allgemein anerkannter Leitfaden darstellt (Hübner,2013, S.10). Dieser beinhaltet ein Gesamtkonzept, welches ein zielgerichtetes, methodisches Vorgehen zur Festlegung von Rahmenbedingungen im Sport beinhaltet.
Gründe und Herausforderungen für die Entwicklungen des „Memorandum zur kommunalen Sportentwicklung“ sind unteranderem der zunehmende Bedarf an Sportanlagen sowie die Herausforderung, dass Sportstätten auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden müssen. Auch der Mangel an qualifizierten Kräften stellt eine Herausforderung dar (Rütten et al., 2010, S.5 ff.)
Zunächst muss der aktuelle Sportstättenbedarf ermittelt werden. Hierzu wird eine Grundformel angewendet, die im Folgenden dargestellt und erläutert wird.
Grundformel zur Berechnung des Sportstättenbedarfs (Rütten et al. 2010):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um die Formel verständlich zu machen, werden die einzelnen Parameter kurz erläutert:
Der Sportbedarf setzt sich zusammen aus Sportlern, also die Personen, die sich regelmäßig sportlich beteiligen. Aus der Häufigkeit, also der Anzahl an Sporteinheiten pro Woche, die ein Sportler ausführen möchte. Und der Dauer in Stunden, die der Sportler im Durchschnitt für eine Einheit aufbringen möchte.
Der Zuordnungsfaktor beschreibt den Anteil der Sportart, an allen Sportarten, die in einer Sportstätte durchgeführt werden.
Im Nenner der Formel steht zum einen die Belegungsdichte, welche beschreibt, wie viele Sportler einer Sportart gleichzeitig die Anlage der Sportstätte benutzen dürfen. Diese wird multipliziert mit der Nutzungsdauer, also dem Zeitraum in Stunden, in dem die Anlage pro Woche für diese Sportart verwendet werden kann. Der Auslastungsfaktor ist der letzte Parameter der Formel und beschreibt das Verhältnis zwischen der Auslastung, die tatsächlich stattfindet und derer, welche maximal möglich ist.
2.2 Berechnung des Sportstättenbedarfs
In dieser Aufgabe soll auf Grundlage der Grundformel, der Sportbedarf und der Auslastungsfaktor der Stadt Mannheim für den Fußballsport berechnet werden. Grundlage hierfür stellt die Tabelle in der Aufgabenstellung dar.
Der Sportbedarf:
Der Sportbedarf errechnet sich Folgendermaßen: Sportler x Häufigkeit x Dauer.
24000 x 1,5 x 1,8 = 64800
Der Sportbedarf beträgt also 64800.
Um den Auslastungsfaktor zu berechnen muss die Formel zur Sportstättenbedarfsrechnung umgestellt werden.
Zunächst werden die Zahlen für die Einzelnen Parameter eingesetzt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als zweiter Schritt wird die Formel nach X aufgelöst:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Auslastungsfaktor liegt demnach bei 0,6171 bzw. bei 61,71 %
2.3 Förderinteresse
„Während die Bundesregierung ausschließlich den Breitensport fördert, besitzen die Bundesländer und Kommunen lediglich Förderinteressen am Spitzensport.“ Diese Aussage beinhaltet drei Förderinteressenten, zum einen die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat laut diesem Statement nur Interesse an der Förderung des Breitensports, welches nicht der Wahrheit entspricht. Im Fokus der Bundesregierung liegt die Förderung des Spitzensports, da dieser ein wichtiger Punkt für das Ansehen der Bundesregierung ist, es soll also das Image von Deutschland durch den Spitzensport verbessert werden. Jedoch sollte hierbei berücksichtigt werden, dass der Bund nur den Bau von Sportstätten fördert, wenn alle anderweitigen Finanzierungsmittel ausgeschöpft werden. Dies nennt man auch „Subsidiaritätsprinzip“. Die Fördergelder fließen hierbei eher in anerkannte Einrichtungen des Spitzensports wie z.B. Olympiastützpunkte. Der Breitensport hingegen wird nicht gefördert.
Die Bundesländer und Kommunen besitzen ebenfalls Interesse an der Förderung des Spitzensports, da in den jeweiligen Bundesländern einige Sportanlagen befinden und je attraktiver oder erfolgreicher die Sportler und Sportstätten der Kommunen sind, um so mehr Bundestrainer und Bundesmittel fließen. Hierdurch könne z.B. einzelne Sportstätten weiter ausgebaut werden.
Aber auch der Breitensport spielt eine wichtige Rolle für die Bundesländer und Kommunen, da dieser nicht von der Bundesregierung wahrgenommen wird, jedoch gerade der Breitensport wichtige Aspekte, wie die Bewegung aber auch die Förderung der Entwicklung von sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen bzw. der Erwachsenen sowie die der Gesundheitsförderung einschließt (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012). Fördermittel fließen zum Beispiel in den Bau und in die Sanierung von Sportstätten sowie in den Sportbetrieb oder Förderung der Trainer im Bereich des Breitensports.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bundesregierung ihren Fokus auf den Spitzensport legt, primär um das Image Deutschlands zu fördern, während Kommunen und Bundesländer neben dem Spitzensport auch den Breitensport fördern, und so auch einen größeren Anteil der Sporttreibenden Bevölkerung erreicht.
3 Finanzierung und Betrieb von Sportanlagen
3.1 Investition und Finanzierung
2015 wurde durch den TV Niederensingen in Zusammenarbeit mit der Kommune ein Neubau einer Dreifachsporthalle realisiert. Hierzu soll im Folgenden der Kapitalwert und die Barwerte der Investition berechnet werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um den Kaptalwert zu berechnen wird folgende Formel verwendet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um den Wert mit Hilfe der Formel zu berechnen, müssen zunächst die Einzahlungen und Auszahlungen berechnet werden, um im Anschluss die Barwerte zu bestimmen und die Ergebnisse dann in die Formel einzusetzen.
Folgende Parameter sind gegeben:
Anschaffungskosten: 3.000.000 €
Nutzungsdauer: 5 Jahre
Ausgaben: 100.000 € (netto) pro Jahr. Steigen jährlich um 3 %.
Einnahmen: 60.000 € Brutto, also 50.420 € Netto. Einnahmen sollen jährlich um 15% steigen. + 1000 € (netto) monatliche Einnahmen durch die Kommune, welches 12.000 € pro Jahr beträgt.
Kapitalverzinsung: 12%
Die Jährlichen Einnahmen werden zunächst folgendermaßen berechnet: Netto Einnahmen + Nettoeinnahmen durch Schulnutzung der Kommune.
[...]
- Citar trabajo
- Sabrina Hämmerlein (Autor), 2019, Sportanlagen- und Sportstättenmanagement, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/510238