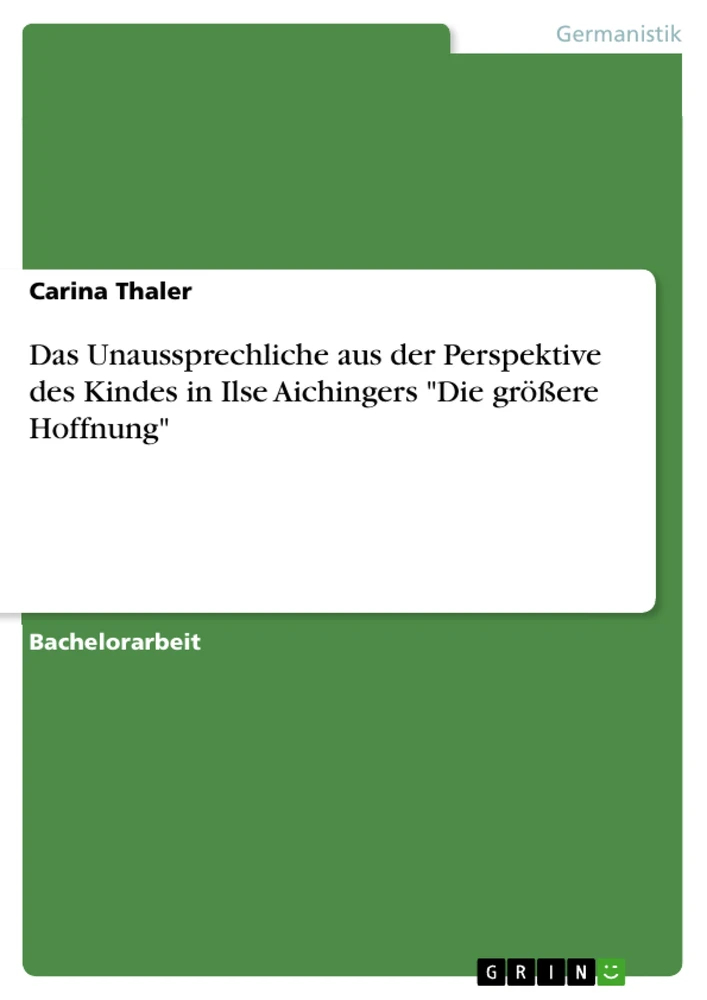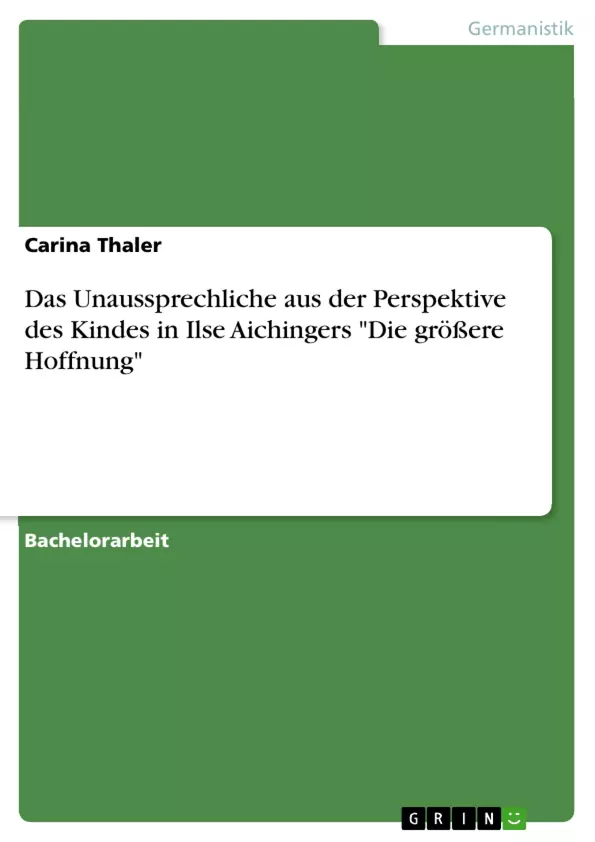Diese Arbeit beschäftigt sich mit der zentralen Frage nach der Wirkungsweise des Kinderblicks und der veränderten Erzählperspektive und untersucht, ob und wie eine hochpoetische Ausdrucksform in den LeserInnen die Wahrnehmung der reellen Schrecken des Holocaust beeinflusst.
Im Fokus der Untersuchung steht dabei Aichingers literarische Darstellung des unvorstellbaren und unaussprechlichen Grauens in ihrem Roman "Die größere Hoffnung", welches die kindlichen Protagonisten des Romans erfahren und individuell wahrnehmen. Ziel der Arbeit ist es somit, aufzuzeigen, mit welchen sprachlichen Mitteln die Autorin das "Unausgesprochene" des Romans, also die historisch belegbaren Fakten und traumatisierenden Schreckensereignisse des Nazi-Regimes, wie auch das "Unaussprechliche", literarisch darstellt.
Das "Unaussprechliche" des Romans kann dabei als das über die kindlichen Protagonisten hereinbrechende Grauen und als der lauernde Tod gesehen werden. Im Rahmen dieser Arbeit steht daher die Untersuchung der sprachlichen Darstellung der Inhalte im Vordergrund, um die damit verbundenen und dadurch evozierten Vorstellungen, Eindrücke und Konnotationen der Rezipienten analysieren zu können. Hinsichtlich der spezifischen Rezeptionswirkung und insbesondere im Rahmen dieser Arbeit ist auch die kulturelle und historisch-kontextuelle Einbettung des literarischen Werks von wesentlicher Bedeutung.
Die Analyse zentraler Episoden des Romans soll demnach aufzeigen, dass durch die Sprachkunst Aichingers eine besonders eindrucksvolle Wirkung erzielt wird, die es dem Rezipienten erlaubt, Vorstellungen, Emotionen und Erlebnisse zu erfassen, welche durch Worte allein nicht begreifbar sind. Die höchst metaphorischen und meist mehrdeutigen Sprachbilder Aichingers erschaffen eine veränderte Sichtweise der Rezipienten und ermöglichen die Auflösung herkömmlicher Denkweisen sowie die Neubildung alternativer Denkmuster.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Teil und Methodik der Analyse
- Einleitung
- Das Unfassbare in Worte fassen
- Ausdruck des Unaussprechlichen
- Das Unausgesprochene
- Das Unaussprechliche
- Die veränderte Perspektive – aus den Augen der Kinder
- Überleben durch Spiel und Imagination
- Ausdruck des Unaussprechlichen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Ilse Aichingers Roman "Die größere Hoffnung" und analysiert, wie der Text das Unaussprechliche aus der Perspektive des Kindes thematisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung der sprachlichen Mittel, die Aichinger einsetzt, um das Unfassbare in Worte zu fassen und die Rezeptionsprozesse des Lesers zu beeinflussen.
- Die Darstellung des Unaussprechlichen durch sprachliche Mittel
- Die Perspektive des Kindes im Roman
- Die Rolle von Spiel und Imagination im Umgang mit dem Unfassbaren
- Der Einfluss der Sprache auf die Sinnkonstitution des Lesers
- Die Bedeutung von kognitiven Modellen in der Rezeption des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
Der theoretische Teil der Arbeit stellt die Methodik der Analyse vor. Es wird ein rezeptions- und kognitionswissenschaftlicher Ansatz gewählt, der sich auf die sprachästhetischen Eigenschaften des Romans konzentriert. Im ersten Kapitel wird die Einleitung präsentiert. Das dritte Kapitel widmet sich der Darstellung des Unaussprechlichen im Roman, wobei die verschiedenen Ausdrucksformen des Unausgesprochenen und Unaussprechlichen untersucht werden. Die veränderte Perspektive aus den Augen der Kinder sowie die Bedeutung von Spiel und Imagination im Umgang mit dem Unfassbaren werden in den folgenden Kapiteln behandelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Ilse Aichinger, "Die größere Hoffnung", Unaussprechliches, Kinderperspektive, Sprache, kognitive Poetik, Rezeption, Sinnkonstitution, Spiel, Imagination, kulturelle Modelle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Analyse von Ilse Aichingers Roman?
Die Arbeit untersucht die Darstellung des „Unaussprechlichen“ (des Holocaust-Grauens) aus der Perspektive von Kindern in dem Roman „Die größere Hoffnung“.
Welche Rolle spielt die Kinderperspektive in diesem Werk?
Die Kinderperspektive dient als veränderte Erzählform, die es ermöglicht, das Grauen durch Spiel und Imagination individuell wahrzunehmen und literarisch zu verarbeiten.
Wie unterscheidet die Autorin zwischen dem „Unausgesprochenen“ und dem „Unaussprechlichen“?
Das Unausgesprochene bezieht sich auf historisch belegbare Fakten, während das Unaussprechliche das metaphysische Grauen und den lauernden Tod beschreibt.
Welche sprachlichen Mittel nutzt Ilse Aichinger?
Aichinger verwendet hochpoetische, metaphorische und mehrdeutige Sprachbilder, um Emotionen und Erlebnisse zu fassen, die über rein sachliche Worte hinausgehen.
Welche methodische Herangehensweise wird in der Arbeit gewählt?
Es wird ein rezeptions- und kognitionswissenschaftlicher Ansatz (kognitive Poetik) gewählt, um die Wirkung der Sprache auf den Leser zu analysieren.
- Citar trabajo
- Carina Thaler (Autor), 2019, Das Unaussprechliche aus der Perspektive des Kindes in Ilse Aichingers "Die größere Hoffnung", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509919