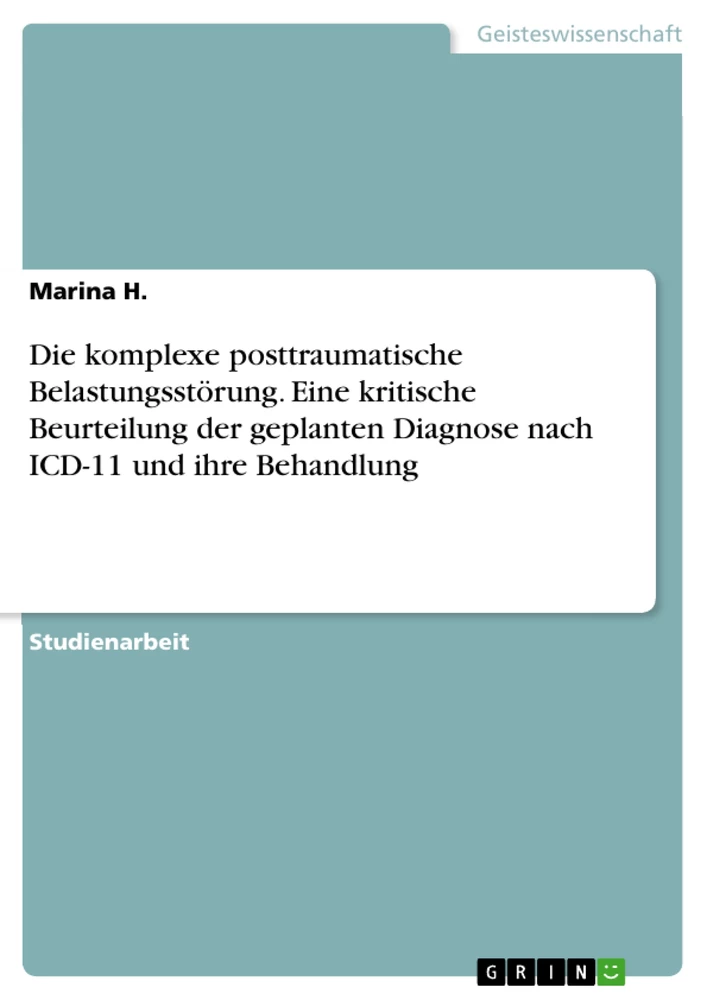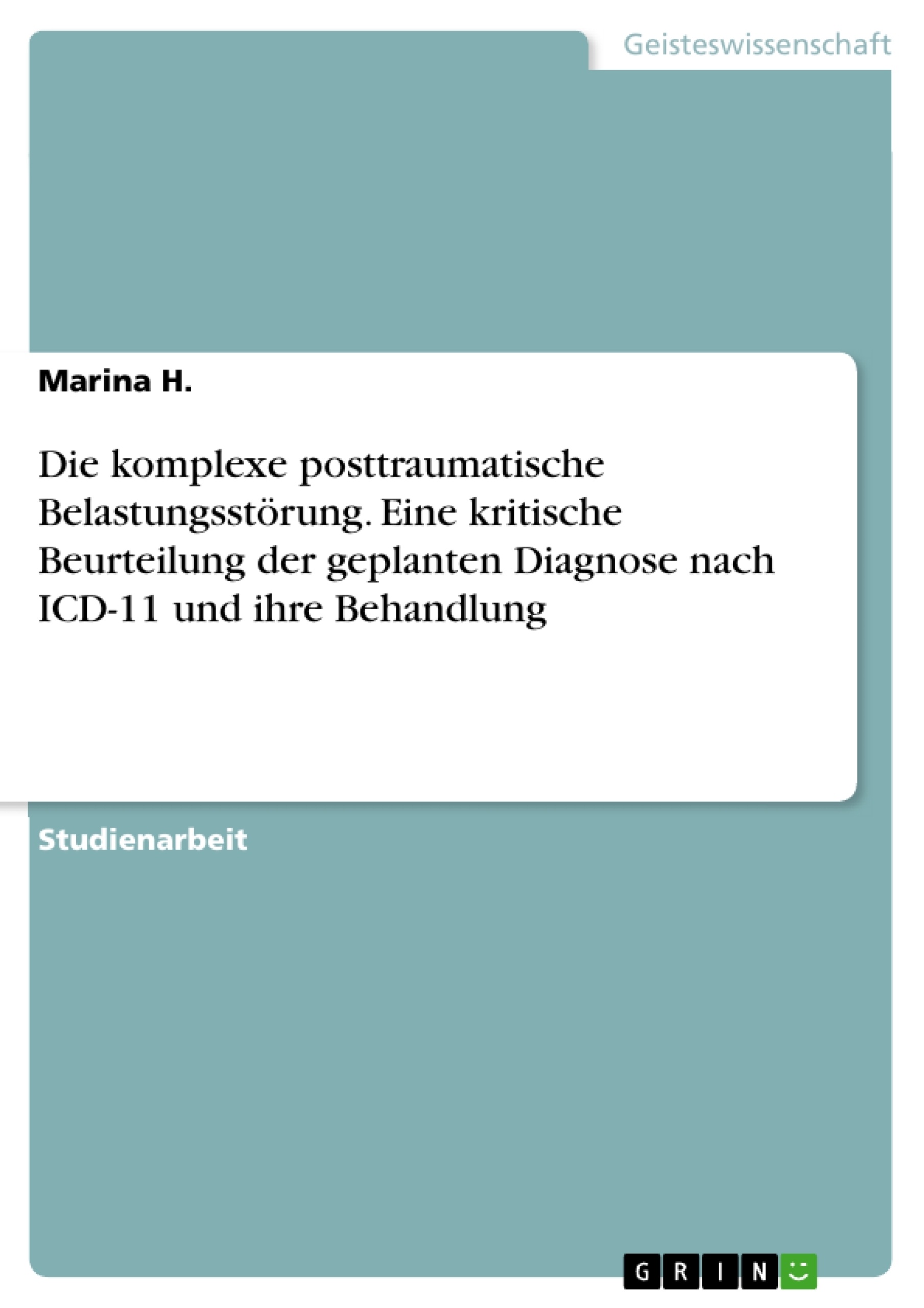Die geplante Einführung der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (K-PTBS) als geplante Diagnose des ICD-11 hat in der Forschungsliteratur für viel Diskussion gesorgt. Die Einführung der neuen Diagnose bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich.
Gegen die Einführung spricht, dass sie Diagnose der komplexen PTBS einen unidirektionalen Zusammenhang zwischen dem traumatischen Ereignis und dem Symptom Emotionsregulation impliziert, wobei in einigen Fällen auch eine umgekehrte Ursache-Wirkungsbeziehung denkbar wäre. Ebenfalls besteht eine symptomatische Ähnlichkeit der komplexen PTBS mit der PTBS inklusive einer komorbiden Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS). Bei genauerem Hinsehen ist allerdings zu dem Schluss zu kommen, dass sich die Symptome in ihren Ausprägungen ausreichend voneinander unterscheiden. Im Hinblick auf die Beurteilung des Klinischen Nutzens, welcher insbesondere bei dem ICD-10 als defizitär kritisiert wurde, ist zunächst festzustellen, dass die Unterteilung in klassische und komplexe PTBS mit einer Erhöhung der Komplexität des Diagnosesystems einhergeht. Eine hohe Komplexität geht dann mit einem niedrigen Klinischen Nutzen einher, wenn diese außerhalb des Forschungskontexts nicht notwendig ist. Jedoch lässt sich damit die Symptomatik einiger Patienten spezifischer und differenzierter abbilden, wodurch eine passgenauere Behandlung abgeleitet werden kann. Die Validität der Diagnose konnte durch statistische Verfahren wie der latent- profile analysis (LPA) und der konfirmatorischen Faktorenanalyse nachgewiesen werden.
Als Therapiemaßnahme der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung hat sich eine multimodale Behandlung etabliert, die innerhalb einer von der ISTSS veranlassten Expertenbefragung gewonnen wurde. Sie enthält drei aufeinanderfolgende Phasen, die jeweils ihren eigenen Schwerpunkt setzen: (1) Stabilisierung, (2) Konfrontation und (3) Teilnahme am Gemeinschaftsleben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Abgrenzung der komplexen PTBS von der PTBS
- Ereignisse, die zu einer K-PTBS bzw. einer PTBS führen können
- Abgrenzung der K-PTBS von der PTBS anhand der Symptome
- Vor- und Nachteile der Unterscheidung der komplexen PTBS und der PTBS als distinkte Diagnosen
- Behandlung der K-PTBS
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Textes ist eine kritische Beurteilung der geplanten Diagnose der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (K-PTBS) im ICD-11 und deren Behandlung. Der Text beleuchtet die Abgrenzung der K-PTBS von der PTBS, untersucht die Vor- und Nachteile der Unterscheidung beider Diagnosen und geht auf die Therapie der K-PTBS ein.
- Abgrenzung der K-PTBS von der PTBS hinsichtlich der auslösenden Ereignisse und Symptome
- Analyse der Vor- und Nachteile der Einführung der K-PTBS als eigenständige Diagnose
- Beschreibung der multimodalen Therapieansätze bei K-PTBS
- Diskussion der Validität der K-PTBS Diagnose
- Bewertung des klinischen Nutzens der Unterscheidung zwischen PTBS und K-PTBS
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Der Text führt in die Thematik der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (K-PTBS) ein, die im ICD-11 als eigenständige Diagnose geplant ist, im Gegensatz zum DSM-V. Er hebt die wachsende Zahl empirischer Studien hervor, die auf grundlegende Unterschiede zwischen K-PTBS und PTBS hinweisen. Der Text skizziert den weiteren Aufbau, der die Abgrenzung der K-PTBS von der PTBS, die Unterscheidung der auslösenden Ereignisse und Symptome, sowie die Vor- und Nachteile der getrennten Diagnosen behandeln wird, um schließlich Therapieempfehlungen auszusprechen.
Abgrenzung der komplexen PTBS von der PTBS: Dieses Kapitel differenziert die K-PTBS von der PTBS anhand der Art der traumatisierenden Ereignisse und der resultierenden Symptome. Es wird zwischen akzidentellen (Typ-I) und interpersonellen (Typ-II) Traumata unterschieden, wobei letztere, insbesondere langandauernde, häufiger zu einer K-PTBS führen. Obwohl beide Störungen eine symptomatische Überschneidung aufweisen, werden spezifische Merkmale der K-PTBS, wie Emotionsregulationsprobleme, Selbstkonzeptveränderungen, Beziehungsstörungen und Dissoziation, hervorgehoben. Die Diagnose K-PTBS setzt neben den Kernsymptomen der PTBS das Vorhandensein mindestens eines Symptoms aus diesen vier Bereichen voraus.
Vor- und Nachteile der Unterscheidung der komplexen PTBS und der PTBS als distinkte Diagnosen: Dieses Kapitel behandelt die kontroverse Diskussion um die Einführung der K-PTBS. Ein Nachteil ist die implizierte unidirektionale Beziehung zwischen Trauma und Emotionsregulation, während eine umgekehrte Kausalität ebenfalls denkbar ist. Die symptomatische Ähnlichkeit mit der PTBS und komorbider BPS wird angesprochen, jedoch wird argumentiert, dass sich die Ausprägungen der Symptome ausreichend unterscheiden. Bezüglich des klinischen Nutzens wird die erhöhte Komplexität des Diagnosesystems diskutiert, die zwar zu einer differenzierteren Abbildung der Symptomatik und passgenaueren Behandlung führen kann, aber außerhalb des Forschungskontextes auch zu einem niedrigeren Nutzen führen könnte. Die Validität der Diagnose wird durch statistische Verfahren wie LPA und konfirmatorische Faktorenanalyse belegt.
Behandlung der K-PTBS: Dieses Kapitel beschreibt die etablierte multimodale Behandlung der K-PTBS, basierend auf einer ISTSS-Expertenbefragung. Diese umfasst drei Phasen: (1) Stabilisierung, (2) Konfrontation und (3) Teilnahme am Gemeinschaftsleben. Die Einzelheiten jeder Phase werden im Detail erläutert und begründet, um ein umfassendes Verständnis der Therapie zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Behandlung der komplexen Symptomatik, die über die Kernsymptome der PTBS hinausgeht.
Schlüsselwörter
Komplexe posttraumatische Belastungsstörung (K-PTBS), Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), ICD-11, DSM-V, Traumatisierung, Emotionsregulation, Selbstkonzept, Beziehungsfähigkeit, Dissoziation, multimodale Therapie, klinischer Nutzen, Validität, latent-profile analysis (LPA), konfirmatorische Faktorenanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (K-PTBS)
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über die komplexe posttraumatische Belastungsstörung (K-PTBS), insbesondere im Hinblick auf die geplante Aufnahme als eigenständige Diagnose im ICD-11. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung der K-PTBS von der PTBS, der Analyse der Vor- und Nachteile dieser Unterscheidung als eigenständige Diagnose und der Beschreibung multimodaler Therapieansätze.
Wie unterscheidet sich die K-PTBS von der PTBS?
Der Text differenziert die K-PTBS von der PTBS anhand der Art der traumatisierenden Ereignisse (akzidentell vs. interpersonell, langandauernd) und der resultierenden Symptome. Während beide Störungen symptomatische Überschneidungen aufweisen, hebt der Text spezifische Merkmale der K-PTBS hervor, wie z.B. Probleme mit der Emotionsregulation, Veränderungen des Selbstkonzepts, Beziehungsstörungen und Dissoziation. Die Diagnose K-PTBS setzt neben den Kernsymptomen der PTBS das Vorhandensein mindestens eines Symptoms aus diesen vier Bereichen voraus.
Welche Vor- und Nachteile hat die Unterscheidung von K-PTBS und PTBS?
Die Einführung der K-PTBS als eigenständige Diagnose wird kontrovers diskutiert. Ein möglicher Nachteil ist die implizierte unidirektionale Beziehung zwischen Trauma und Emotionsregulation, während eine umgekehrte Kausalität ebenfalls denkbar ist. Die symptomatische Ähnlichkeit mit der PTBS und komorbider BPS wird angesprochen, aber die Ausprägungen der Symptome werden als ausreichend unterschiedlich betrachtet. Der klinische Nutzen wird kritisch beleuchtet: Eine differenziertere Abbildung der Symptomatik und passgenauere Behandlung stehen einer erhöhten Komplexität des Diagnosesystems gegenüber, die außerhalb des Forschungskontextes zu einem niedrigeren Nutzen führen könnte. Die Validität der Diagnose wird durch statistische Verfahren belegt.
Wie wird die K-PTBS behandelt?
Der Text beschreibt die etablierte multimodale Behandlung der K-PTBS, basierend auf einer ISTSS-Expertenbefragung. Diese umfasst drei Phasen: (1) Stabilisierung, (2) Konfrontation und (3) Teilnahme am Gemeinschaftsleben. Die Einzelheiten jeder Phase werden detailliert erläutert, wobei der Fokus auf der ganzheitlichen Behandlung der komplexen Symptomatik liegt, die über die Kernsymptome der PTBS hinausgeht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Komplexe posttraumatische Belastungsstörung (K-PTBS), Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), ICD-11, DSM-V, Traumatisierung, Emotionsregulation, Selbstkonzept, Beziehungsfähigkeit, Dissoziation, multimodale Therapie, klinischer Nutzen, Validität, latent-profile analysis (LPA), konfirmatorische Faktorenanalyse.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst folgende Kapitel: Einführung, Abgrenzung der komplexen PTBS von der PTBS (inkl. Unterkapitel zu auslösenden Ereignissen und Symptomen), Vor- und Nachteile der Unterscheidung der komplexen PTBS und der PTBS als distinkte Diagnosen, Behandlung der K-PTBS und Diskussion und Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt auf eine kritische Beurteilung der geplanten Diagnose der K-PTBS im ICD-11 und deren Behandlung ab. Er beleuchtet die Abgrenzung zur PTBS, untersucht Vor- und Nachteile der Unterscheidung beider Diagnosen und geht auf die Therapie der K-PTBS ein.
- Quote paper
- Marina H. (Author), 2019, Die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Eine kritische Beurteilung der geplanten Diagnose nach ICD-11 und ihre Behandlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509800