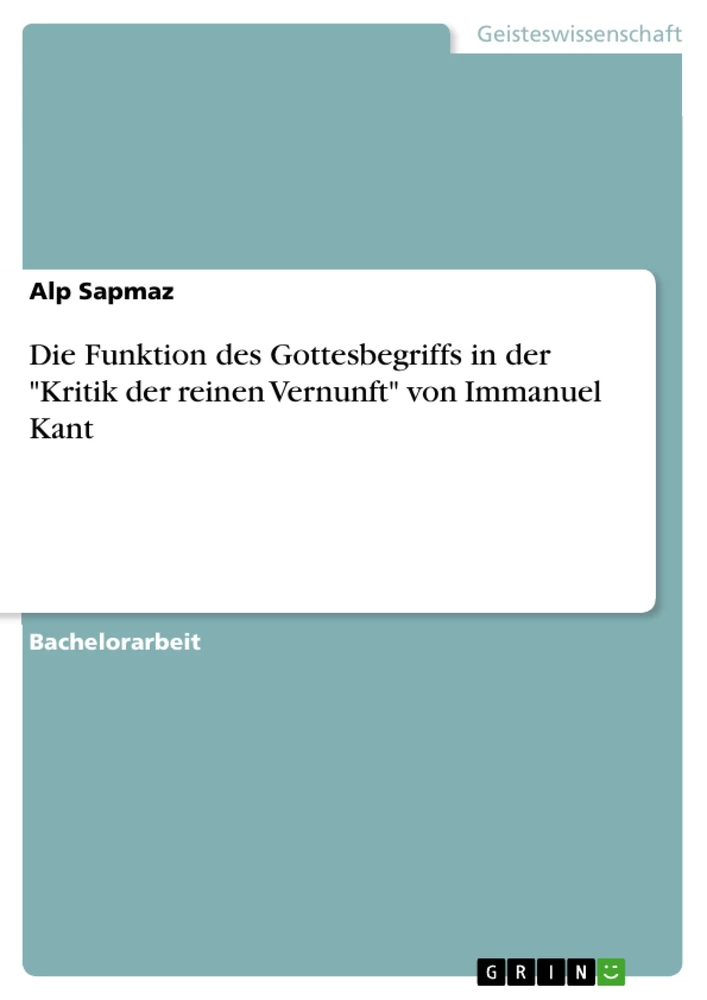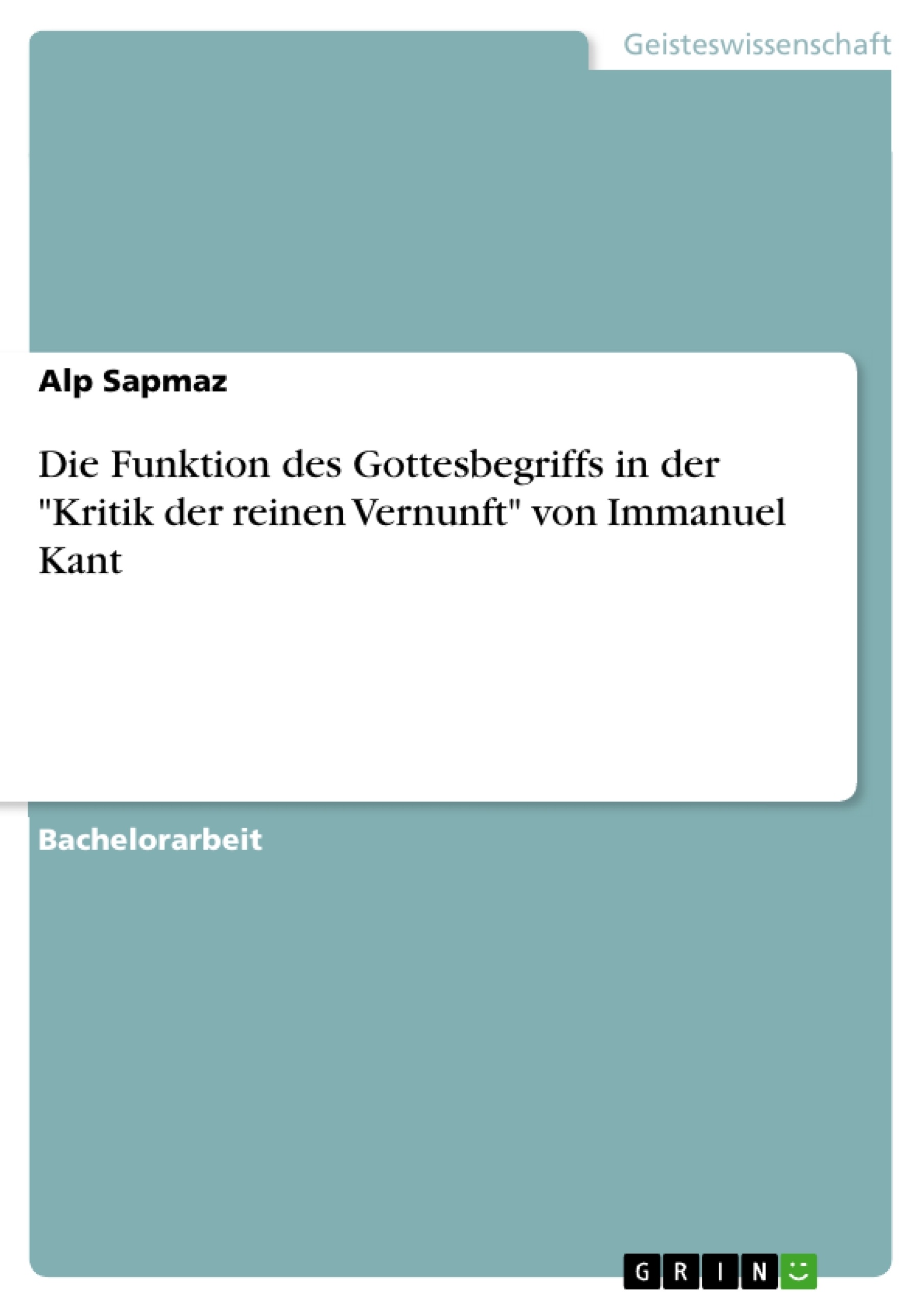In der Arbeit wird der Versuch unternommen, dem einseitigen Verständnis von Kants Metaphysikkritik ein komplexeres und angemesseneres Bild entgegenzuhalten, das Kant aus einer in der Forschung bisher nur selten untersuchten Perspektive zeigt: nämlich nicht als "Alleszermalmer", sondern als Bewahrer der metaphysischen Tradition. Dies soll anhand der positiven Bestimmung der erkenntnistheoretischen Funktion des Gottesbegriffs exemplarisch vor Augen geführt werden. Liest man Kant genau, so wird man erkennen, dass Kant die aus der abendländischen Denktradition stammenden Begriffe (Seele, Weltganzes und Gott) nicht für unsinnig erklärt, sondern ihnen ganz im Gegenteil - auch in seiner theoretischen Philosophie - eine zentrale Rolle zuweist.
Mit dem Erscheinen der "Kritik der reinen Vernunft" im Jahre 1781 hat Kant nicht nur die philosophische Landschaft tiefgreifend verändert, sondern zugleich die Koordinaten für das moderne Denken festgelegt. Es ist das Verdienst der "kopernikanischen Wende", dass das erkennende Subjekt radikaler als je zuvor in den Fokus philosophischer Untersuchungen gerückt worden ist und sich die bis in die gegenwärtige Zeit hineinreichende Einsicht im abendländischen Denken verankert hat, dass der Schlüssel zur Welterkenntnis nur in den Erkenntnisstrukturen des erkennenden Subjekts selbst liegen kann.
Mit dieser Besinnung auf die Vorgänge des eigenen Erkenntnisvermögens geht für Kant aber auch die von vielen Philosophen als Affront empfundene kritische Selbstbegrenzung der erkennenden Vernunft einher. Die für die spezielle Metaphysik zentralen Untersuchungsgegenstände wie etwa die Seele, das Weltganze und Gott sind nach Kant keine Gegenstände des Wissens, sondern die des Glaubens. Kant, dem aufgrund seiner radikalen Kritik an der abendländischen Metaphysik von Mendelssohn das Etikett "Alleszermalmer" aufgedrückt wurde, ist in der Tat hauptsächlich für seine metaphysikkritischen Ansichten bekannt und wird nicht allzu selten als Gewährsmann in Anspruch genommen, wenn es darum geht, die Gültigkeit diverser Gottesbeweise oder der Existenz einer unsterblichen, einfachen Seele zu widerlegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Transzendentale Dialektik
- Die Genese des Gottesbegriffs
- Das Transzendentale Ideal
- Die Gottesbeweise
- Meinen, Wissen und Glauben
- Die erkenntnistheoretische Funktion
- Gott als regulatives Prinzip
- Thöles Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die erkenntnistheoretische Funktion des Gottesbegriffs in Kants Kritik der reinen Vernunft. Der Fokus liegt auf der Analyse des Gottesbegriffs im Kontext der Transzendentalen Dialektik und der epistemischen Einstellung, die in Bezug auf den Gottesbegriff möglich ist. Die Arbeit untersucht zudem die Bedeutung des Gottesbegriffs für den Erkenntnisprozess und beleuchtet die verschiedenen Interpretationen des Gottesbegriffs in Kants Werk.
- Die Transzendentale Dialektik und der Gottesbegriff
- Der ontologische Status des Gottesbegriffs
- Die epistemischen Einstellungen zum Gottesbegriff (Meinen, Wissen, Glauben)
- Die erkenntnistheoretische Funktion des Gottesbegriffs
- Kritik an den Gottesbeweisen und der Bedeutung des Gottesbegriffs für den Erkenntnisprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die historische Relevanz der Frage nach Gott in der Philosophie und stellt Kants Position im Kontext der Debatte um die Existenz Gottes dar. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Transzendentalen Dialektik, ihren zentralen Inhalten und ihrer Bedeutung für Kants Philosophie. Das zweite Kapitel analysiert den ontologischen Status des Gottesbegriffs, indem es die Genese des Gottesbegriffs untersucht und die Unterscheidung zwischen reinen Verstandesbegriffen, Ideen und dem transzendentalen Ideal herausarbeitet. Im Anschluss werden die Gottesbeweise Kants untersucht und gezeigt, warum diese aus seiner Sicht der „unvermeidlichen Illusion“ des transzendentalen Scheins erliegen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der epistemischen Einstellung, die nach Kant in Bezug auf den Gottesbegriff möglich ist, und befasst sich mit den Begriffen des Meinens, Wissens und Glaubens. Das vierte Kapitel untersucht die erkenntnistheoretische Funktion des Gottesbegriffs, indem es auf die Überlegungen von Ottfried Höffes und Bernhard Thöles zurückgreift. Hier wird die Frage untersucht, ob der Gottesbegriff in Kants Werk als regulatives Prinzip oder als rein negative Kritik zu verstehen ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Kritik der reinen Vernunft, dem Gottesbegriff, der Transzendentalen Dialektik, der Ontologie, der Epistemologie, den Gottesbeweisen, dem ontologischen Status, der epistemischen Einstellung, dem Meinen, Wissen, Glauben, dem regulativen Prinzip und dem transzendentalen Schein.
- Quote paper
- Alp Sapmaz (Author), 2017, Die Funktion des Gottesbegriffs in der "Kritik der reinen Vernunft" von Immanuel Kant, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509526