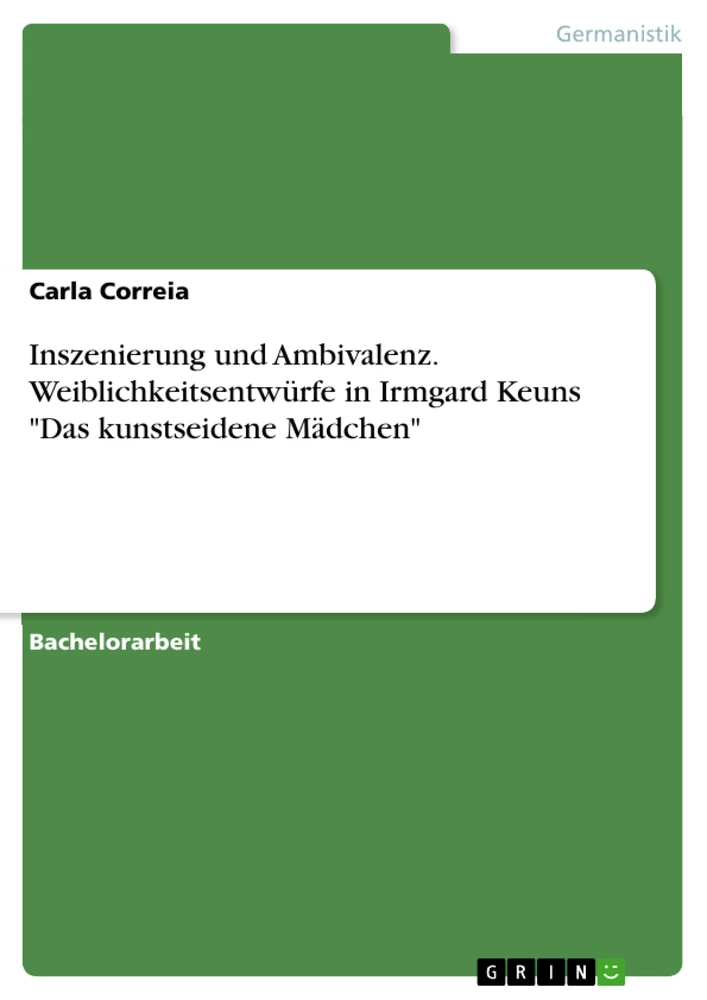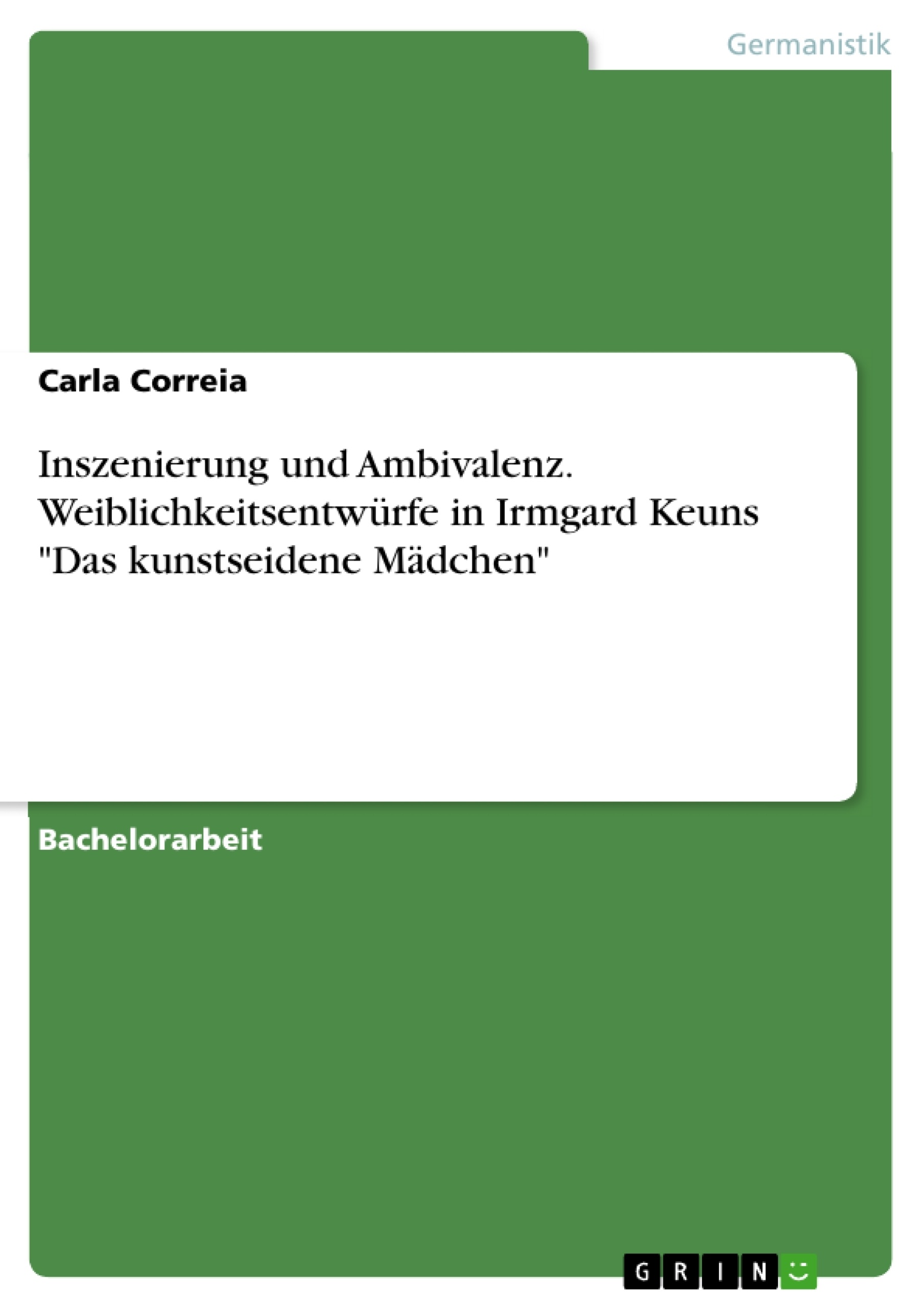In der Weimarer Republik zeigen sich nicht nur auf politischer und wirtschaftlicher Ebene beträchtliche Veränderungen. Auch im Hinblick auf die weibliche Bevölkerung gab es großartige Reformen, die es den Frauen ermöglichten, sich neu zu finden und eigene Prinzipien zu entwickeln – ganz unabhängig vom Mann. Die moderne Neue Frau ließ mithilfe ihrer Bildung, ihrem Auftreten, aber vor allem ihrer Erscheinung die gesellschaftlichen Schichtunterschiede verschwimmen, wodurch auch der ehrgeizige Wunsch wuchs, vom Klein- in das Großbürgertum aufzusteigen.
Dieser neuen Erscheinung und dem Ziel, mit konventionellen Grenzen zu brechen, nimmt sich Irmgard Keun in dem Roman "Das kunstseidene Mädchen" (1932) an. Ihre Protagonistin, die aus personaler Erzählsicht ihre Erfahrungen auf ihrem Weg ein "Glanz zu werden", mit dem Leser teilt, wird in der Literaturwissenschaft oftmals als Repräsentantin dieser Neuen Frau definiert. Keun thematisiert in ihrem Roman nicht nur den Bruch mit sozialen Gruppen, sondern legt die Hindernisse, auf die ein unterprivilegiertes Mädchen treffen kann, offen dar.
Wie bereits vermutet werden kann, ist die Möglichkeit, in das Großbürgertum aufzusteigen, nur den wenigsten vorbehalten und gleicht vielmehr einer Illusion. Da die Protagonistin Doris als Repräsentantin der Neuen Frau diesem Ideal folgt, erschien es interessant, ihre fiktive Persönlichkeit genauer zu betrachten, um überprüfen zu können, ob es sich eventuell nicht doch nur um eine Anlehnung an den neuen modernen Frauentyp handelt, oder ob die Protagonistin tatsächlich dem theoretischen Abbild entspricht.
Deshalb ist Ziel dieser Arbeit nachzuweisen, dass die fiktionale Doris ambivalente Persönlichkeitsmerkmale aufweist, wovon manche dem Charakter der Neuen Frau entsprechen, andere wiederum konventionelle Ansichten repräsentieren und sie deshalb keinesfalls dem theoretischen Ideal der modernen neuen Frau entspricht, wie jenem der Garçonne beispielsweise, und nur allerhöchstens ein Abbild des Frauentyps Girl ist. Außerdem soll belegt werden, dass sie auf ihrem Weg "ein Glanz werden" zu wollen als inszenierte und nicht als authentische Figur erscheint, was ebenfalls den Beweis für die gescheiterte Abbildung der neuen Frau erbringt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die (Neue) Frau der Zwanziger Jahre
- Frauenbilder und Weiblichkeitserscheinungen
- Mode als Ausdrucksform
- Zur literarischen Darstellung der Neuen Frau
- Frauenfiguren in Das kunstseidene Mädchen
- Doris als Repräsentantin der modernen „Neuen Frau“?
- Mode und „Glanz“
- „Ein Glanz werden“ – Mode, Inszenierung oder doch Illusion?
- Kunstseiden als Symbol
- Der Feh - der Abschluss einer gestrandeten Illusion
- Liebe, Partnerschaft und Sexualität
- Zum Status der männlichen Figuren bei Doris
- Doris als Objekt des Begehrens
- Doris' (scheiternde) Lebensentwürfe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die ambivalente Darstellung der weiblichen Protagonistin Doris im Roman "Das kunstseidene Mädchen" von Irmgard Keun. Ziel ist es, zu belegen, dass Doris zwar einige Merkmale der „Neuen Frau“ der 1920er Jahre aufweist, aber dennoch nicht dem theoretischen Idealbild entspricht. Der Fokus liegt auf Doris' inszenierter Inszenierung von „Glanz“ als Ausdruck des Scheiterns des modernen Frauenbilds.
- Ambivalenz der weiblichen Protagonistin Doris
- Die „Neue Frau“ in den 1920er Jahren
- Die Rolle von Mode und Inszenierung in der Darstellung von Weiblichkeit
- Das Scheitern von Doris' Lebensentwürfen
- Die Inszenierung von „Glanz“ als Illusion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den historischen Kontext der „Neuen Frau“ der 1920er Jahre. Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen Veränderungen, die Emanzipation der Frauen und die neuen Lebensentwürfe, die durch den Wandel der Geschlechterrollen möglich wurden. Es werden Themen wie Mode als Ausdruck von Weiblichkeit und die Rolle der Frau in Ehe, Sexualität und Partnerschaft behandelt.
Im zweiten Teil werden diese theoretischen Konzepte mit der literarischen Darstellung der „Neuen Frau“ in Irmgard Keuns Roman "Das kunstseidene Mädchen" verbunden. Es werden Parallelen zwischen den im ersten Kapitel beschriebenen Frauenbildern und den Figuren des Romans gezogen, wobei der Fokus auf der weiblichen Hauptfigur Doris liegt.
Das dritte Kapitel untersucht die Bedeutung von Mode und „Glanz“ in Doris' Streben nach einem neuen Leben. Hier wird analysiert, wie Doris durch Inszenierung und Illusion versucht, den Schein einer modernen Frau zu erzeugen. Besonderes Augenmerk wird auf das Symbol des Kunstseidens gelegt, das die oberflächliche Natur von Doris' Selbstfindung widerspiegelt.
Schließlich beleuchtet das vierte Kapitel die Rolle der männlichen Figuren im Leben von Doris. Es wird gezeigt, wie Doris Männer ausnutzt, um ihr Ziel des „Glanzes“ zu erreichen, aber letztlich selbst zum Objekt des Begehrens wird. Dieses Kapitel analysiert die Scheiterns von Doris' Lebensentwürfen und verdeutlicht die Ambivalenz ihrer Persönlichkeit.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der „Neuen Frau“, Weiblichkeit, Inszenierung, Illusion, Mode, Kunstseide, Scheitern und Lebensentwürfe im Kontext des Romans "Das kunstseidene Mädchen" von Irmgard Keun. Die Analyse beleuchtet die ambivalente Darstellung der weiblichen Protagonistin Doris und ihre widersprüchlichen Bestrebungen, den konventionellen Frauenrollen zu entfliehen. Die Arbeit vertieft die Diskussion um die Rolle von Mode und gesellschaftlichen Erwartungen in der Konstruktion weiblicher Identität und beleuchtet die gesellschaftlichen und kulturellen Umwälzungen der 1920er Jahre.
- Quote paper
- Carla Correia (Author), 2018, Inszenierung und Ambivalenz. Weiblichkeitsentwürfe in Irmgard Keuns "Das kunstseidene Mädchen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509378