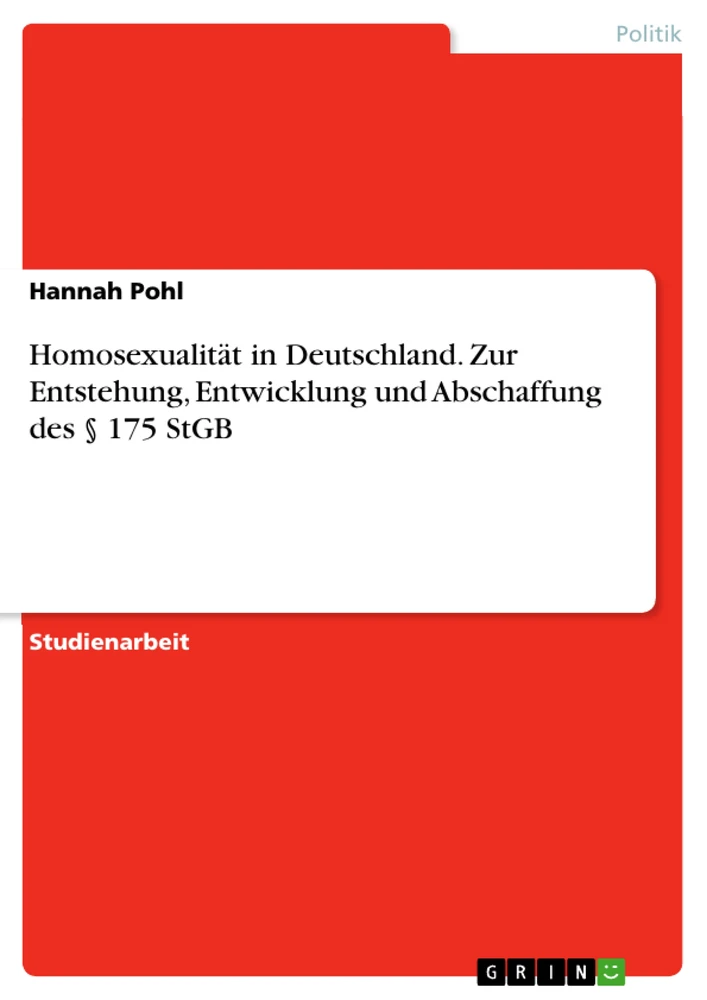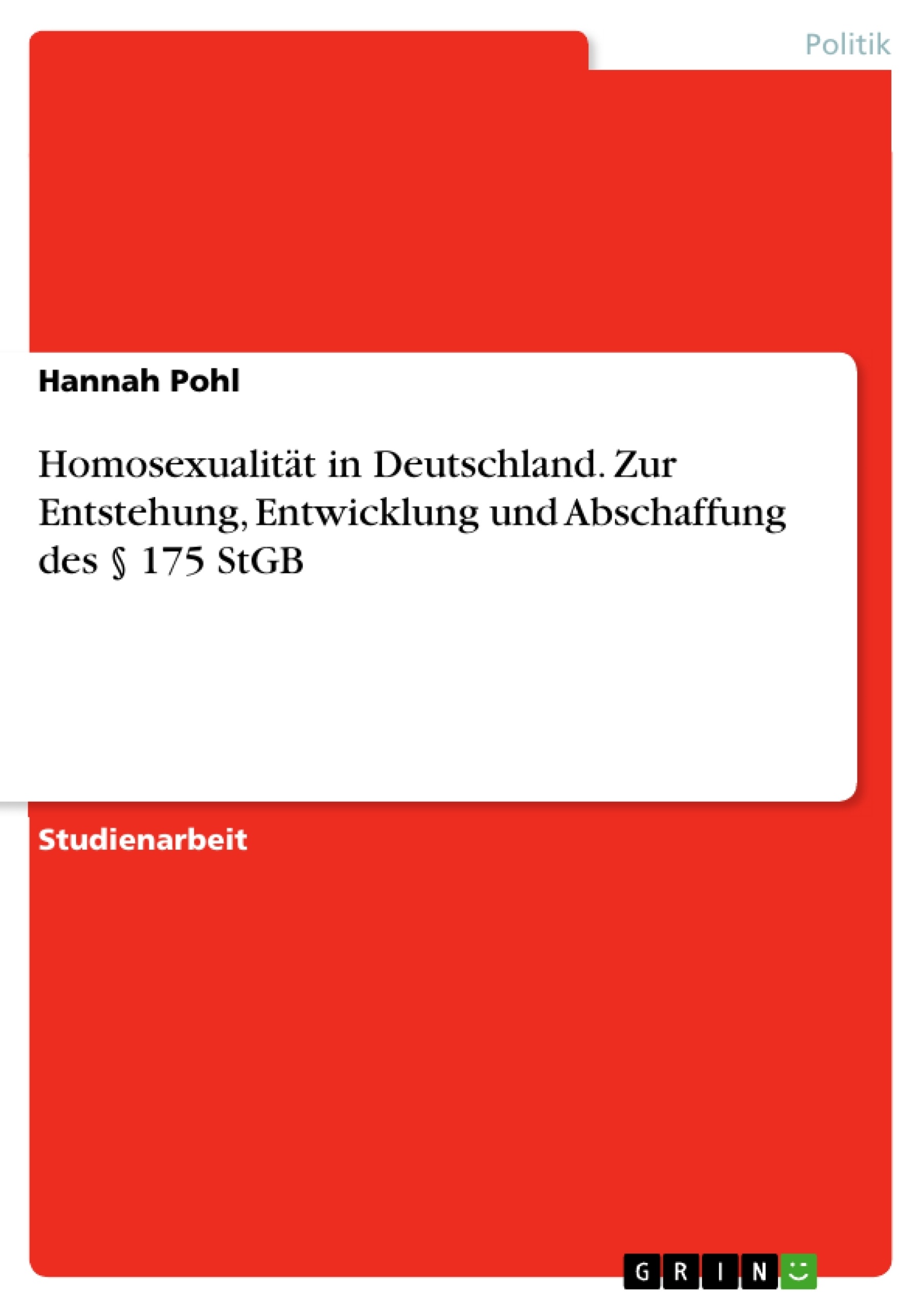In Deutschland ist Andersartigkeit kein Problem. Alle Bürger sind frei und gleich und werden vor dem Gesetz auch so behandelt. Inbesondere private Teile des Lebens haben keinen Einfluss auf Benachteiligung oder Bevorzugung einer Person haben. Oder?
Eine derartige Sichtweise und Auslebung von Individualität ist in Deutschland jedoch lange Zeit undenkbar gewesen. Der Paragraph 175 im Strafgesetzbuch hat über Dekaden festgelegt, dass die Auslebung der männlichen Homosexualität unter Strafe steht.
Ziel dieser Arbeit ist es, die vier Fassungen des §175 in deskriptiver Art und Weise in deren historischen Kontext einzubetten. Zudem werden Anstrengungen unternommen, um herauszustellen, wie und warum es zu Änderungen der jeweils aktuellen Versionen gekommen ist. Innerhalb von rund 120 Jahren wurde der Paragraph erst merklich verschärft und schließlich aufgehoben. Die Abschaffung des genannten Gesetzestextes kann als Bruch mit den verbreiteten homophoben Einstellungen gegenüber sexuell Andersartiger, die über Jahrhunderte in Deutschland und Europa präsent war, aufgefasst werden. Sie stellt einen Meilenstein für die Emanzipation Homosexueller in Deutschland dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Homophobie als europäische Tradition
- 2 Gesetzesentwicklung des Paragraphen 175 und historische Einbettung
- 2.1 Erste Fassung des Paragrafen 175 im Kaiserreich und der Weimarer Republik (1871-1935)
- 2.2 Zweite Fassung des Paragrafen 175 im Dritten Reich und der Nachkriegszeit (1935-1969)
- 2.3 Dritte Fassung des Paragrafen 175 (1969-1973)
- 2.4 Vierte Fassung des Paragrafen und Abschaffung (1973-1994)
- 3 Probleme und Perspektiven für das Kommende
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung, Entwicklung und Abschaffung des Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches (StGB), der männliche Homosexualität unter Strafe stellte. Ziel ist die deskriptive Darstellung der vier Fassungen des §175 in ihrem historischen Kontext und die Analyse der Gründe für die jeweiligen Änderungen. Die Abschaffung des Paragraphen wird als Meilenstein für die Emanzipation Homosexueller in Deutschland betrachtet.
- Die historische Entwicklung des §175 StGB über vier Fassungen.
- Die gesellschaftlichen und juristischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Zeitabschnitte.
- Der Wandel der Wahrnehmung von Homosexualität von „Sodomiten“ zu „kranken“ Individuen.
- Die Rolle von Akteuren, die sich für eine Liberalisierung des Strafrechts einsetzten.
- Die Bedeutung der öffentlichen Wahrnehmung für den Prozess der Gesetzesänderung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Homophobie als europäische Tradition: Dieses Kapitel verortet die Kriminalisierung männlicher Homosexualität in einem europäischen und historischen Kontext. Es zeigt die lange Tradition homophober Einstellungen und die Verurteilung sexueller Handlungen, die nicht der Fortpflanzung dienen, beginnend mit dem Mittelalter und der Kirche. Die Darstellung der Constitutio Criminalis Carolina von 1532, welche gleichgeschlechtliche Handlungen mit der Todesstrafe belegte, unterstreicht die historische Kontinuität. Der Artikel 3 III GG wird als Kontrast dargestellt, um die heutige Rechtslage zu verdeutlichen und den Wandel zu betonen. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der Entstehung des §175 StGB im 19. Jahrhundert als Folge einer säkularisierten, aber immer noch homophoben Gesellschaftsordnung.
2 Gesetzesentwicklung des Paragraphen 175 und historische Einbettung: Dieses Kapitel analysiert die vier Fassungen des §175 StGB und deren historische Einbettung. Es beschreibt den Wandel der Terminologie von „Sodomiten“ zu „Homosexuellen“ und den damit verbundenen Perspektivwechsel von religiöser Verurteilung zu einer medizinisch-gesellschaftlichen Betrachtung. Der Kapitel beleuchtet, wie Homosexualität von einem Vergehen gegen Gott zu einer gesellschaftlichen Gefahr erklärt wurde, die den Staat gefährdet. Es bildet den Kern der Arbeit und wird die einzelnen Fassungen im Detail beleuchten. Die verschiedenen Versionen des § 175 werden in ihren jeweiligen historischen Kontexten eingeordnet und die Gründe für deren Änderungen werden analysiert.
Schlüsselwörter
Paragraph 175 StGB, Homosexualität, Homophobie, Gesetzesentwicklung, Strafrecht, Geschichte, Deutsches Reich, NS-Zeit, Nachkriegszeit, Emanzipation, Säkularisierung, Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Entwicklung des Paragraphen 175 StGB
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Entstehung, Entwicklung und Abschaffung des Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches (StGB), der männliche Homosexualität unter Strafe stellte. Es analysiert die vier Fassungen des Paragraphen 175 in ihrem historischen Kontext und untersucht die Gründe für die jeweiligen Änderungen. Die Abschaffung des Paragraphen wird als Meilenstein für die Emanzipation Homosexueller in Deutschland betrachtet.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: die historische Entwicklung des §175 StGB über vier Fassungen; die gesellschaftlichen und juristischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Zeitabschnitte; den Wandel der Wahrnehmung von Homosexualität; die Rolle von Akteuren, die sich für eine Liberalisierung des Strafrechts einsetzten; und die Bedeutung der öffentlichen Wahrnehmung für den Prozess der Gesetzesänderung. Es verortet die Kriminalisierung männlicher Homosexualität im europäischen und historischen Kontext und beleuchtet die lange Tradition homophober Einstellungen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 behandelt die Homophobie als europäische Tradition und ihren historischen Kontext. Kapitel 2 analysiert die vier Fassungen des § 175 StGB und deren historische Einbettung, inklusive der gesellschaftlichen und juristischen Rahmenbedingungen. Kapitel 3 befasst sich mit Problemen und Perspektiven für die Zukunft.
Wie wird die Entwicklung des § 175 StGB dargestellt?
Die Entwicklung des § 175 StGB wird chronologisch und detailliert dargestellt, beginnend mit der ersten Fassung im Kaiserreich und der Weimarer Republik, über die zweite Fassung im Dritten Reich und der Nachkriegszeit, bis hin zur dritten und vierten Fassung und seiner endgültigen Abschaffung. Der Wandel der Terminologie und der Perspektivwechsel von religiöser Verurteilung zu einer medizinisch-gesellschaftlichen Betrachtung werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments treffend beschreiben, sind: Paragraph 175 StGB, Homosexualität, Homophobie, Gesetzesentwicklung, Strafrecht, Geschichte, Deutsches Reich, NS-Zeit, Nachkriegszeit, Emanzipation, Säkularisierung, Diskriminierung.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Die Zielsetzung des Dokuments ist die deskriptive Darstellung der vier Fassungen des §175 StGB in ihrem historischen Kontext und die Analyse der Gründe für die jeweiligen Änderungen. Es soll ein Verständnis für die Entwicklung der gesellschaftlichen und juristischen Sichtweise auf Homosexualität vermitteln.
Für welche Zielgruppe ist das Dokument gedacht?
Das Dokument richtet sich an Leser, die sich für die Geschichte des Strafrechts, die Entwicklung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Homosexualität und die Geschichte der Homophobie in Deutschland interessieren. Es ist insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse von Themen im Zusammenhang mit Homosexualität und Diskriminierung geeignet.
- Citar trabajo
- Hannah Pohl (Autor), 2015, Homosexualität in Deutschland. Zur Entstehung, Entwicklung und Abschaffung des § 175 StGB, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/509007