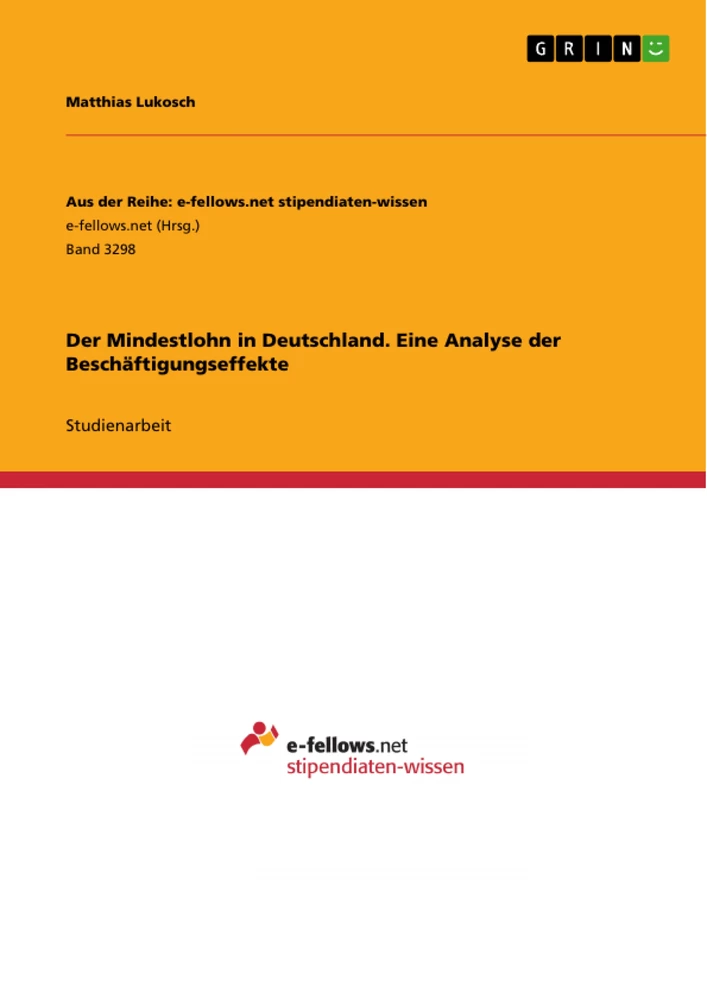In dieser Seminararbeit werden die kurzfristigen Beschäftigungseffekte des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, der seit dem 01.01.2015 in Deutschland auf Basis des Mindestlohngesetzes (MiLoG) gilt, erörtert.
Die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns im Januar 2015 war zweifellos eine der bedeutendsten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen seit den Hartz-Reformen. Bevor der Mindestlohn am 04. Juli 2014 im Bundestag verabschiedet wurde, durchzog die Kontroverse um die Vor- und Nachteile des Mindestlohns den Bundestagswahlkampf
im Jahr 2013. Die Seite, die sich für den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn aussprach, brachte unter anderem folgende Argumente hervor: Ein Mindestlohn sorge für gerechtere Löhne, er reduziere Armut in Personenkreisen mit Beschäftigung im Niedriglohnsegment und die Anzahl der sogenannten Aufstocker, und er sorge für zusätzliches Steueraufkommen. Die Kritiker des Mindestlohns brachten vor allem hervor, dass er massive Beschäftigungsverluste verursachen würde.
Mittlerweile liegt die Einführung des Mindestlohns über vier Jahre zurück, folglich liegt es auf der Hand, die Frage zu formulieren, ob der allgemeine gesetzliche Mindestlohn tatsächlich zu Beschäftigungsverlusten auf den deutschen Arbeitsmärkten geführt hat. Diese Seminararbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst wird ein Blick auf die Definition eines Mindestlohns und den Geltungsbereich des Mindestlohngesetzes (MiLoG) geworfen. Anschließend folgt eine kurze Abgrenzung der von der Reform betroffenen Wirtschaftssubjekte. Im darauffolgenden Kapitel werden anhand zweier theoretischer Arbeitsmarktmodelle die Wirkungen eines Mindestlohns auf die Zielgröße der Beschäftigung erörtert.
Der Abschnitt stellt zwei Hypothesen über die, anhand der Theorie abgeleiteten, Beschäftigungseffekte
eines Mindestlohns in den Raum. Im darauffolgenden Abschnitt wird sowohl die tatsächliche Beschäftigungsentwicklung in Deutschland im Zeitraum von 2014 bis 2017 betrachtet, als auch jene Entwicklungen, die durch geeignete empirische Methoden kausal auf den Mindestlohn zurückführbar sind. Anschließend werden die Hypothesen
und die empirischen Erkenntnisse zusammengeführt, um die aus der Theorie abgeleiteten Hypothesen mit den Erkenntnissen der Empirie zu testen. Das Ziel dieses Vorgehens ist, die oben aufgeworfene Frage nach den Beschäftigungseffekten eines Mindestlohn zu evaluieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Institutionelles
- Definition und Geltungsbereich
- Betroffenheit vom Mindestlohn
- Theoretische Modelle des Mindestlohns
- Neoklassisches Arbeitsmarktmodell
- Monopsonistisches Arbeitsmarktmodell
- Empirie
- Deskriptive Evidenz
- Methodik
- Kausale Evidenz
- Studien auf Basis des strukturellen Ansatzes
- Studien auf Basis des DiD-Ansatzes
- Vergleich Theorie und Empirie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Beschäftigungseffekte des Mindestlohns in Deutschland. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen des Mindestlohns im Kontext des Arbeitsmarktes zu erläutern und die empirische Evidenz zur Wirkung des Mindestlohns auf die Beschäftigung zu untersuchen.
- Theoretische Modelle des Mindestlohns
- Empirische Evidenz zur Wirkung des Mindestlohns
- Vergleich von Theorie und Empirie
- Bewertung der Beschäftigungseffekte des Mindestlohns
- Diskussion der politischen und gesellschaftlichen Relevanz des Mindestlohns
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel führt in das Thema des Mindestlohns ein und skizziert die Relevanz der Thematik sowie den Aufbau der Arbeit.
- Institutionelles: Hier werden Definition, Geltungsbereich und die Gruppe der vom Mindestlohn Betroffenen erläutert. Die rechtlichen Rahmenbedingungen und die konkrete Ausgestaltung des Mindestlohns in Deutschland werden vorgestellt.
- Theoretische Modelle des Mindestlohns: Dieses Kapitel stellt die beiden wichtigsten ökonomischen Modelle zur Erklärung der Auswirkungen des Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt vor - das neoklassische und das monopsonistische Arbeitsmarktmodell. Die jeweiligen Annahmen und Schlussfolgerungen werden detailliert dargestellt.
- Empirie: Dieses Kapitel behandelt die empirische Evidenz zur Wirkung des Mindestlohns auf die Beschäftigung. Es werden sowohl deskriptive Studien als auch kausale Studien vorgestellt und ihre methodischen Ansätze erläutert.
Schlüsselwörter
Mindestlohn, Arbeitsmarkt, Beschäftigungseffekte, Neoklassisches Arbeitsmarktmodell, Monopsonistisches Arbeitsmarktmodell, Empirische Evidenz, Deskriptive Studien, Kausale Studien, DiD-Ansatz, Struktureller Ansatz, Deutschland.
- Citar trabajo
- Matthias Lukosch (Autor), 2019, Der Mindestlohn in Deutschland. Eine Analyse der Beschäftigungseffekte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508872