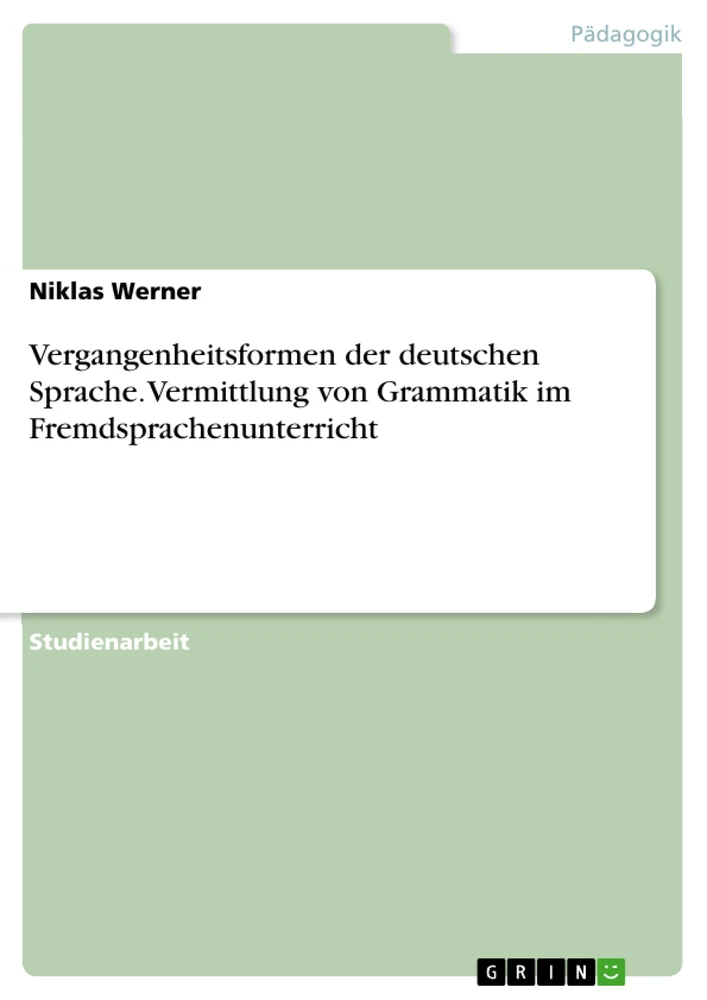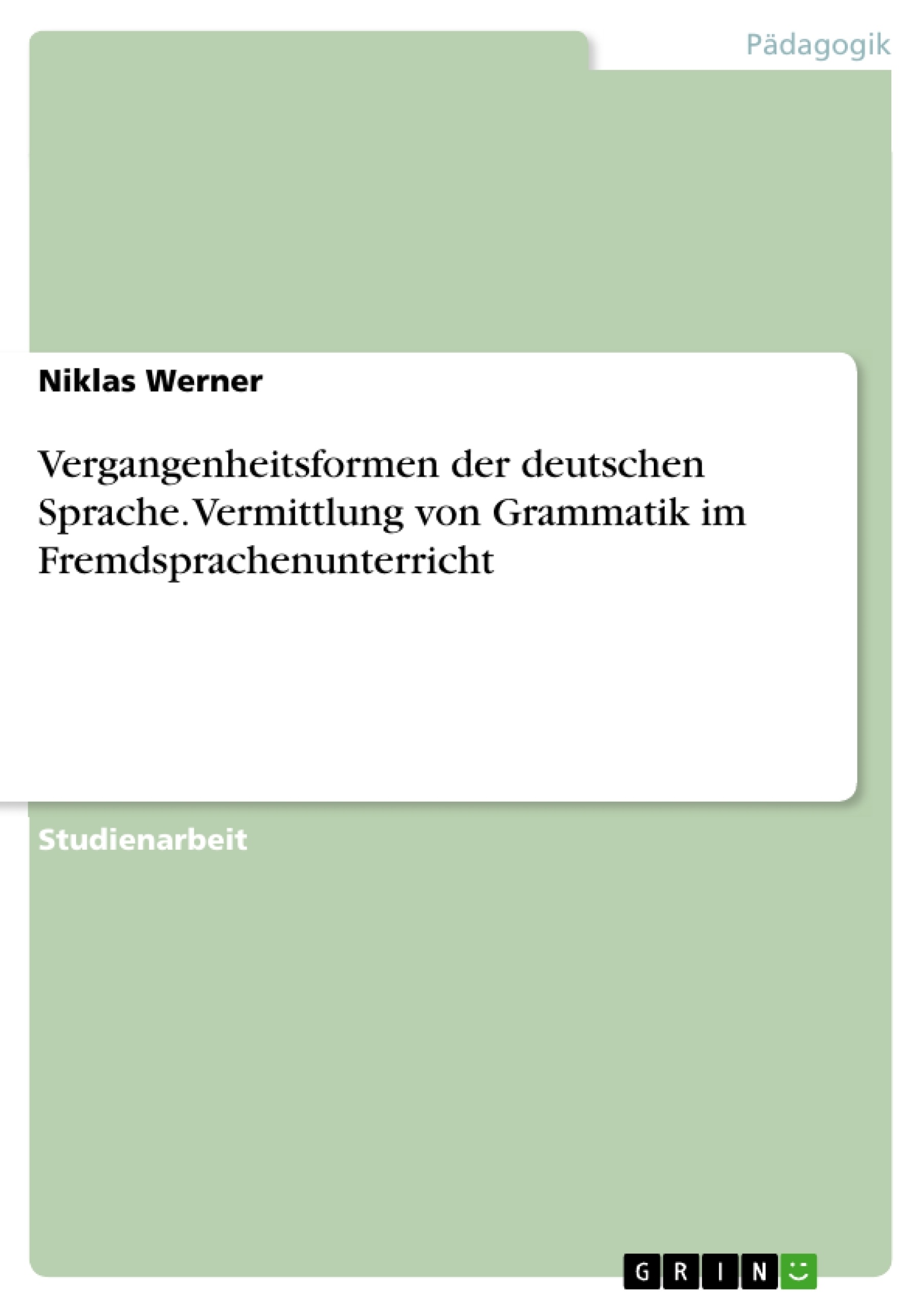Die Arbeit thematisiert die Frage, wie sich die deutschen Vergangenheitsformen im grammatischen Fremdsprachenunterricht erfolgreich vermitteln lassen. Diese Arbeit möchte also einen Beitrag zu der Diskussion leisten, die sich die Frage stellt, wie Vergangenheitsformen methodisch vermittelt werden können und auf welchen lerntheoretischen Grundlagen die im Unterricht anwendbaren Methoden fußen.
Um dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden, sind im Verlauf dieser Arbeit keine konkreten Übungsmaterialien zu erwarten. Vielmehr steht eine theoretische Diskussion im Mittelpunkt. Es werden Form und Funktion der Vergangenheitsformen unterschieden und die formale Bildung der Vergangenheitsformen des Deutschen erklärt. Es schließt sich eine Debatte über die gängigen Lerntheorien an, auf deren Grundlage die Methoden der Vermittlung vorgestellt werden. Hierzu werden verschiedene Forschungsansätze und lerntheoretische Perspektiven dargestellt, sowie methodische Ansätze erklärt.
Neben der Wahrnehmung des Raumes ist die Erfahrung von Zeit eine der grundlegenden Dimensionen, der sich kein Mensch entziehen kann. Die Sprache ist die Form, in der sich Wahrnehmungen und Erfahrungen ausdrücken lassen. Hierfür ist das Beherrschen der Vergangenheitsformen eine nötige Voraussetzung. Ein wichtiger Punkt des modernen Fremdsprachenunterrichts ist dessen Fokussierung auf die kommunikative Kompetenz. Diese wird nicht nur von einer Vielzahl von Wissenschaftlern gefordert, sondern ist ebenso im Europäischen Referenzrahmen der Sprachen formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Vorstellung der Vergangenheitsformen des Deutschen aus fachwissenschaftlicher Perspektive
- 1.1 Perfekt
- 1.2 Präteritum
- 1.3 Plusquamperfekt
- 2. Begründung und Arten der Vermittlung der Vergangenheitsformen aus fachdidaktischer und methodischer Perspektive
- 2.1 Unterscheidungskriterien für die Vermittlung aus fachdidaktischer Perspektive
- 2.2 Methoden zur Vermittlung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die erfolgreiche Vermittlung deutscher Vergangenheitsformen im grammatischen Fremdsprachenunterricht. Sie beleuchtet die fachwissenschaftlichen Grundlagen der verschiedenen Vergangenheitsformen (Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt) und diskutiert verschiedene methodische Ansätze ihrer Vermittlung, basierend auf relevanten Lerntheorien. Der Fokus liegt auf einer theoretischen Auseinandersetzung und nicht auf konkreten Übungsmaterialien.
- Formale und funktionale Aspekte deutscher Vergangenheitsformen
- Lerntheoretische Grundlagen für den Sprachunterricht
- Methoden der Vermittlung von Vergangenheitsformen (induktiv, deduktiv, explizit, implizit)
- Integration kommunikativer Kompetenz im Unterricht
- Analyse von Unterrichtssequenzen und Lernfeldern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Vermittlung von Vergangenheitsformen im deutschen Fremdsprachenunterricht ein. Sie betont die Bedeutung der Zeitwahrnehmung und die Rolle der Sprache bei deren Ausdruck. Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit wird formuliert: Wie können deutsche Vergangenheitsformen erfolgreich vermittelt werden? Der Fokus liegt auf einer theoretischen Auseinandersetzung mit methodischen Ansätzen und ihren lerntheoretischen Grundlagen. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, der die Unterscheidung von Form und Funktion der Vergangenheitsformen, eine Diskussion gängiger Lerntheorien und die Darstellung verschiedener methodischer Ansätze umfasst. Die Bedeutung kommunikativer Kompetenz im modernen Fremdsprachenunterricht wird hervorgehoben, und es wird angekündigt, dass induktive und deduktive Vermittlungsansätze sowie explizites und implizites Lernen thematisiert werden.
1. Vorstellung der Vergangenheitsformen des Deutschen aus fachwissenschaftlicher Perspektive: Dieses Kapitel befasst sich mit der fachwissenschaftlichen Betrachtung der deutschen Vergangenheitsformen. Es differenziert zwischen der formalen und der funktionalen Ebene der Zeitangabe und diskutiert die unterschiedlichen Auffassungen über die Anzahl der Tempora im Deutschen. Es wird auf die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Form und Funktion hingewiesen, und es werden Beispiele gezeigt, die die Komplexität der Zeitreferenz in der deutschen Sprache verdeutlichen. Die Kapitel legt den Fokus auf Perfekt, Präteritum und Plusquamperfekt als relevante Tempora für die weitere Analyse.
1.1 Perfekt: Dieses Kapitel beschreibt die Bildung und Anwendung des Perfekts, der häufigsten Vergangenheitsform im Deutschen. Es erklärt die Bildung des Perfekts im Aktiv und Passiv, jeweils mit Beispielen. Die Bedeutung des Perfekts im modernen DaZ/DaF-Unterricht als erste zu vermittelnde Vergangenheitsform aufgrund seiner hohen Relevanz für die kommunikative Kompetenz wird betont. Es wird auf die Bildung mit den Hilfsverben *haben* und *sein* und die Kombination mit Partizip II eingegangen. Ausnahmefälle in der Wahl der Hilfsverben werden kurz erwähnt und auf weiterführende Literatur verwiesen.
Schlüsselwörter
Vergangenheitsformen, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Fremdsprachenunterricht, Grammatik, Fachdidaktik, Methodik, Lerntheorien, Kommunikative Kompetenz, Induktives Lernen, Deduktives Lernen, Explizites Lernen, Implizites Lernen, Unterrichtssequenzen, Lernfelder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Vermittlung deutscher Vergangenheitsformen im Fremdsprachenunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der erfolgreichen Vermittlung deutscher Vergangenheitsformen (Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt) im grammatischen Fremdsprachenunterricht. Der Fokus liegt auf der theoretischen Auseinandersetzung mit methodischen Ansätzen und ihren lerntheoretischen Grundlagen, nicht auf konkreten Übungsmaterialien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die fachwissenschaftlichen Grundlagen der verschiedenen Vergangenheitsformen, diskutiert verschiedene methodische Ansätze ihrer Vermittlung (induktiv, deduktiv, explizit, implizit), betrachtet Lerntheorien und die Integration kommunikativer Kompetenz im Unterricht. Formale und funktionale Aspekte der Vergangenheitsformen sowie die Analyse von Unterrichtssequenzen und Lernfeldern werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur fachwissenschaftlichen Betrachtung der Vergangenheitsformen (mit Unterkapiteln zu Perfekt, Präteritum und Plusquamperfekt), ein Kapitel zur fachdidaktischen und methodischen Perspektive der Vermittlung und ein Fazit mit Ausblick. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Das Kapitel zu den Vergangenheitsformen beschreibt deren Bildung und Anwendung. Das Kapitel zur Vermittlung diskutiert verschiedene methodische Ansätze und Lerntheorien.
Wie wird das Perfekt behandelt?
Das Kapitel 1.1 beschreibt die Bildung und Anwendung des Perfekts im Detail, inklusive Aktiv und Passiv, mit Beispielen. Es betont die Bedeutung des Perfekts als oft zuerst vermittelte Vergangenheitsform im DaZ/DaF-Unterricht aufgrund seiner hohen kommunikativen Relevanz, einschließlich der Verwendung der Hilfsverben *haben* und *sein* und des Partizip II. Ausnahmefälle werden kurz erwähnt.
Welche methodischen Ansätze werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht induktive, deduktive, explizite und implizite Vermittlungsansätze für die Vergangenheitsformen. Diese Ansätze werden im Kontext relevanter Lerntheorien diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Vergangenheitsformen, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Fremdsprachenunterricht, Grammatik, Fachdidaktik, Methodik, Lerntheorien, Kommunikative Kompetenz, Induktives Lernen, Deduktives Lernen, Explizites Lernen, Implizites Lernen, Unterrichtssequenzen, Lernfelder.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie können deutsche Vergangenheitsformen erfolgreich vermittelt werden?
Auf welche Lerntheorien wird Bezug genommen?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Lerntheorien für den Sprachunterricht, die im Kontext der methodischen Ansätze zur Vermittlung der Vergangenheitsformen diskutiert werden.
Welche Aspekte der kommunikativen Kompetenz werden thematisiert?
Die Arbeit hebt die Bedeutung der kommunikativen Kompetenz im modernen Fremdsprachenunterricht hervor und untersucht, wie diese in der Vermittlung der Vergangenheitsformen integriert werden kann.
- Quote paper
- Niklas Werner (Author), 2018, Vergangenheitsformen der deutschen Sprache. Vermittlung von Grammatik im Fremdsprachenunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508815