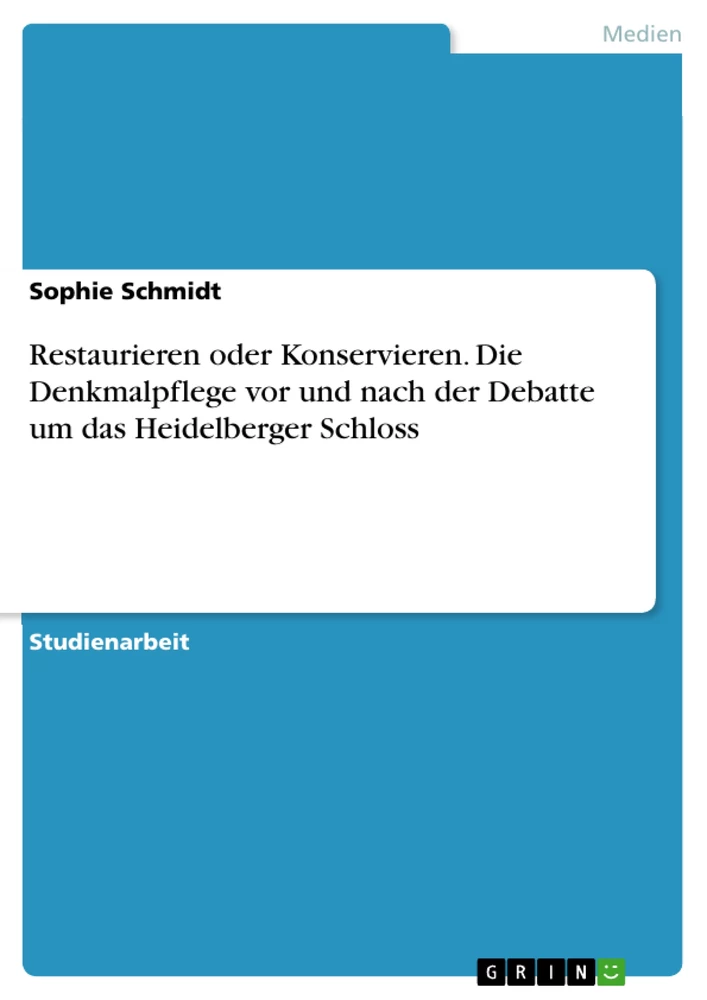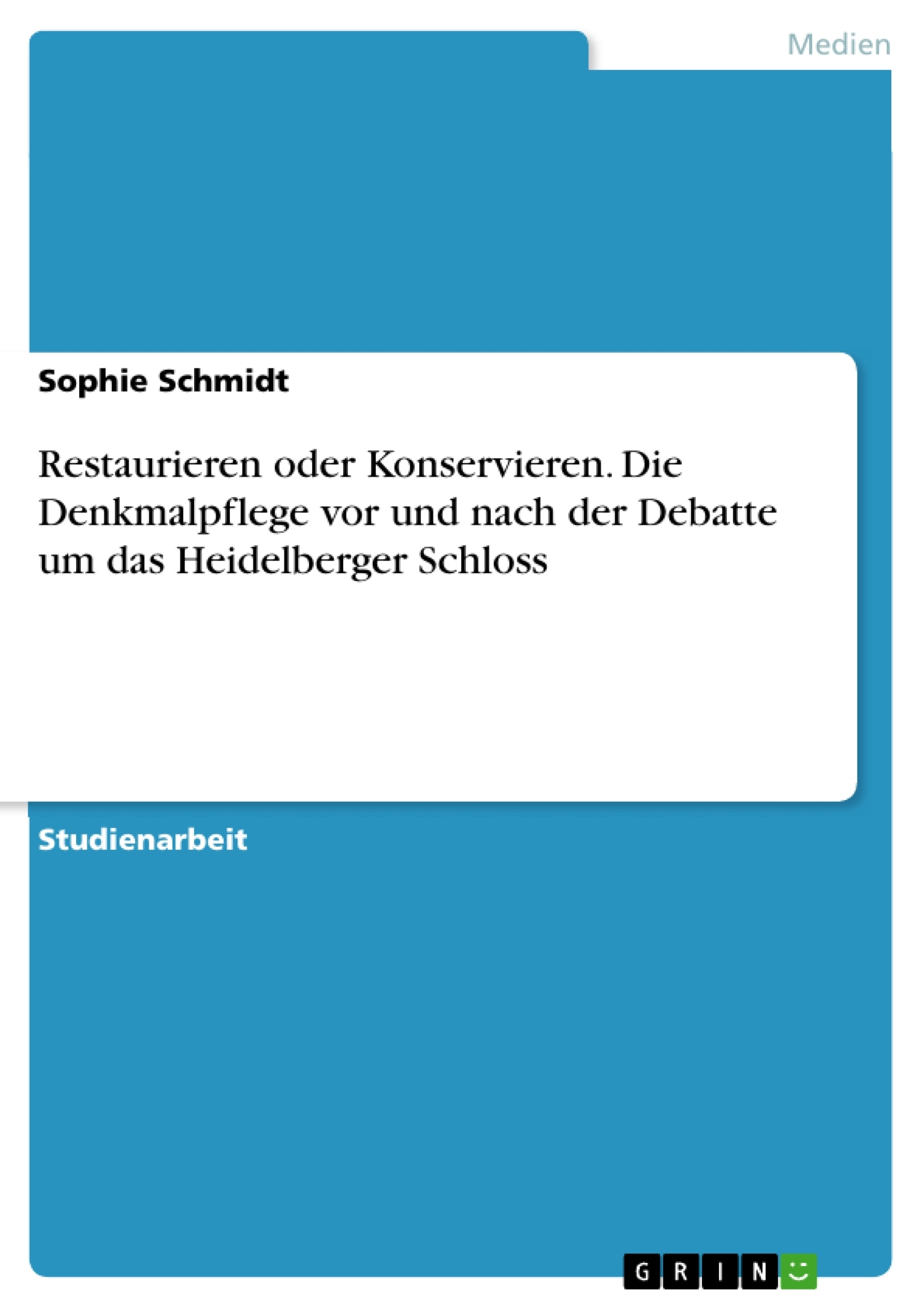Diese Arbeit beschäftigt sich mit der denkmalpflegerischen Praxis im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert, wobei ich mich aufgrund des Umfangs dieses Themas auf Deutschland beschränke, und gehe dabei insbesondere auf das Heidelberger Schloss ein, da sich, wie im Verlauf der Arbeit dargestellt wird, die Diskussion um die Denkmalpflege gut auf dieses eine Objekt reduzieren lässt.
Das Ausmaß, das insbesondere diese Diskussion annahm, zeigt von welch großer Bedeutung Denkmale waren und immer noch sind. Sie sind identitätsstiftend für ein Volk und eine Kultur und sowohl ihre Zerstörung als auch ihr Erhalt und Wiederaufbau sind von enormer symbolischer Bedeutung. Die Nachricht von der Zerstörung der Tempel in Palmyra im August 2015 durch die Terrororganisation Islamischer Staat sorgte beispielsweise weltweit für Entsetzen und wurde von der UNESCO sogar als Kriegsverbrechen eingestuft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vandalisme Restaursteur - die Situation im 19. Jahrhundert
- Bau- und Zerstörungsgeschichte des Heidelberger Schlosses
- Restaurierungsmaßnahmen am Heidelberger Schloss
- Allgemein
- Der Sieg über Frankreich
- Der Eisenbahntunnel
- Die Ruine als Kulturgut
- Die Restaurierung des Friedrichsbaus
- Der Wunsch der Bevölkerung
- Der Ott-Heinrichsbau
- Die neue denkmalpflegerische Praxis
- Wie sähe die Denkmalpflege ohne die Heidelberger-Schloss-Debatte aus?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der denkmalpflegerischen Praxis im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland, wobei der Fokus auf dem Heidelberger Schloss liegt. Der Text analysiert die Debatte um die Denkmalpflege anhand dieses Objekts und zeigt die Auswirkungen der denkmalpflegerischen Maßnahmen am Heidelberger Schloss auf den Umgang mit Denkmalen in Deutschland.
- Entwicklung der Denkmalpflege im 19. Jahrhundert
- Die Bedeutung des Heidelberger Schlosses als Symbol und Objekt der Denkmalpflege
- Die Debatte um Restaurierung vs. Konservierung am Beispiel des Heidelberger Schlosses
- Einfluss der Debatte auf die denkmalpflegerische Praxis in Deutschland
- Die Rolle der Denkmalpflege im Kontext von Geschichte, Kultur und Identität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt den Leser in das Thema der Denkmalpflege ein. Sie bezieht sich auf das Zitat von Georg Dehio und beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze zur Denkmalpflege im 19. und 20. Jahrhundert. Außerdem wird die Bedeutung von Denkmalen für die Kultur und Identität eines Volkes betont.
- Vandalisme Restaursteur - die Situation im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Denkmalpflege im 19. Jahrhundert und beschreibt die damaligen Restaurierungspraktiken. Es geht auf die dominierende Vorstellung des „Wiederherstellens“ statt des „Erhaltens“ ein und beschreibt die Folgen dieser Denkweise, wie z. B. Stilbereinigungen, die die ursprünglichen Gebäude kaum noch wiederzuerkennen machten. Außerdem wird der Einfluss von Persönlichkeiten wie Viollet-le-Duc auf die Restaurierungsphilosophie beleuchtet.
- Bau- und Zerstörungsgeschichte des Heidelberger Schlosses: Dieses Kapitel behandelt die Geschichte des Heidelberger Schlosses, insbesondere die Phasen der Zerstörung durch französische Truppen. Es erklärt, warum das Schloss nach den Zerstörungen im ruinösen Zustand verblieb und die Bedeutung der Funktion als Regierungssitz für die Erhaltung des Gebäudes.
- Restaurierungsmaßnahmen am Heidelberger Schloss: Das Kapitel geht auf die verschiedenen Restaurierungsmaßnahmen am Heidelberger Schloss ein, beginnend mit den ersten Bemühungen nach der Zerstörung durch Ludwig XIV. Es beschreibt die unterschiedlichen Phasen der Restaurierung, die Ziele und die Einflüsse auf die spätere denkmalpflegerische Praxis in Deutschland.
- Die neue denkmalpflegerische Praxis: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Denkmalpflege nach der Debatte um das Heidelberger Schloss. Es zeigt die Auswirkungen der Diskussion auf die Praxis und die neuen Ansätze, die sich in der Folge durchsetzen.
- Wie sähe die Denkmalpflege ohne die Heidelberger-Schloss-Debatte aus?: Dieses Kapitel reflektiert über den Einfluss der Debatte auf die Denkweise und Praxis der Denkmalpflege in Deutschland. Es stellt die Frage, ob und wie sich die Denkmalpflege anders entwickelt hätte, wenn diese Diskussion nicht stattgefunden hätte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der Denkmalpflege, wie „Restaurierung“, „Konservierung“, „Denkmalwert“, „Stilbereinigung“ und „Vandalisme Restaurateur“. Sie beleuchtet die Auswirkungen der Debatte um die Denkmalpflege am Heidelberger Schloss auf die Entwicklung der Denkmalpflege in Deutschland. Die Arbeit befasst sich außerdem mit den Themen Geschichte, Kultur und Identität im Kontext von Denkmalpflege.
- Citar trabajo
- Sophie Schmidt (Autor), 2015, Restaurieren oder Konservieren. Die Denkmalpflege vor und nach der Debatte um das Heidelberger Schloss, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/508708