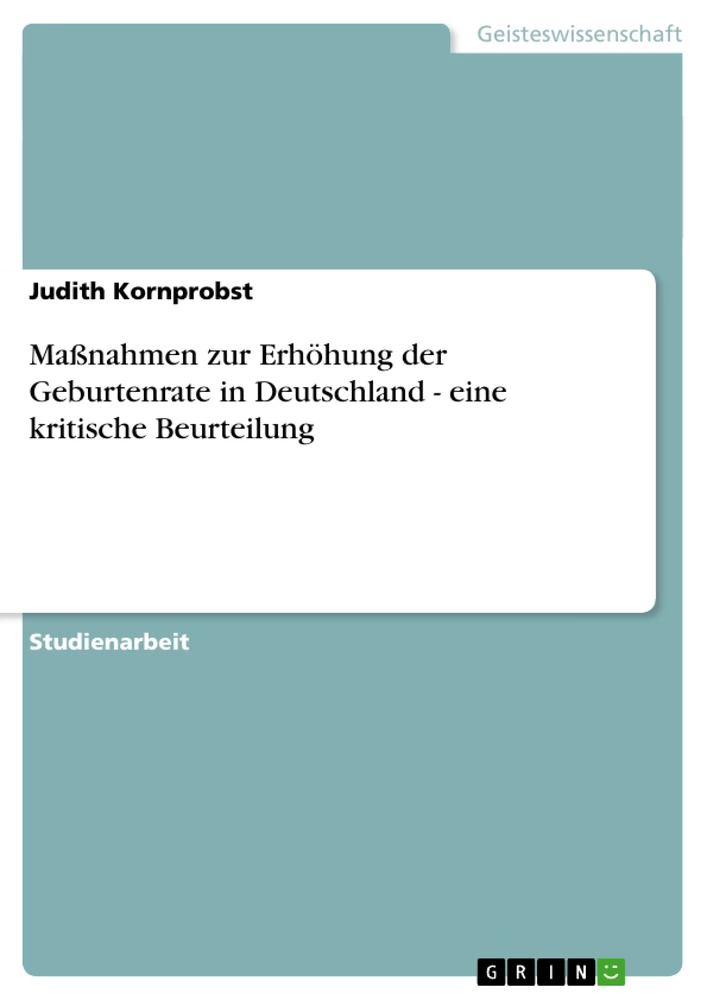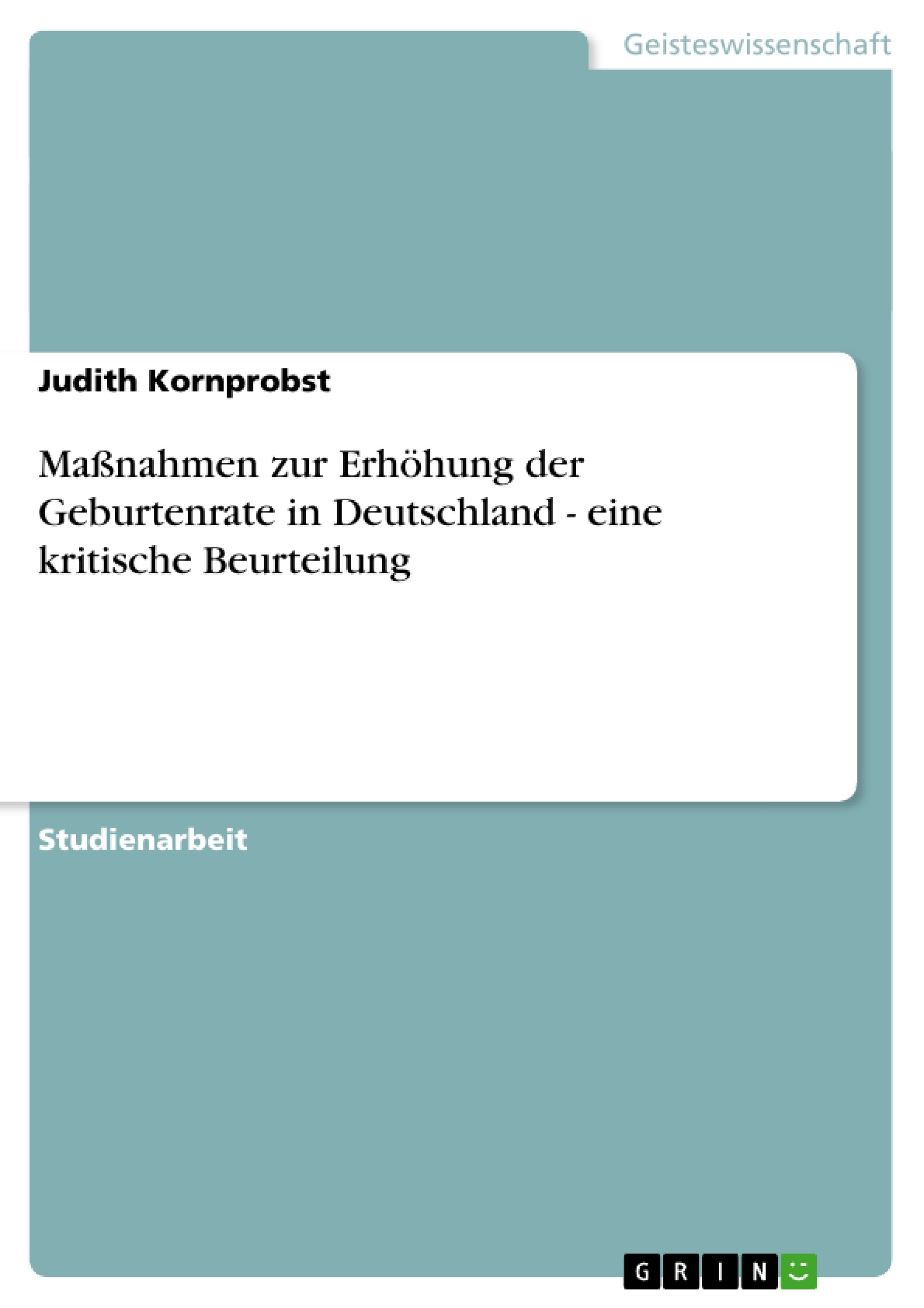Die demographische Entwicklung in Deutschland stellt die Politik vor schwierige Herausforderungen. Die deutsche Bevölkerung wird immer älter, der Altersquotient, der als Relation der 65-Jährigen und Älteren zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren definiert wird, steigt schneller als in fast allen anderen Ländern dieser Welt an. Bereits im Jahr 2035 werden wir vermutlich die älteste Bevölkerung auf der Erde sein [Vgl. SINN (2003, S. 20).]. Ein Grund für diese Entwicklung liegt in der steigenden Lebenserwartung der Deutschen. Allerdings weicht diese nicht gravierend von der Lebenserwartung anderer Völker ab [Vgl. SINN (2003, S. 21).]. Der wohl ausschlaggebende Grund für die Überalterung der deutschen Gesellschaft liegt in der sinkenden Geburtenziffer. Die Geburtenrate in Deutschland liegt aktuell bei etwa 1,29 Kindern pro Frau. Diese Zahl ist somit nicht nur weit entfernt von der magischen Geburtenziffer von 2,1 Kindern pro Frau, die nötig wäre um eine stabile Bevölkerungsentwicklung zu garantieren sondern liegt auch noch weit hinter den Geburtenraten in anderen europäischen Ländern. Deutschland bildet somit mit den mitteleuropäischen Ländern das Schlusslicht in Westeuropa [Vgl. RÜRUP (2005, S. 10).].
Die Folgen dieser Entwicklung sind schon seit langer Zeit absehbar und trotzdem kam es bis heute noch nicht zu wirklich tief greifenden Maßnahmen, die diesem Problem entgegenwirken. Besonders betroffen von dieser demographischen Entwicklung ist die in Deutschland vorhandene umlagefinanzierte Rentenversicherung. Immer weniger junge Menschen müssen mit ihren Beiträgen die Renten für eine immer größere Anzahl alter Menschen finanzieren. Das Jahr 2035 gilt als das Jahr, in dem die demographische Krise nach heutigem Kenntnisstand kulminieren wird [Vgl. SINN (2003, S. 24).]. Doch auch noch andere Folgen zieht die demographische Entwicklung mit sich. Eine alternde Bevölkerung ist nicht so leistungsfähig wie eine junge Gesellschaft. Die geistige und wirtschaftliche Dynamik Deutschlands wird unter der Entwicklung leiden. Durch die schwindende Innovationsfreudigkeit werden wir auch im internationalen Wettbewerb Verluste in Kauf nehmen müssen [Vgl. SINN (2003, S. 25).].
Diese Arbeit setzt den Fokus auf die sinkende Geburtenrate. Bestehende Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate und solche, die momentan in der Öffentlichkeit diskutiert werden sollen hier unter ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate in Deutschland: Eine kritische Beurteilung
- 1.) Opportunitätskostenansatz zur Erklärung des Geburtenverhaltens
- 2.) Fertilität und finanzielle Transfers
- 2.1. Kindergeld
- 2.2. Erziehungsgeld
- 2.3. Elterngeld/ Bezahlte Elternzeit
- 3.) Fertilität und steuerliche Vergünstigungen
- 3.1. Kinderfreibetrag
- 3.2. Betreuungsfreibetrag
- 3.3. Ausbildungsfreibetrag
- 3.4. Ehegattensplitting
- 4. Fertilität und Verbesserungen der Rahmenbedingungen
- 4.1. Chancengleichheit von Mann und Frau
- 4.2. Gesellschaftliche Anerkennung der Erziehungsleistung
- 4.3. Kinderbetreuungsmöglichkeiten
- 4.4. Verkürzung der Ausbildungszeiten
- 4.5. Familienbewusste Personalpolitik
- 5.) Vergleich von monetären Förderungen von Familien und Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert kritisch Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate in Deutschland. Ziel ist es, die bestehenden und diskutierten Maßnahmen unter ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten zu betrachten und deren Effektivität zu bewerten.
- Opportunitätskosten des Kinderkriegens
- Wirkung finanzieller Transfers auf die Fertilität
- Einfluss steuerlicher Vergünstigungen auf die Geburtenrate
- Bedeutung verbesserter Rahmenbedingungen für Familien
- Vergleich monetärer Förderungen mit Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
A) Einleitung: Die Einleitung beschreibt die demografische Entwicklung in Deutschland, die durch eine sinkende Geburtenrate und steigende Lebenserwartung gekennzeichnet ist. Sie hebt die daraus resultierenden Herausforderungen für die Rentenversicherung und die Wirtschaft hervor und leitet zur zentralen Fragestellung der Arbeit über: die kritische Betrachtung von Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate.
B) Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate in Deutschland: Eine kritische Beurteilung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Ansätze zur Steigerung der Geburtenrate. Es beginnt mit einer ökonomischen Betrachtung des Geburtenverhaltens, indem der Opportunitätskostenansatz erläutert wird. Der Nutzen von Kindern wird im Gegensatz zu den direkten und indirekten Kosten (Opportunitätskosten durch Einkommensverlust) abgewogen. Anschließend werden verschiedene finanzielle Förderungen (Kindergeld, Erziehungsgeld, Elterngeld) und steuerliche Vergünstigungen (Kinderfreibetrag, Betreuungsfreibetrag, Ausbildungsfreibetrag, Ehegattensplitting) analysiert und kritisch bewertet. Der letzte Teil des Kapitels befasst sich mit der Verbesserung von Rahmenbedingungen, wie Chancengleichheit, gesellschaftliche Anerkennung der Erziehungsleistung, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Verkürzung von Ausbildungszeiten und familienbewusster Personalpolitik. Die Kapitel analysieren, wie diese Maßnahmen die Opportunitätskosten reduzieren und die Geburtenrate beeinflussen könnten.
Schlüsselwörter
Geburtenrate, Demografie, Deutschland, Opportunitätskosten, finanzielle Transfers, steuerliche Vergünstigungen, Rahmenbedingungen, Familienpolitik, Fertilität, Kinderbetreuung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert kritisch Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate in Deutschland. Sie untersucht ökonomische und soziale Aspekte verschiedener Ansätze und bewertet deren Effektivität. Der Fokus liegt auf Opportunitätskosten des Kinderkriegens, finanziellen Transfers, steuerlichen Vergünstigungen und Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Familien.
Welche Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate werden untersucht?
Die Arbeit betrachtet diverse Maßnahmen: finanzielle Förderungen wie Kindergeld, Erziehungsgeld und Elterngeld; steuerliche Vergünstigungen wie Kinderfreibetrag, Betreuungsfreibetrag, Ausbildungsfreibetrag und Ehegattensplitting; und Verbesserungen der Rahmenbedingungen wie Chancengleichheit, gesellschaftliche Anerkennung der Erziehungsleistung, verbesserte Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Verkürzung der Ausbildungszeiten und familienbewusste Personalpolitik.
Welcher ökonomische Ansatz wird verwendet?
Die Arbeit nutzt den Opportunitätskostenansatz, um das Geburtenverhalten zu erklären. Dieser Ansatz vergleicht den Nutzen von Kindern mit den direkten und indirekten Kosten, insbesondere den Opportunitätskosten durch Einkommensverluste.
Wie werden finanzielle Transfers und steuerliche Vergünstigungen bewertet?
Die Seminararbeit analysiert kritisch die Wirkung von finanziellen Transfers und steuerlichen Vergünstigungen auf die Fertilität. Sie untersucht, inwieweit diese Maßnahmen die Opportunitätskosten des Kinderkriegens reduzieren und die Geburtenrate beeinflussen.
Welche Rolle spielen verbesserte Rahmenbedingungen?
Die Arbeit hebt die Bedeutung verbesserter Rahmenbedingungen für Familien hervor. Sie untersucht, wie Maßnahmen wie Chancengleichheit, bessere Kinderbetreuung und familienbewusste Personalpolitik die Geburtenrate positiv beeinflussen könnten.
Wie werden monetäre Förderungen und Verbesserungen der Rahmenbedingungen verglichen?
Die Seminararbeit vergleicht die Effektivität von monetären Förderungen (finanzielle Transfers und steuerliche Vergünstigungen) mit Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien. Ziel ist es, herauszufinden, welche Ansätze am effektivsten zur Erhöhung der Geburtenrate beitragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geburtenrate, Demografie, Deutschland, Opportunitätskosten, finanzielle Transfers, steuerliche Vergünstigungen, Rahmenbedingungen, Familienpolitik, Fertilität, Kinderbetreuung.
Welche demografische Entwicklung wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die demografische Entwicklung in Deutschland, die durch eine sinkende Geburtenrate und steigende Lebenserwartung gekennzeichnet ist und die Herausforderungen für die Rentenversicherung und die Wirtschaft hervorhebt.
Was ist die zentrale Fragestellung der Arbeit?
Die zentrale Fragestellung ist die kritische Betrachtung von Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate in Deutschland.
- Quote paper
- Judith Kornprobst (Author), 2005, Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate in Deutschland - eine kritische Beurteilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50815