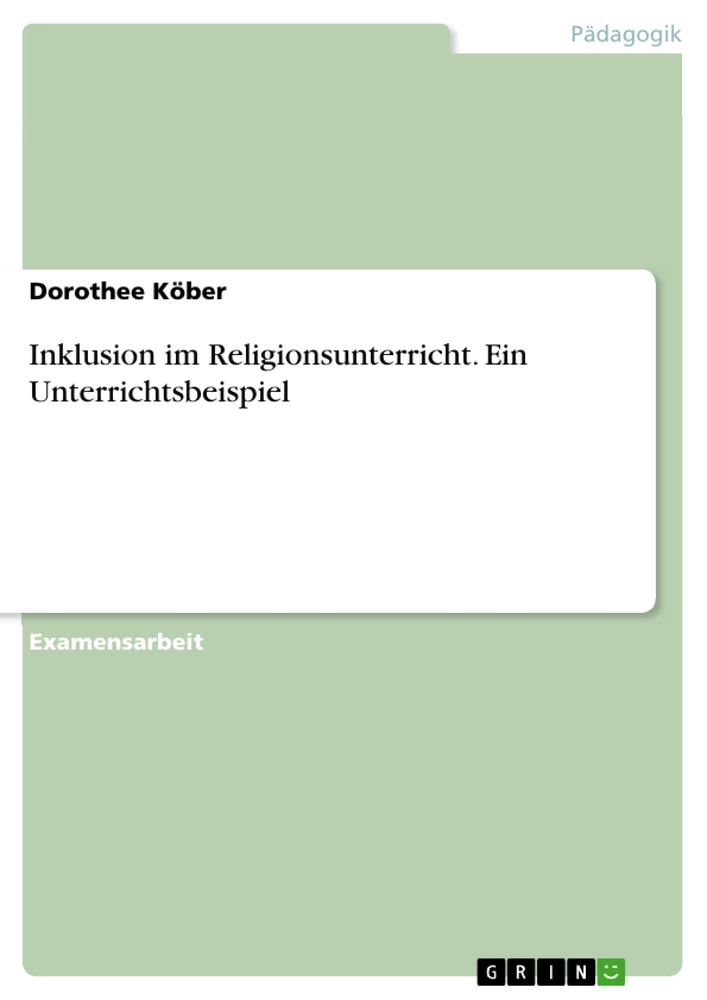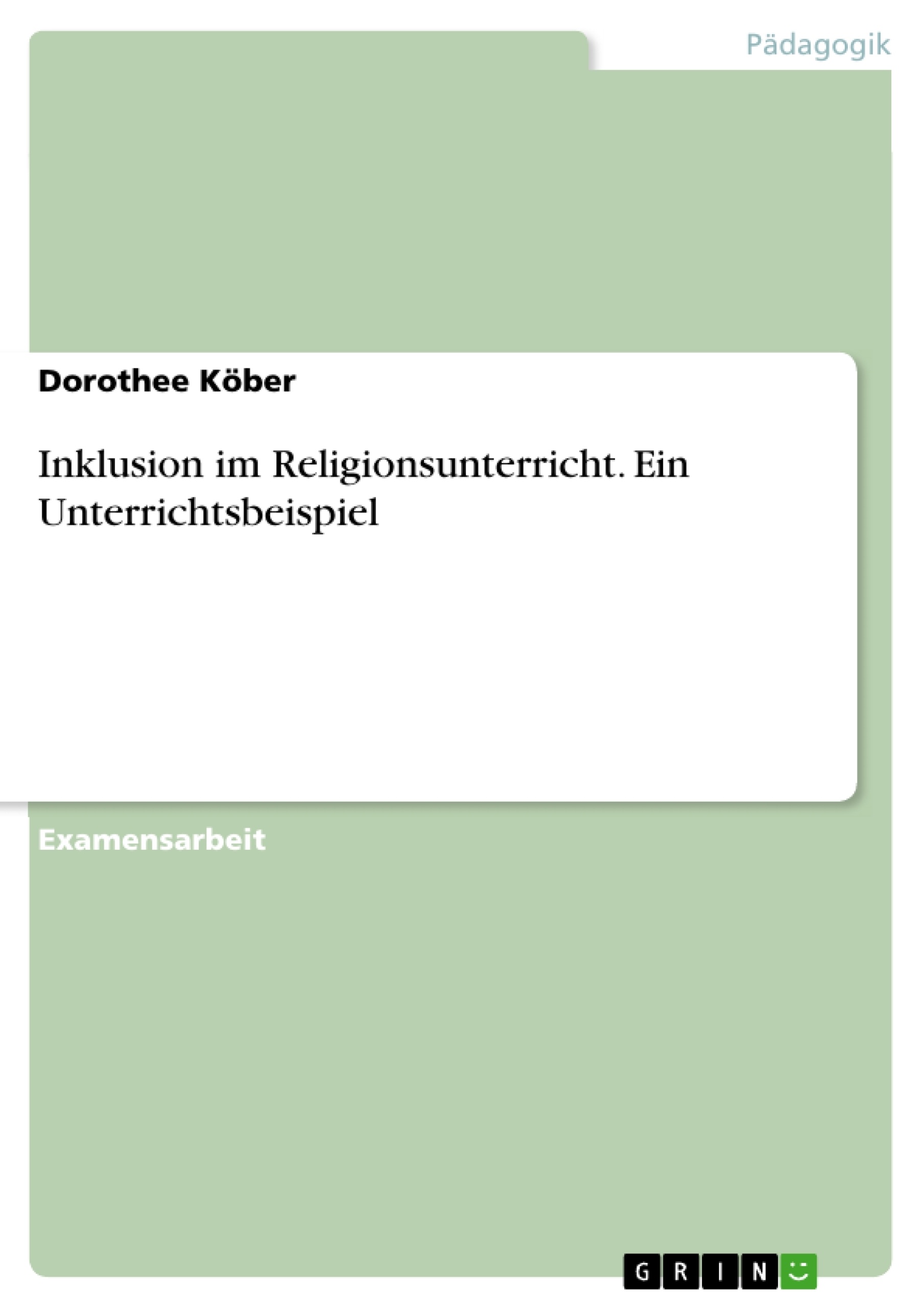Diese Arbeit setzt sich mit dem Thema Inklusion im Religionsunterricht auseinander. Sie vertritt die Meinung, dass der Mensch als etwas Besonderes zu gehlten hat und immer etwas zu geben hat.
Der erste Teil der Arbeit geht der Frage nach, weshalb Inklusion überhaupt notwendig ist und gefordert wird. Zuerst wird zu Beginn das Wort "Behinderung" geklärt. Anschließend wird dem Begriff "Inklusion" auf den Grund gegangen, der Beschluss der UN-Behindertenrechtskonvention, der Auslöser dieses Begriffes war, wird erläutert und auf den aktuellen Stand der Inklusion in Baden-Württembergischen Schulen wird eingegangen. Es folgt ein Vergleich der Inklusion zur Integration. Es folgt eine Reflexion zu Theologie und Inklusion. Christliche Anthropologie, Gedanken zum Heil und das Recht auf Leben für alle Menschen werden dargestellt.
Der zweite Teil der Arbeit steht unter der großen Frage, in wie weit Inklusion zum jetzigen Zeitpunkt unserer Gesellschaft und unseres Schulsystems überhaupt schon möglich ist. Die Arbeit analysiert hierzu zunächst die institutionellen Bedingungen, geht dann auf die anthropologischen Gegebenheiten ein und weist abschließend methodische und didaktische Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung auf. Der ausgearbeitet Unterricht will außerdem noch zeigen, in wie weit die Schüler von inklusiven Unterricht und dem Umgang mit Menschen mit Behinderung profitieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1: Warum Inklusion?
- Inklusion
- Behinderung
- Von der Integration zur Inklusion
- Vergleich Integration - Inklusion
- Aktueller Stand der inklusiven Schulen in Baden-Württemberg
- Theologie und Inklusion
- Der Mensch als Ebenbild Gottes
- Der Mensch als fragmentarisches, fragiles Geschöpf
- Der Mensch als ergänzungsbedürftiges und -fähiges Geschöpf
- Gedanken zur Heil(ung) und Behinderung
- Leben ist kostbar von Anfang an - Recht auf Leben für alle Menschen
- Inklusion im Religionsunterricht der Werkrealschule
- Voraussetzungen
- Reflexion: Warum Inklusion?
- Teil 2: Ist inklusiver Unterricht in der Werkrealschule möglich?
- Institutionelle Gegebenheiten
- Theoretisch
- Praktisch
- Die untersuchte Schule
- Die Kooperationsklasse
- Die inklusive Religionsklasse
- Inklusion im Religionsunterricht der Werkrealschule
- Anthropologische Gegebenheiten
- Theoretisch
- Praktisch
- Anthropologische Bedingungen
- Entwicklungspsychologische Aspekte
- Bedeutungen für den Unterricht
- Inklusion im Religionsunterricht der Werkrealschule
- Voraussetzungen
- Praktisch
- Religion - Ein Fach für den inklusiven Unterricht?
- Theoretisch
- Inklusive Unterrichtsgestaltung
- Didaktische Überlegungen – Inklusion in der Religionspädagogik
- Praktisch
- Der Seelenvogel - Ein Thema für den inklusiven Unterricht?
- Inklusion im Religionsunterricht der Werkrealschule – Die Unterrichtsreihe
- Stoffverteilungsplan
- Vorüberlegungen
- Stunde 1: Was ist die Seele?
- Stunde 2: Der Seelenvogel
- Stunde 3: Wir hören auf unseren eigenen Seelenvogel
- Stunde 4: Gefühle wahrnehmen und sie versuchen zu ändern
- Stunde 5: Futtertüte für den Seelenvogel
- Reflexion: Ist inklusiver Unterricht in der Werkrealschule möglich?
- Übergreifende Abschlussreflexion
- Fazit
- Bedeutung des Inklusionsgedankens in der heutigen Gesellschaft
- Analyse der institutionellen und anthropologischen Gegebenheiten für inklusiven Unterricht
- Didaktische und methodische Möglichkeiten der inklusiven Unterrichtsgestaltung im Religionsunterricht
- Praxistest einer Unterrichtsreihe zum Thema "Der Seelenvogel" im inklusiven Kontext
- Reflexion der Chancen, Herausforderungen und des Potenzials inklusiven Unterrichts an der Werkrealschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Inklusion im Religionsunterricht an der Werkrealschule. Sie beleuchtet die Notwendigkeit von Inklusion und setzt sich mit den institutionellen, anthropologischen und pädagogischen Voraussetzungen auseinander. Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung inklusiven Unterrichts mit einer exemplarischen Unterrichtsreihe zum Thema "Der Seelenvogel".
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt und die Motivation der Arbeit dar. Sie erläutert das Grundverständnis von Inklusion und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 1 beleuchtet den Begriff "Behinderung" und entwickelt den Inklusionsgedanken im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention und der aktuellen Situation in Baden-Württemberg. Kapitel 2 erörtert den theologischen Hintergrund von Inklusion und behandelt den Menschen als Ebenbild Gottes, als fragiles Geschöpf und als Wesen, das ergänzungsbedürftig und -fähig ist. Kapitel 3 befasst sich mit den institutionellen Voraussetzungen für inklusiven Unterricht an der Werkrealschule und analysiert die Situation in der untersuchten Schule sowie in der Kooperationsklasse und der inklusiven Religionsklasse. Kapitel 4 beleuchtet die anthropologischen Gegebenheiten für inklusiven Unterricht. Die Analyse betrachtet anthropologische Bedingungen, entwicklungspsychologische Aspekte und ihre Bedeutung für den Unterricht. Kapitel 5 widmet sich den pädagogischen Voraussetzungen für inklusiven Unterricht und untersucht die theoretischen und praktischen Möglichkeiten inklusiver Unterrichtsgestaltung im Religionsunterricht. Kapitel 6 beschreibt die exemplarische Unterrichtsreihe zum Thema "Der Seelenvogel" und stellt den Stoffverteilungsplan, die Vorüberlegungen und die einzelnen Unterrichtsstunden dar. Kapitel 7 bietet eine übergreifende Abschlussreflexion des gesamten Inklusionsgedankens und analysiert Chancen, Probleme und Möglichkeiten. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Behinderung, Integration, Theologie, Anthropologie, Religionsunterricht, Werkrealschule, Unterrichtsgestaltung, Inklusion im Religionsunterricht, "Der Seelenvogel", Unterrichtsreihe, Praxis, Reflexion, Chancen, Herausforderungen.
- Quote paper
- Dorothee Köber (Author), 2015, Inklusion im Religionsunterricht. Ein Unterrichtsbeispiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/507698