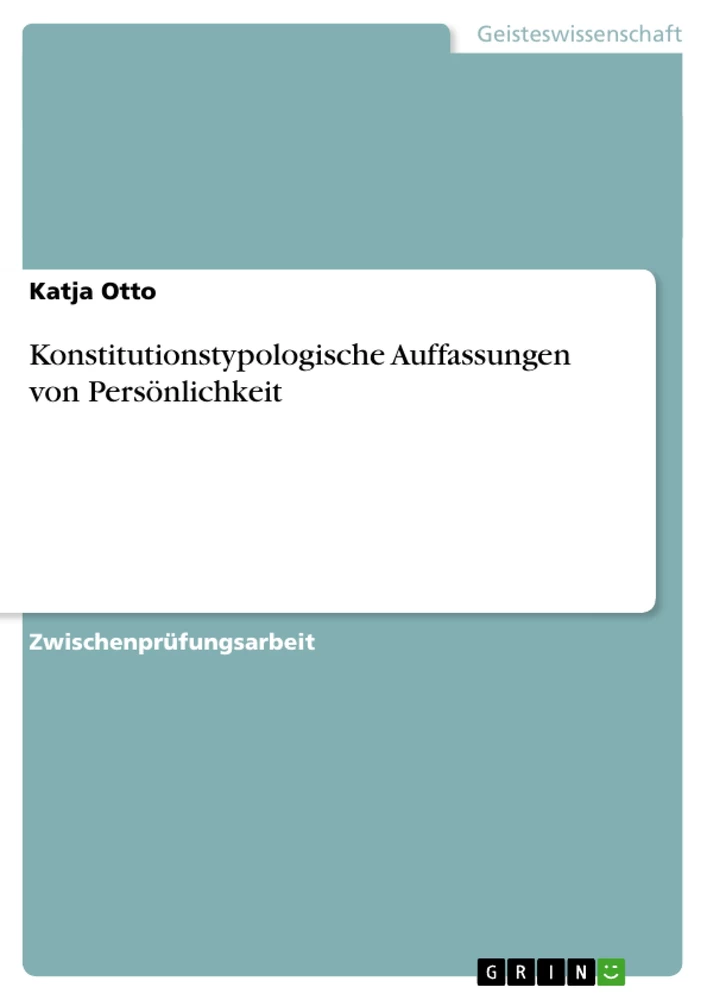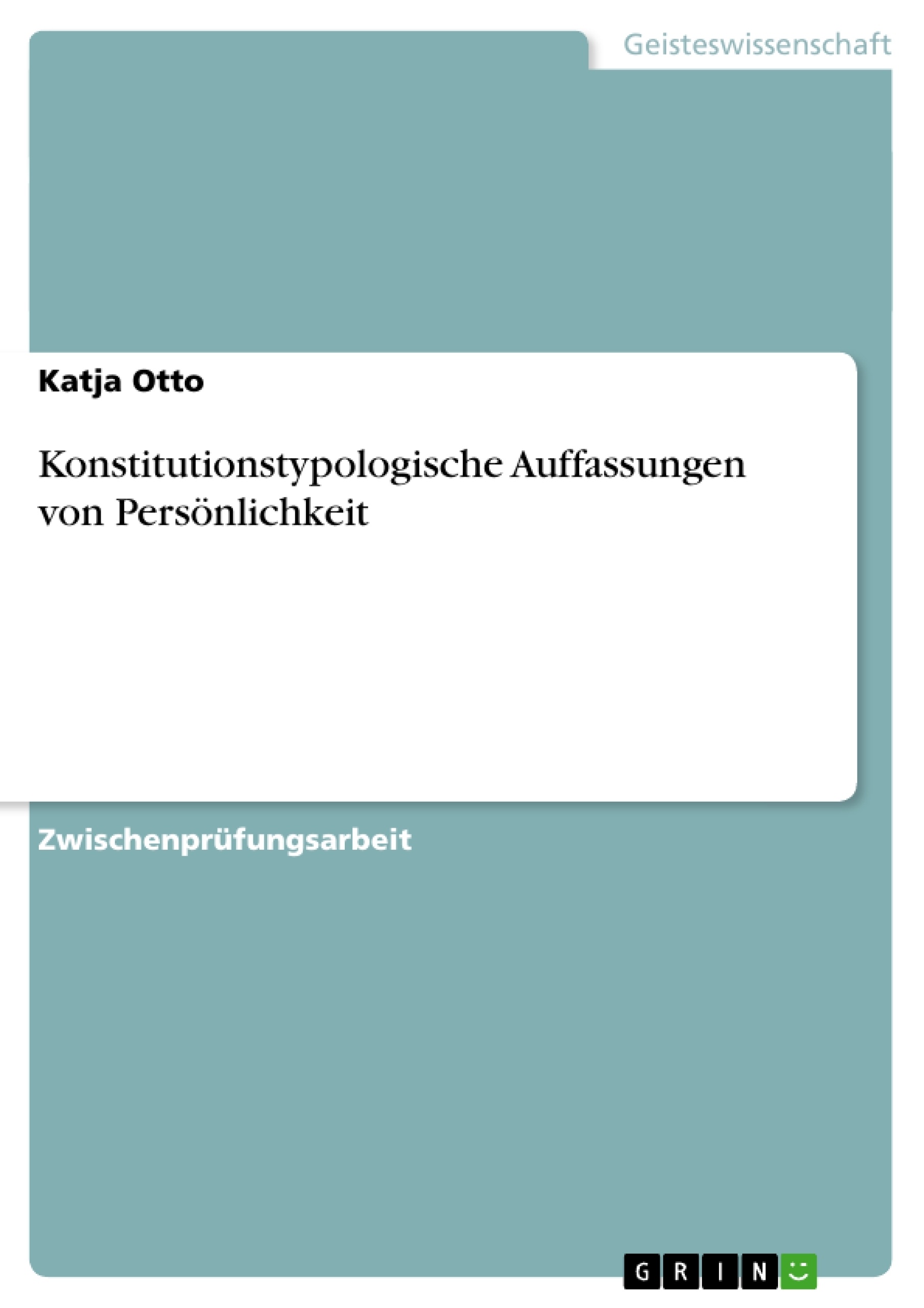Zwei sehr bekannte Vertreter von Konstitutionstypologien waren Ernst Kretschmer und William H. Sheldon. In dieser Arbeit werden zunächst einige Beispiele von konstitutionstypologischen Persönlichkeitskonzepten aufgezeigt. Im weiterenTeil wird Kretschmer mit seinen Erkenntnissen ausführlich dargestellt, insbesondere werden die verschiedenen Körperbautypen und die Charaktere dargestellt, welche dann zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Vergleichend folgt dann die Konstitutionstypologie von Sheldon, bei der anfangs auch auf die Körperbautypen eingegangen wird, um dann die Temperamente und ihre Korrelationen mit den Körpern darzustellen.
Final werden beide Forscher gegenüberstellt und ihre Theorien kurz verglichen. Interessant wird es sein, herauszufinden, ob beide Theorien anwendbar und noch heute vertretbar sind. Im Schlusswort wird kurz die Bedeutung dieser Forscher für die heutige Zeit aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konstitutionstypologische Konzepte in der Persönlichkeitspsychologie
- Konstitutionstypologischer Ansatz von E. Kretschmer
- Biographie
- Körperbau
- Psychosen und Körperbau
- Grenzfälle und Temperamente
- Kritik
- Konstitutionstypologischer Ansatz von W. Sheldon
- Biographie
- Körperbau
- Verhalten
- Zusammenhang zwischen Körperbau und Temperament
- Kritik
- Vergleich der Theorien beider Persönlichkeitsforscher
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht konstitutionstypologische Ansätze zur Erklärung von Persönlichkeit, fokussiert auf die Theorien von Ernst Kretschmer und William H. Sheldon. Ziel ist es, die historischen Konzepte beider Forscher darzustellen, ihre jeweiligen Körperbautypen und Persönlichkeitsklassifikationen zu beschreiben und schließlich einen Vergleich beider Theorien durchzuführen.
- Historische Entwicklung konstitutionstypologischer Konzepte
- Kretschmers Typologie: Körperbau und zugehörige Persönlichkeitsprofile
- Sheldons Typologie: Somatotypen und Temperamente
- Vergleich der methodischen Ansätze und Ergebnisse von Kretschmer und Sheldon
- Relevanz konstitutionstypologischer Ansätze für die heutige Persönlichkeitspsychologie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der konstitutionstypologischen Persönlichkeitsforschung ein und benennt Ernst Kretschmer und William H. Sheldon als zentrale Figuren. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Darstellung der Theorien beider Forscher und deren Vergleich konzentriert, mit dem Ziel, deren Anwendbarkeit und Vertretbarkeit in der heutigen Zeit zu evaluieren.
Konstitutionstypologische Konzepte in der Persönlichkeitspsychologie: Dieses Kapitel liefert einen geschichtlichen Überblick über typologische Ansätze in der Persönlichkeitspsychologie, beginnend mit Theophrast und Moliere und weiterführend zu Schiller, Nietzsche, Jaspers und Spranger. Es wird zwischen philosophisch-phänomenologischen und konstitutionstypologischen Ansätzen unterschieden, wobei letztere auf einem biologisch-biogenetischen Zusammenhang zwischen Körperbau und psychischen Merkmalen beruhen. Hippokrates wird als historischer Vorläufer konstitutionstypologischer Ansätze genannt, seine Typologie und die Vier-Säfte-Lehre werden kurz erläutert. Rostan wird als weiterer relevanter Vertreter erwähnt.
Konstitutionstypologischer Ansatz von E. Kretschmer: Dieses Kapitel widmet sich Kretschmers Theorie. Es wird auf seine Biographie eingegangen, seine Klassifizierung von Körperbautypen erläutert und der Zusammenhang zwischen Körperbau und verschiedenen Psychosen dargestellt. Kretschmers Beschreibung von Temperamenten im Kontext seiner Typologie und die Kritik an seinem Ansatz werden ebenfalls behandelt.
Konstitutionstypologischer Ansatz von W. Sheldon: Dieses Kapitel präsentiert Sheldons Theorie. Ähnlich wie im Kapitel über Kretschmer werden Biographie, Klassifizierung des Körperbaus und der Zusammenhang mit Verhaltensweisen und Temperamenten detailliert dargestellt. Die Kritik an Sheldons Ansatz wird ebenfalls diskutiert.
Vergleich der Theorien beider Persönlichkeitsforscher: Dieses Kapitel vergleicht die Theorien von Kretschmer und Sheldon, analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren methodischen Ansätzen, Körperbautypen und den Schlussfolgerungen hinsichtlich des Zusammenhangs von Körperbau und Persönlichkeit. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung der beiden Forscher und der Bewertung ihrer jeweiligen Beiträge zur Persönlichkeitspsychologie.
Schlüsselwörter
Konstitutionstypologie, Persönlichkeitspsychologie, Ernst Kretschmer, William H. Sheldon, Körperbau, Temperament, Psychosen, Somatotypen, Typologie, biologisch-biogenetische Hypothese.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konstitutionstypologische Ansätze in der Persönlichkeitspsychologie
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht konstitutionstypologische Ansätze zur Erklärung von Persönlichkeit, mit Fokus auf die Theorien von Ernst Kretschmer und William H. Sheldon. Sie beschreibt die historischen Konzepte beider Forscher, deren Körperbautypen und Persönlichkeitsklassifikationen und vergleicht beide Theorien. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, einen Überblick über konstitutionstypologische Konzepte, detaillierte Darstellungen der Ansätze von Kretschmer und Sheldon, einen Vergleich beider Theorien und ein Schlusswort. Schlüsselwörter und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Persönlichkeitsforscher stehen im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Theorien von Ernst Kretschmer und William H. Sheldon, zwei zentralen Figuren der konstitutionstypologischen Persönlichkeitsforschung.
Was sind konstitutionstypologische Ansätze?
Konstitutionstypologische Ansätze in der Persönlichkeitspsychologie basieren auf der Annahme eines biologisch-biogenetischen Zusammenhangs zwischen Körperbau und psychischen Merkmalen. Sie versuchen, Persönlichkeitsmerkmale anhand von Körperbautypen zu klassifizieren.
Welche historischen Persönlichkeiten werden in der Arbeit erwähnt?
Neben Kretschmer und Sheldon werden weitere relevante Persönlichkeiten der Typologie erwähnt, darunter Theophrast, Moliere, Schiller, Nietzsche, Jaspers, Spranger, Hippokrates und Rostan. Die Arbeit differenziert zwischen philosophisch-phänomenologischen und konstitutionstypologischen Ansätzen.
Wie werden die Theorien von Kretschmer und Sheldon dargestellt?
Für beide Forscher werden Biographie, Klassifizierung von Körperbautypen (bei Kretschmer: leptosom, athletisch, pyknisch; bei Sheldon: Ektomorph, Mesomorph, Endomorph) und der Zusammenhang mit Persönlichkeit bzw. Verhalten (bei Kretschmer: Psychosen und Temperamente; bei Sheldon: Temperamente) detailliert dargestellt. Die jeweilige Kritik an ihren Ansätzen wird ebenfalls behandelt.
Wie werden die Theorien von Kretschmer und Sheldon verglichen?
Das Kapitel zum Vergleich analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den methodischen Ansätzen, Körperbautypen und Schlussfolgerungen beider Forscher bezüglich des Zusammenhangs von Körperbau und Persönlichkeit. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung und Bewertung ihrer Beiträge zur Persönlichkeitspsychologie.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Konstitutionstypologie, Persönlichkeitspsychologie, Ernst Kretschmer, William H. Sheldon, Körperbau, Temperament, Psychosen, Somatotypen, Typologie und biologisch-biogenetische Hypothese.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu konstitutionstypologischen Konzepten, Kapitel zu den Ansätzen von Kretschmer und Sheldon, ein Vergleichskapitel und ein Schlusswort. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel kurz erläutert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die historischen Konzepte von Kretschmer und Sheldon darzustellen, ihre Körperbautypen und Persönlichkeitsklassifikationen zu beschreiben und einen Vergleich beider Theorien durchzuführen, um deren Anwendbarkeit und Vertretbarkeit in der heutigen Zeit zu evaluieren.
- Quote paper
- Katja Otto (Author), 2001, Konstitutionstypologische Auffassungen von Persönlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50734