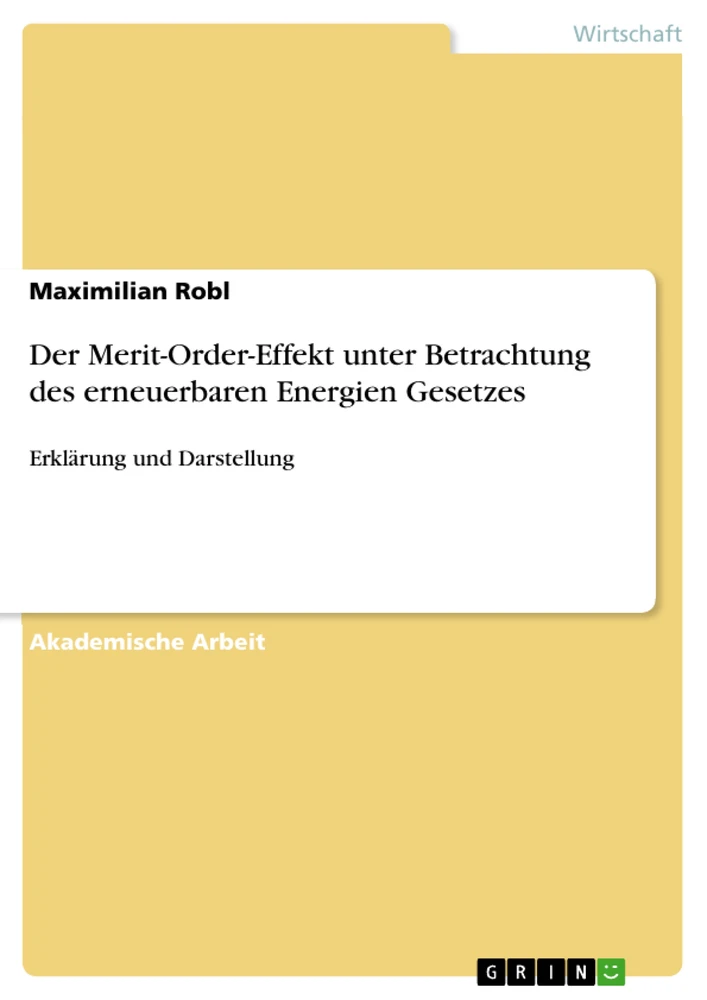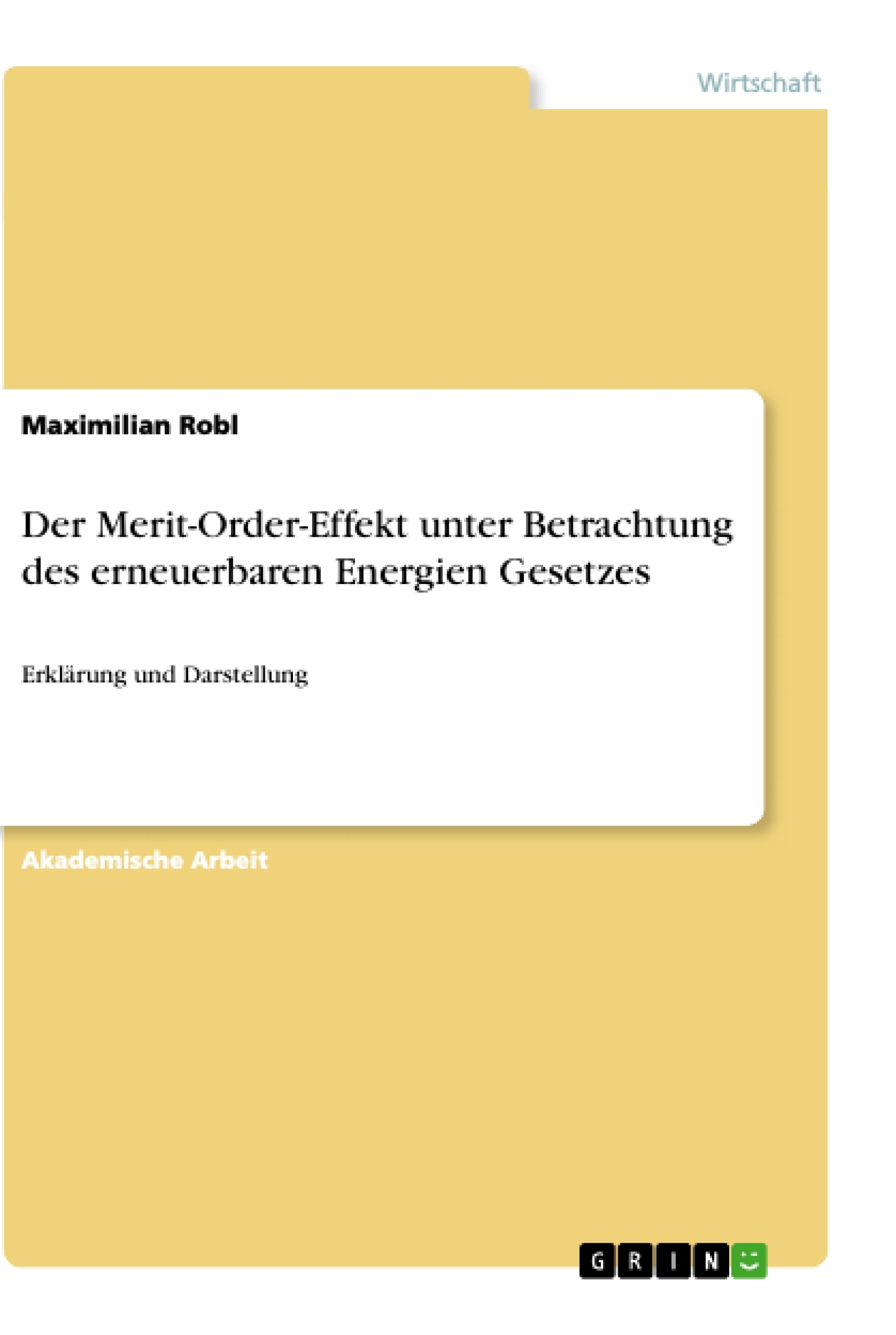Im Rahmen dieser Studienarbeit wird untersucht, was man unter dem Merit-Order-Effekt zu verstehen hat, was dessen Auswirkungen auf die Strompreisbildung sind und ob man mit kurz- und langfristigen Effekten rechnen kann.
Spricht man in der Energiebranche von Merit-Order, so meint es die Einsatzreihenfolge von stromerzeugenden Kraftwerken. Die Reihenfolge der Kraftwerke ergibt sich hierbei durch die unterschiedlichen Grenzkosten der Stromproduktion. Man kann es sich wie folgt vorstellen: Auf einem Markt gibt es eine gewisse Nachfrage nach Strom und es gibt Kraftwerke, welche unterschiedliche Grenzkosten der Stromerzeugung aufweisen. Beginnt man mit den niedrigsten Grenzkosten eines Kraftwerks, werden im Verlauf
Kraftwerke mit steigenden Kosten miteinbezogen, bis die Nachfrage nach Strom gedeckt ist. Der Strompreis ergibt sich also aus dem Kraftwerk mit den höchsten Grenzkosten. Daraus entsteht der „Market Clearing Price“, welcher in summa durch das letzte Gebot an der Strombörse den Strompreis festlegt. Im Folgenden wird auf das zentrale Thema der Studienarbeit, den sich daraus resultierenden Merit-Order-Effekt, eingegangen, dessen Wirkungsweise und verschiedene Formen dargestellt und kritisch analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Analyse des Begriffs Merit-Order
- 2. Der Merit-Order-Effekt mit Bezug auf das EEG
- 2.1 Grundlegende Darstellung des Effekts
- 3. Langfristige und kurzfristige Effekte
- 3.1 Kurzfristige Effekte
- 3.1.1 Internationaler Stromhandel
- 3.1.2 Korrelation von EE-Einspeisung und Last
- 3.1.3 Zusammensetzung des Kraftwerkparks und der variablen Kosten
- 3.2 Langfristige Effekte
- 3.3 Zusammenfassung
- 3.1 Kurzfristige Effekte
- 4. Berechnung des Merit-Order-Effekts
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht den Merit-Order-Effekt, seine Auswirkungen auf die Strompreisbildung und seine kurz- und langfristigen Effekte. Der Fokus liegt auf der Analyse des Effekts im Kontext des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).
- Definition und Erklärung des Merit-Order-Effekts
- Auswirkungen des EEG auf den Merit-Order-Effekt
- Kurz- und langfristige Folgen des Merit-Order-Effekts
- Preiswirkungen und Verteilungseffekte
- Berechnung und Quantifizierung des Merit-Order-Effekts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Analyse des Begriffs Merit-Order: Dieses Kapitel definiert den Merit-Order-Effekt als die Reihenfolge der Stromerzeugung aufgrund unterschiedlicher Grenzkosten der Kraftwerke. Es erklärt, wie der Strompreis durch das Kraftwerk mit den höchsten Grenzkosten bestimmt wird, den "Market Clearing Price". Der Begriff "Merit-Order" wird etymologisch analysiert und seine Anwendung im Energiesektor erläutert, wobei der Fokus auf der Abhängigkeit vom Kraftwerk mit den höchsten Grenzkosten und der daraus resultierenden Preisbildung liegt. Das Kapitel dient als Grundlage für das Verständnis des zentralen Themas der Arbeit.
2. Der Merit-Order-Effekt mit Bezug auf das EEG: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des EEG auf den Merit-Order-Effekt. Das EEG fördert den Ausbau erneuerbarer Energien, deren Grenzkosten in der Regel null sind. Die priorisierte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien verschiebt die residuale Nachfragekurve, da ein Teil der Nachfrage bereits durch erneuerbare Energien gedeckt ist. Das Kapitel analysiert die daraus resultierende Senkung des Strompreises und die Verdrängung teurerer konventioneller Kraftwerke. Es betont jedoch, dass Anpassungseffekte im Stromaussenhandel und im konventionellen Kraftwerkspark vernachlässigt werden. Der Merit-Order-Effekt wird als Preis- und Verteilungseffekt beschrieben, mit kostensenkenden Auswirkungen für den Endverbraucher, aber gleichzeitig mit Einnahmeverlusten für die Erzeuger.
2.1 Grundlegende Darstellung des Effekts: Dieses Unterkapitel veranschaulicht den Merit-Order-Effekt anhand einer Grafik, die die Verschiebung der residualen Nachfragekurve durch die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien zeigt. Es erklärt, wie die verringerte Nachfrage den Strompreis senkt. Die Differenz zwischen den Preisniveaus mit und ohne erneuerbare Energien repräsentiert den Merit-Order-Effekt. Das Kapitel diskutiert auch die Grenzen der Darstellung aufgrund von Änderungen im EEG ab 2010 und wie sich die Intensität der Last auf die Höhe des Effekts auswirkt, wobei in Spitzenlastzeiten eine deutlich höhere Preisreduktion beobachtet wird als in Zeiten geringer Last.
Schlüsselwörter
Merit-Order-Effekt, Erneuerbare Energien, EEG, Strompreisbildung, Grenzkosten, residuale Nachfragekurve, Großhandelsmarkt, Preis- und Verteilungseffekte, kurz- und langfristige Effekte, Kraftwerkpark, internationale Stromhandel.
Häufig gestellte Fragen: Merit-Order-Effekt und Erneuerbare Energien
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studie analysiert den Merit-Order-Effekt, seine Auswirkungen auf die Strompreisbildung und seine kurz- und langfristigen Folgen, insbesondere im Kontext des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).
Was ist der Merit-Order-Effekt?
Der Merit-Order-Effekt beschreibt die Reihenfolge der Stromerzeugung aufgrund unterschiedlicher Grenzkosten der Kraftwerke. Der Strompreis wird durch das Kraftwerk mit den höchsten Grenzkosten (Market Clearing Price) bestimmt. Die Studie erläutert den Begriff etymologisch und seine Anwendung im Energiesektor.
Wie beeinflusst das EEG den Merit-Order-Effekt?
Das EEG fördert erneuerbare Energien mit meist null Grenzkosten. Die priorisierte Einspeisung dieser Energien verschiebt die residuale Nachfragekurve und senkt den Strompreis, da ein Teil der Nachfrage bereits gedeckt ist. Dies führt zur Verdrängung teurerer konventioneller Kraftwerke. Die Studie berücksichtigt jedoch auch Anpassungseffekte im internationalen Stromhandel und im Kraftwerkspark.
Welche kurzfristigen Effekte werden betrachtet?
Die Studie untersucht kurzfristige Effekte wie den Einfluss auf den internationalen Stromhandel, die Korrelation von EE-Einspeisung und Last sowie die Zusammensetzung des Kraftwerkparks und der variablen Kosten.
Welche langfristigen Effekte werden betrachtet?
Die Studie analysiert langfristige Effekte des Merit-Order-Effekts, ohne diese im Detail zu spezifizieren.
Wie wird der Merit-Order-Effekt berechnet?
Die Studie beschreibt die Berechnung des Merit-Order-Effekts, gibt aber keine detaillierte Formel oder Methode an.
Welche Preis- und Verteilungseffekte werden untersucht?
Die Studie untersucht die kostensenkenden Auswirkungen des Merit-Order-Effekts für den Endverbraucher und die gleichzeitigen Einnahmeverluste für die Erzeuger.
Wie wird der Merit-Order-Effekt grafisch dargestellt?
Ein Unterkapitel veranschaulicht den Effekt anhand einer Grafik, die die Verschiebung der residualen Nachfragekurve durch die Einspeisung erneuerbarer Energien zeigt und wie die verringerte Nachfrage den Strompreis senkt. Die Grenzen dieser Darstellung aufgrund von Änderungen im EEG und der Lastintensität werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Merit-Order-Effekt, Erneuerbare Energien, EEG, Strompreisbildung, Grenzkosten, residuale Nachfragekurve, Großhandelsmarkt, Preis- und Verteilungseffekte, kurz- und langfristige Effekte, Kraftwerkpark, internationaler Stromhandel.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie umfasst Kapitel zu Einleitung und Begriffsanalyse des Merit-Order-Effekts, dem Effekt im Kontext des EEG (inkl. einer grundlegenden Darstellung), kurz- und langfristigen Effekten, der Berechnung des Effekts und einem Fazit.
- Quote paper
- Maximilian Robl (Author), 2016, Der Merit-Order-Effekt unter Betrachtung des erneuerbaren Energien Gesetzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506939