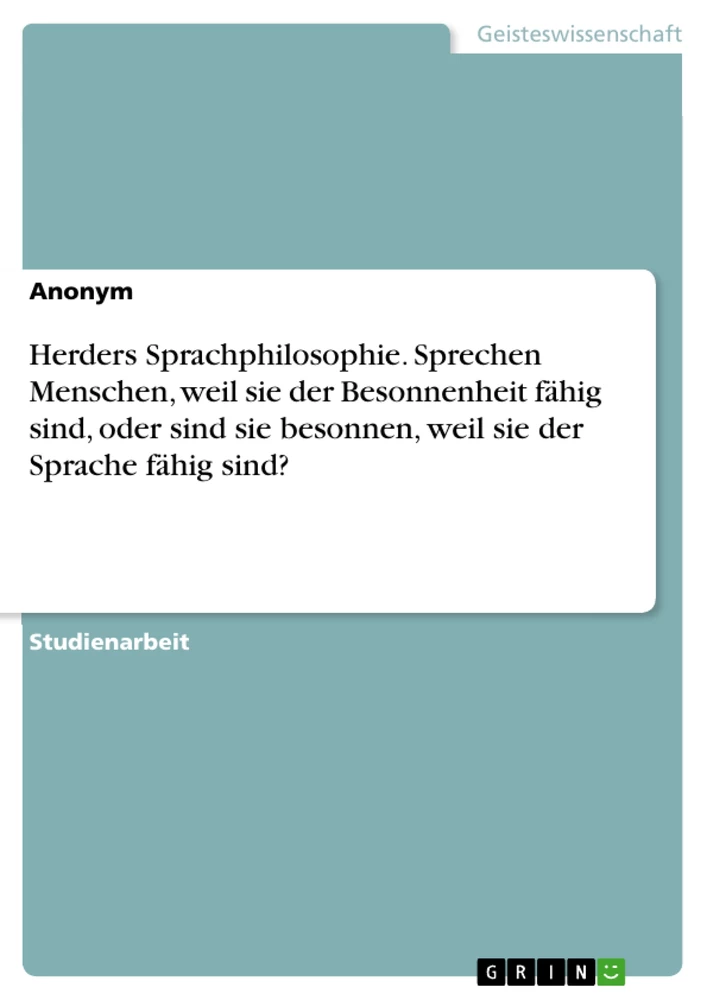Herders Gedanken zur Sprache werden in dieser Arbeit analysiert und interpretiert, wobei die menschliche Fähigkeit des Sprechens im Vordergrund stehen wird. Da Herder in seinem Buch den Begriff der Besonnenheit mit unserem Sprachvermögen verknüpft, wird diese Arbeit die Wichtigkeit dessen analysieren und hinterfragen, ob diese Besonnenheit letztendlich für unser Sprachvermögen verantwortlich ist, oder lediglich aufgrund unserer Sprechfähigkeit entwickelt wurde. Dafür wird erst die Anthropologie Herders näher erläutert werden, um festzustellen, ob der Mensch einer besonnenen Denkweise überhaupt fähig ist. Als nächstes wird der besagte Begriff nach Herders Verständnis erklärt und in Zusammenhang mit dem Sprachvermögen gebracht. Dann werden beide Positionen gegenübergestellt, hauptsächlich, um uns darüber im Klaren zu werden, was es bedeutet, die Sprache durch Besinnung zu erklären und die Besinnung durch Sprache zu erklären. Das Fazit wird zusammenfassend klären, ob Herder überhaupt einen Vorrang von beiden argumentiert oder nicht vielleicht sogar eine dritte Position anbietet.
Was ist Sprache? Wieso sprechen wir? Kaum einer würde sich heute diese Frage stellen, denn unsere Sprache ist für viele so natürlich wie das Atmen. Wieso sich Gedanken um etwas machen, das uns wohl angeboren wurde? Doch wird erst gründlicher darüber nachgedacht, merken wir, dass die Sprache doch einen tieferen Sinn haben könnte, als wir zunächst meinen. Wieso sonst sind die Menschen die einzigen Geschöpfe auf der Erde, die es schaffen, sich mündlich auszudrücken? Menschen kommunizieren nicht nur miteinander, sondern entwickeln auch verschiedene Varianten der Sprache und bestimmen ihre Grammatik und Rechtschreibung.
Die Philosophen der sogenannten Sprachphilosophie haben es sich zur Aufgabe gemacht, einem (für uns vollkommen natürlichen) Prozess wie der Sprachentwicklung einen neuen Sinn zu geben und uns neue Sichtweisen zu eröffnen. Es war deswegen auch kein Zufall, dass die königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Jahr 1769 gerade diese Preisfrage stellte: "Haben die Menschen ihren Naturfähigkeiten überlassen, sich selbst Sprache erfinden zu können und auf welchem Wege wären sie am füglichsten dazu gelangt." Johann Gottfried Herder schrieb dazu seine "Abhandlung über den Ursprung der Sprache" und sorgte nicht nur für neue Sichtweisen in der damaligen Zeit, sondern sein Text spielt auch bis heute eine große Rolle in der Sprachphilosophie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anthropologie Herders
- Freiheit
- Besonnenheit
- Selbstreflexion
- Besonnenheit in Bezug zur Sprache
- Sprache als göttlicher Ursprung?
- Besonnenheit durch Sprache
- Sprache durch Besonnenheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Herders Sprachphilosophie und beleuchtet die zentrale Frage, ob Menschen sprechen, weil sie zur Besonnenheit fähig sind oder ob sie besonnen sind, weil sie Sprache besitzen. Der Text analysiert Herders Anthropologie, den Begriff der Besonnenheit und sein Verhältnis zur Sprache, und untersucht die beiden Positionen, die Sprache durch Besinnung und Besinnung durch Sprache zu erklären.
- Herder's anthropologische Konzeption des Menschen
- Der Begriff der Besonnenheit in Herders Philosophie
- Die Verbindung zwischen Besonnenheit und Sprache
- Die Rolle der Freiheit in Herders Sprachtheorie
- Die Frage nach dem Ursprung und der Entwicklung der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Fragestellung ein, die sich mit der Beziehung zwischen Sprache und Besonnenheit beschäftigt. Sie stellt Herders Abhandlung über den Ursprung der Sprache als zentralen Bezugspunkt vor und betont die Bedeutung seiner Theorien für die Sprachphilosophie des 18. Jahrhunderts.
- Anthropologie Herders: Dieses Kapitel beleuchtet Herders Anthropologie, die den Menschen als ein Wesen mit Mängeln, aber auch mit Vernunft und Freiheit beschreibt. Es wird betont, dass Herders Anthropologie sich von den traditionellen Ansichten seiner Zeit unterscheidet und eine neue Perspektive auf den Menschen eröffnet.
- Freiheit: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Freiheit in Herders Philosophie und zeigt, wie er sich von der Freiheit des Tieres unterscheidet. Freiheit wird als die Fähigkeit des Menschen verstanden, seine Kraft frei auszuüben, sich nicht von Instinkten leiten zu lassen und sich zu verbessern.
- Besonnenheit: Dieses Kapitel widmet sich dem Begriff der Besonnenheit und seiner Bedeutung in Herders Sprachphilosophie. Es wird erläutert, wie die Besonnenheit als eine Eigenschaft des Menschen verstanden wird, die ihm die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Kontrolle seiner Handlungen ermöglicht.
- Besonnenheit in Bezug zur Sprache: Dieses Kapitel untersucht die Verbindung zwischen Besonnenheit und Sprache in Herders Werk. Es wird die These aufgestellt, dass die Besonnenheit eine Voraussetzung für die Entwicklung der Sprache ist und dass Sprache wiederum die Besonnenheit fördert und verfeinert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete dieser Arbeit sind Herders Sprachphilosophie, Anthropologie, Besonnenheit, Freiheit, Sprache, Ursprung der Sprache, Selbstreflexion, Vernunft und Kultur. Die Analyse konzentriert sich auf Herders Abhandlung über den Ursprung der Sprache und seine Theorie, dass Sprache nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern eng mit der menschlichen Besonnenheit und Freiheit verbunden ist.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Herders Sprachphilosophie. Sprechen Menschen, weil sie der Besonnenheit fähig sind, oder sind sie besonnen, weil sie der Sprache fähig sind?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506844