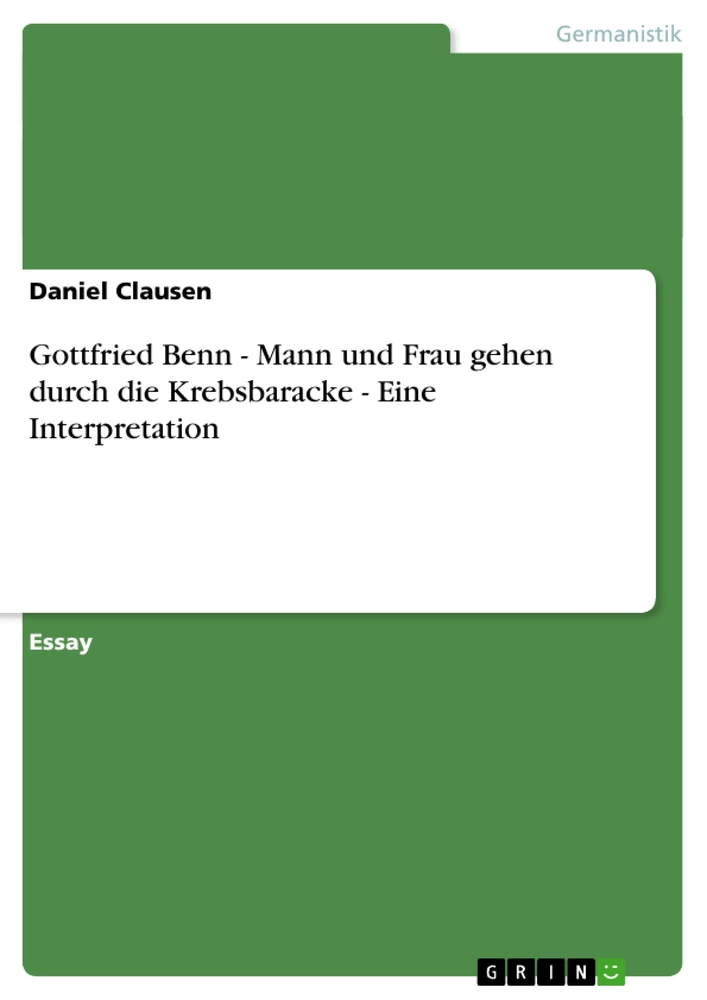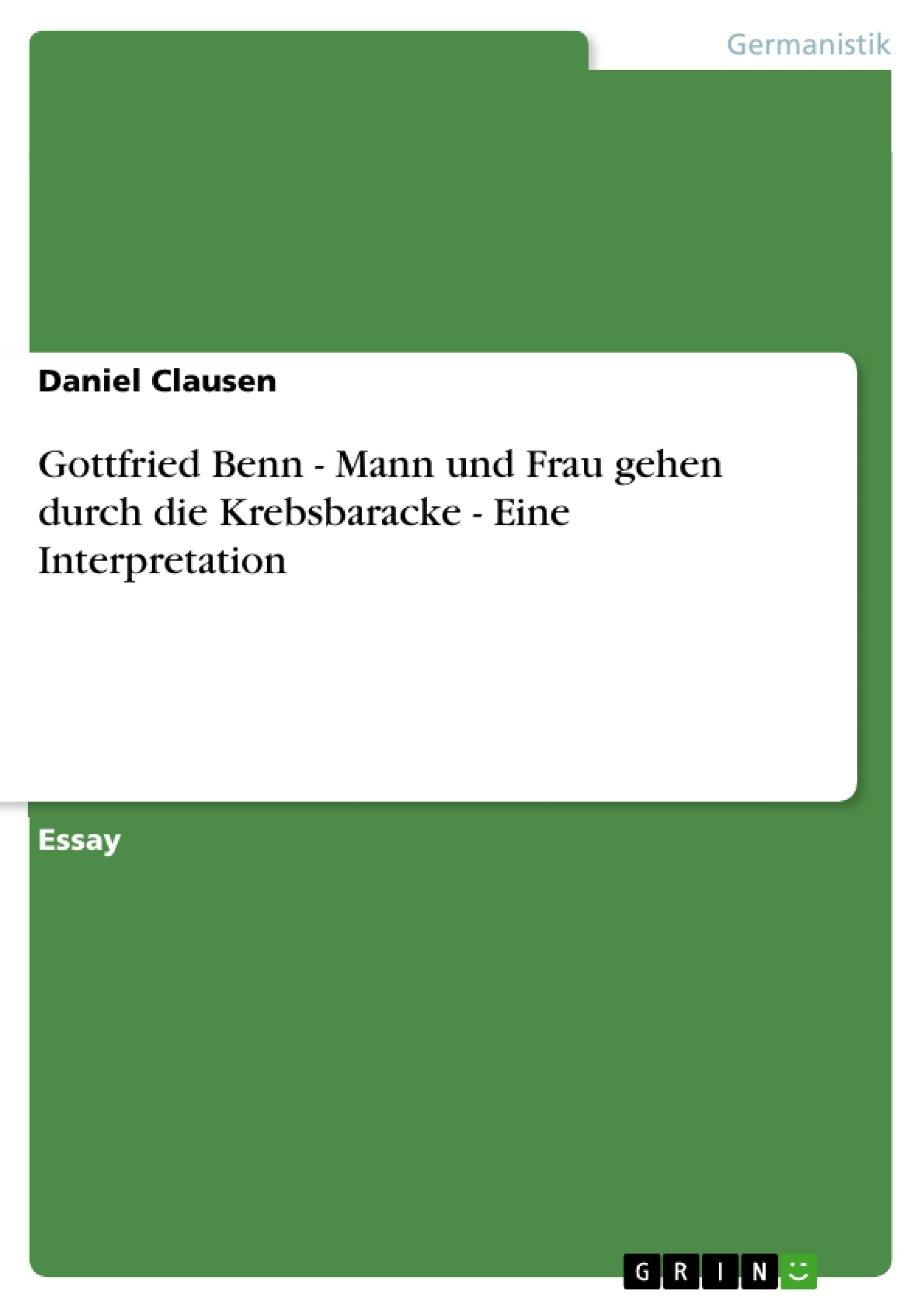Einleitung
In einer Zeit, in der Menschen stetig nach dem Idealen Ausschau halten, und dabei alles verdrängen, das uns an unsere Vergänglichkeit erinnern könnte, zeigen Veröffentlichungen, wie das Lyrikband „Morgue“ aus dem Jahre 1912, von Gottfried Benn in aller Deutlichkeit, dass die Realität mit Entwicklungen einhergeht, die den meisten von uns mühsam vor Augen geführt werden müssen. Wir versuchen uns immer den Blicken auf die Hässlichkeit erfolgreich zu entziehen.
„Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke“ handelt, dem Titel entsprechend, von dem Gang durch eine Krebsbaracke. Mit jedem Schritt vorbei an den Krankenlagern wird das Elend deutlicher. Mit jedem Schritt wird aber auch umso deutlicher, dass das Leid in der Erlösung des Todes mündet. Aber auch der religiöse Einfluss im Moment der Hilflosigkeit wird in Benns Gedicht verarbeitet. Im Folgenden wird zu zeigen sein, dass Gottfried Benn sehr explizit das naturgebundene Leiden von Menschen und deren Erlösung beschreibt.