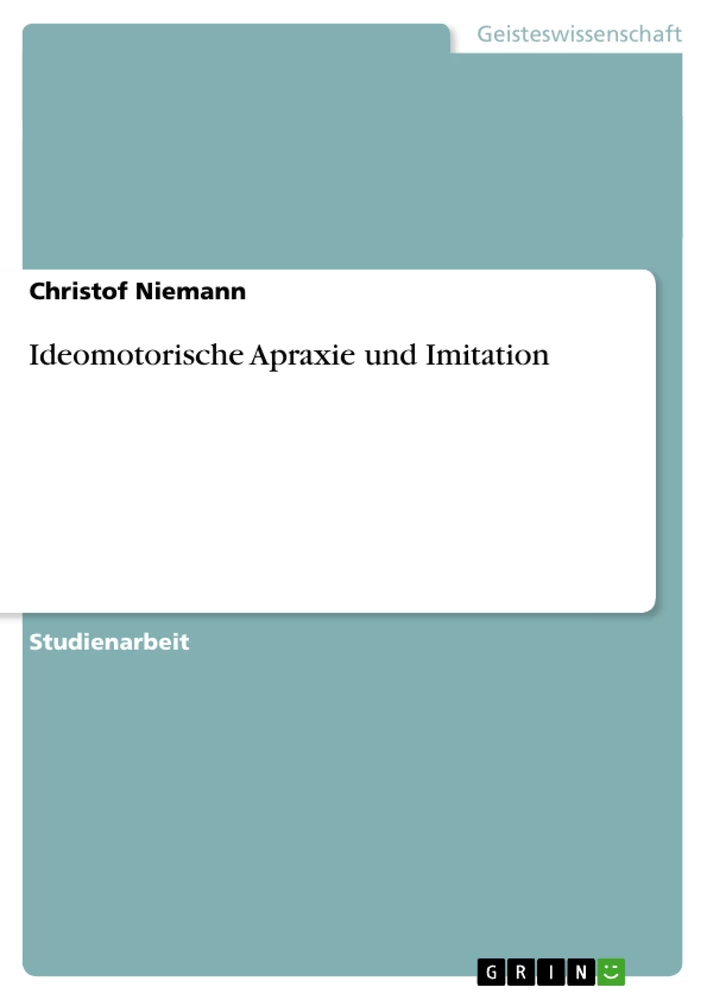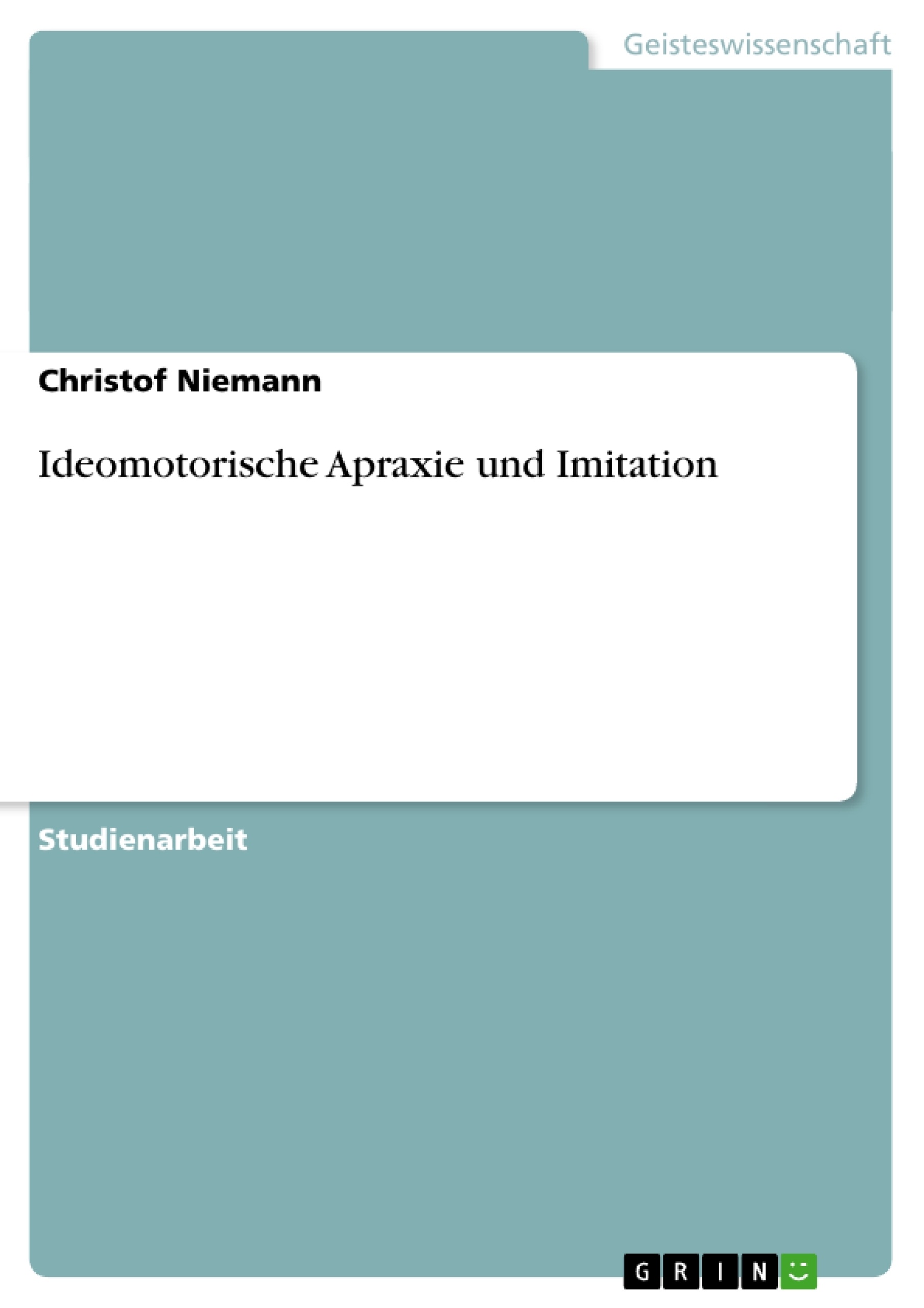Schädigungen des Gehirns wie sie z.B. bei einem Schlaganfall auftreten können, sind die Ursache vielerlei höchst unterschiedlicher Krankheitsbilder, in denen die Geschädigten nicht selten seltsame Verhaltensweisen an den Tag legen oder sich in bestimmten Bereichen des täglichen Lebens als vollkommen unfähig erweisen. In weniger drastischen Fällen hingegen sind die Beeinträchtigungen für die Umwelt vielleicht kaum wahrnehmbar.
Wenn ein Patient nicht mehr weiß, wozu Objekte des normalen Umgangs dienen, so kann man dies sicherlich als schwere Beeinträchtigung werten. Wenn ein Patient eine Säge ratlos abtastet, sich mit Stempel und Stempelkissen ein „Sandwich“ bastelt, um es dann zum Mund zu führen und schließlich in einen Telefonhörer bläst, um daraufhin an beiden Muscheln zu lauschen, so ist dies die Folge einer spezifischen Schädigung neuronaler Strukturen. Einen Keks dagegen nimmt er mit routinierter Geschicklichkeit zu sich, ein erstaunliches Merkmal des Krankheitsbildes Apraxie. Der hier beschriebene Patient ist ein extremer Fall, bei dem weitere Störungen zusätzlich festgestellt wurden. Häufig sind die Fehlhandlungen nicht derart massiv, aber auch nicht weniger behindernd für den Patienten. Ein typischer Fall ist jener Versuch, in dem der Patient eine alltägliche Handlung wie das Zähneputzen ausführen soll. Er benutzt einen Becher ohne das Wasser aufzudrehen, versucht aus einer geschlossenen Tube Zahnpasta zu drücken und putzt die Zähne schließlich umständlich atypisch und in nicht effektiver Art und Weise. Nur das Aufdrehen des Verschlusses gelingt zügig und geschickt, ein Widerspruch, der für apraktische Störungen kennzeichnend ist. Die folgenden Ausführungen basieren auf dem Referat „Ideomotorische Apraxie und Imitation“ und der darin zugrunde gelegten Literatur und sollen dieses Krankheitsbild näher beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines zur Apraxie
- Definition
- Klassifikation der Apraxien
- Sonderformen der Apraxie
- Zur Entdeckungsgeschichte der Apraxie
- Neuroanatomische Grundlagen
- Symptomatik der Apraxie
- Störungen im Umgang mit Objekten
- Fehlerhaftes Imitieren von Bewegungen
- Fehlende und entdifferenzierte kommunikative Gesten
- Die Behandlung von Apraxie
- Imitating Gestures and Manipulating a Mannikin - Die Goldenbergstudie
- Die Liepmann-Studie
- Methodisches Vorgehen der Goldenbergstudie
- Ergebnisse
- Diskussion
- Die Hypothese des „Multi-Part Mechanical Object“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht das Krankheitsbild der Apraxie, einer Störung der zielgerichteten Handlungen, die auf Schädigungen des Gehirns zurückzuführen ist. Im Zentrum steht die ideomotorische Apraxie, die sich durch die fehlerhafte Ausführung von Bewegungen äußert. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Formen der Apraxie, ihre neuroanatomischen Grundlagen, die Symptomatik und die Schwierigkeiten in der Diagnose.
- Definition und Klassifikation der Apraxie
- Neuroanatomische Grundlagen der Apraxie
- Symptomatik und diagnostische Herausforderungen
- Ideomotorische Apraxie und Imitation
- Die Goldenbergstudie und die Hypothese des „Multi-Part Mechanical Object“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Problematik der Apraxie und die Schwierigkeiten, die diese Störung für Betroffene mit sich bringt. Im zweiten Kapitel wird die Apraxie definiert und verschiedene Formen, wie die ideomotorische und die ideatorische Apraxie, klassifiziert. Es werden auch Sonderformen der Apraxie vorgestellt. Außerdem wird auf die Entdeckungsgeschichte der Apraxie eingegangen.
Kapitel 3 befasst sich mit den neuroanatomischen Grundlagen der Apraxie. Kapitel 4 behandelt die Symptomatik der Apraxie, wobei verschiedene Bereiche wie Störungen im Umgang mit Objekten, fehlerhaftes Imitieren von Bewegungen und fehlende oder entdifferenzierte kommunikative Gesten näher betrachtet werden. Im fünften Kapitel geht es um die Behandlung der Apraxie.
Das sechste Kapitel widmet sich der Goldenbergstudie, die sich mit dem Einfluss von Imitation auf die Ausführung von Bewegungen bei Patienten mit ideomotorischer Apraxie auseinandersetzt. Die Studie baut auf der Liepmann-Studie auf und untersucht die Hypothese des „Multi-Part Mechanical Object“.
Schlüsselwörter
Apraxie, ideomotorische Apraxie, ideatorische Apraxie, Imitation, Neuroanatomie, Gehirn, Schädigung, Handlung, Bewegung, Störungen, Goldenbergstudie, Liepmann-Studie, „Multi-Part Mechanical Object“, Klassifikation, Symptomatik.
- Citar trabajo
- Christof Niemann (Autor), 2005, Ideomotorische Apraxie und Imitation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50618