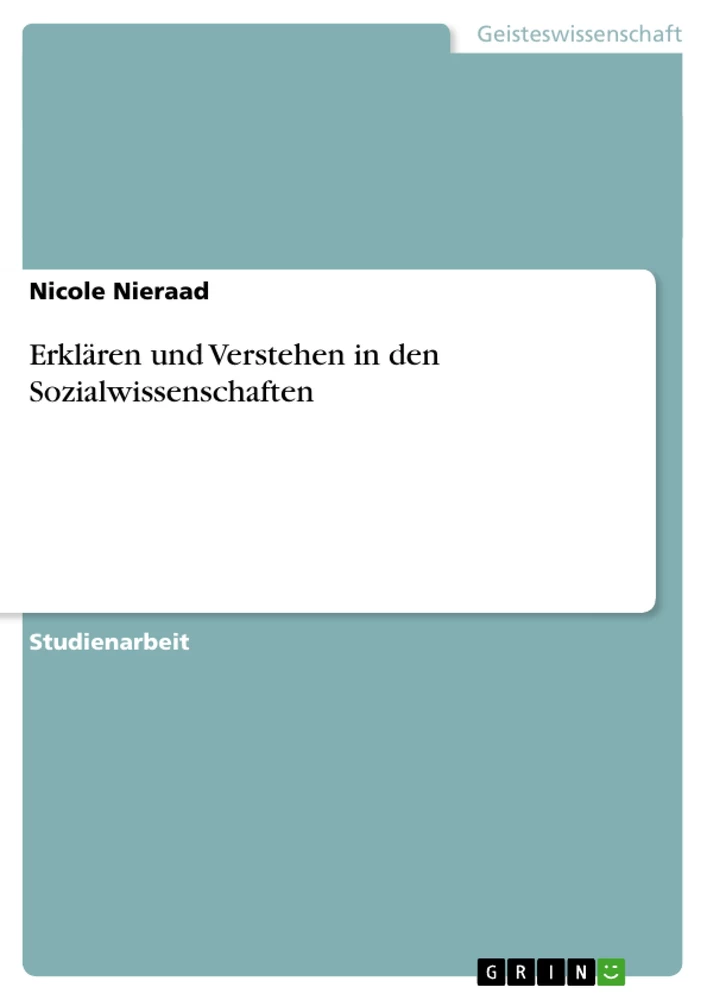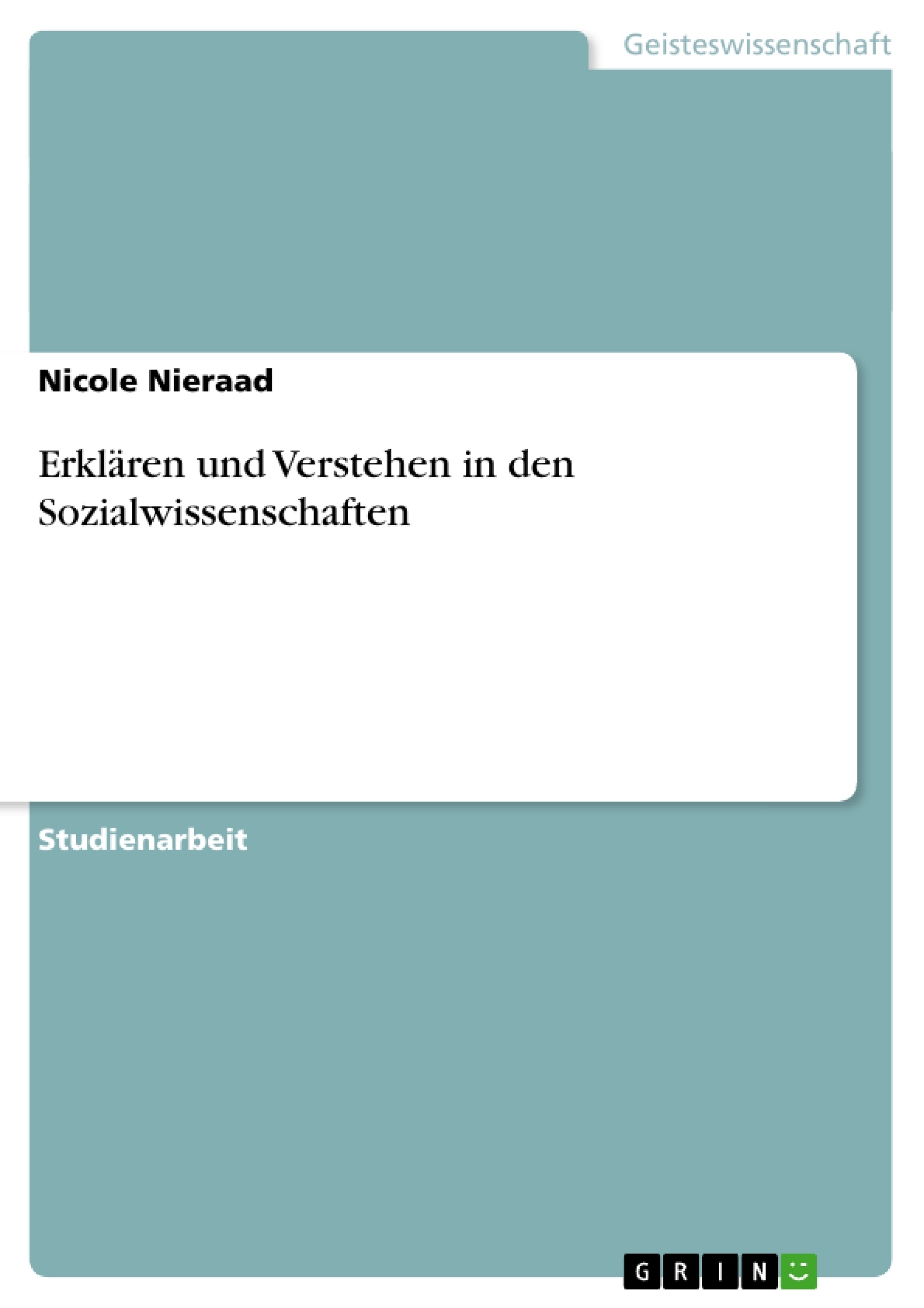Nach Hartmut Esser verfügte die Soziologie, anders als beispielsweise Teile der Naturwissenschaften, nie über einen einheitlichen, gemeinsam akzeptierten Theoriekern. Es gab (und gibt noch) zahlreiche wissenschaftliche Kontroversen über beispielsweise das Verhältnis zwischen Theorie und wissenschaftlicher Praxis, über das Vorziehen der „erklärenden“ oder „verstehenden“ Methode und damit einhergehend über die Angemessenheit qualitativer und quantitativer Methoden.
Seit über 100 Jahren besonders die Debatte um zwei Haupttraditionen der Sozialwissenschaft zu einem Gebiet von Unstimmigkeiten. Diese beiden Positionen werden von Wilhelm von Wright die „galileische“ und die „aristotelische“ Tradition genannt. Bei dieser Kontroverse stehen sich verkürzt die „erklärende“ Sozialwissenschaft mit einer naturwissenschaftlichen Herangehensweise und die „verstehende“ Sozialwissenschaft mit einer „philosophisch-hermeneutischen“ Herangehensweise gegenüber. Während die „galileische“ Tradition nach einer kausalen, allgemeinen Gesetzen entsprechenden Erklärung des Verhaltens sucht, stellt die „aristotelische“ Tradition die Motive des menschlichen Verhaltens in den Vordergrund.
Als Ausgangspunkt dieser „Erklären“-„Verstehen“-Debatte kann u.a. Wilhelm Diltheys „Einleitung in die Geisteswissenschaft“ aus dem Jahr 1883 genannt werden. Daraufhin wurden die sich gerade entwickelnden Sozialwissenschaften zum Austragungsort für die Grundsatzdebatte der zwei oben genannten Denktraditionen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat die Kontroverse mehrere Phasen durchlaufen, die im Folgenden untersucht werden sollen. Dabei wird in diesem Zusammenhang auch auf einige wichtige wissenschaftliche Vertreter der jeweiligen Positionen eingegangen werden. So werden Wilhelm Diltheys und Max Webers Konzepte ebenso behandelt wie der „Kritische Rationalismus“. Hierbei ist vor allem das sogenannte „Hempel-Oppenheim-Schema“ zu nennen. Außerdem wird Wilhelm von Wrights Veröffentlichung „Erklären und Verstehen“ zur Sprache kommen. Schließlich steht gegen Ende der Untersuchung die Frage, ob mittlerweile doch, beispielsweise durch das Modell der „soziologischen Erklärung“, eine Art Verknüpfung von „Erklären“ und „Verstehen“ in den Sozialwissenschaften möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Der „Positivismus“ des 19. Jahrhunderts
- 3. Die Entwicklung einer hermeneutischen Sozialwissenschaft
- 3.1 Abgrenzung von den Naturwissenschaften
- 3.2 Max Webers Konzept einer „verstehenden Soziologie“
- 4. Die „neo-positivistische\" These der Einheitsmethodologie
- 4.1 Die „Degradierung“ des Verstehens
- 4.2 Das „Hempel-Oppenheim-Schema“
- 5. Wilhelm von Wrights „praktischer Syllogismus“
- 6. Alternative „soziologische Erklärung“
- 6.1 Verbindung von „subjektivem“ Sinn und „objektiven“ Methoden
- 6.2 Das Grundmodell der „soziologischen Erklärung“
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung der Debatte um „Erklären“ und „Verstehen“ in den Sozialwissenschaften. Sie verfolgt das Ziel, die verschiedenen methodologischen Ansätze und ihre theoretischen Grundlagen zu beleuchten und den Diskurs um die Angemessenheit qualitativer und quantitativer Methoden zu veranschaulichen.
- Der Positivismus des 19. Jahrhunderts und seine Auswirkungen auf die Sozialwissenschaften
- Die Entwicklung einer hermeneutischen Sozialwissenschaft als Gegenposition zum Positivismus
- Die Kontroverse um „Erklären“ und „Verstehen“ und die Rolle von Wissenschaftlern wie Dilthey und Weber
- Der „neo-Positivismus“ und das Hempel-Oppenheim-Schema
- Alternative Modelle soziologischer Erklärung und die mögliche Verbindung von „Erklären“ und „Verstehen“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Das einführende Kapitel beschreibt die fehlende einheitliche Theorie in der Soziologie und die andauernde Debatte um „erklärende“ und „verstehende“ Methoden. Es wird die Kontroverse zwischen der „galileischen“ (naturwissenschaftlichen) und der „aristotelischen“ (hermeneutischen) Tradition vorgestellt, wobei die Suche nach kausalen Erklärungen der einen und die Fokussierung auf Motive des menschlichen Verhaltens der anderen Tradition zugeordnet werden. Diltheys „Einleitung in die Geisteswissenschaft“ wird als Ausgangspunkt dieser Debatte genannt. Die Arbeit selbst verfolgt einen chronologischen Aufbau, um die verschiedenen Phasen der Kontroverse zu untersuchen und wichtige Wissenschaftler wie Dilthey, Weber und Vertreter des kritischen Rationalismus zu berücksichtigen. Das Kapitel schließt mit der Fragestellung nach einer möglichen „Verknüpfung“ von „Erklären“ und „Verstehen“.
2. Der „Positivismus“ des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel behandelt den Einfluss des Positivismus auf die entstehenden Humanwissenschaften. Auguste Comte und John Stuart Mill werden als Hauptvertreter genannt, die eine methodologische Einheit aller Wissenschaften postulierten, wobei naturwissenschaftliche Methoden, insbesondere die mathematische Physik, als universell anwendbar angesehen wurden. Kausale und mechanistische Erklärungen, basierend auf der Subsumption individueller Sachverhalte unter allgemeine Naturgesetze, bilden den Kern des positivistischen Ansatzes. Die Betonung der methodischen Einheit, des mathematischen Idealtypus und der Bedeutung allgemeingültiger Gesetze charakterisieren diesen Ansatz als Teil der „galileischen“ Tradition.
3. Die Entwicklung einer hermeneutischen Sozialwissenschaft: Dieses Kapitel fokussiert auf die Entwicklung einer Gegenposition zum Positivismus im 19. Jahrhundert. Wissenschaftler wie Droysen, Dilthey und Simmel lehnten den methodologischen Monismus des Positivismus ab und betonten den Unterschied zwischen nomothetischen (naturwissenschaftlichen) und ideographischen (geisteswissenschaftlichen) Wissenschaften. Diltheys „Einleitung in die Geisteswissenschaft“ wird als ein zentrales Werk zur methodologischen und erkenntnistheoretischen Abgrenzung der Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften hervorgehoben. Der positivistische Erklärungsansatz wird in Frage gestellt, wobei die Unterscheidung zwischen „Erklären“ und „Verstehen“ im Mittelpunkt steht.
Schlüsselwörter
Erklären, Verstehen, Positivismus, Hermeneutik, Sozialwissenschaften, Methodenstreit, Qualitative Methoden, Quantitative Methoden, Dilthey, Weber, Hempel-Oppenheim-Schema, Soziologische Erklärung, Galileische Tradition, Aristotelische Tradition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Entwicklung der Debatte um „Erklären“ und „Verstehen“ in den Sozialwissenschaften
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht die historische Entwicklung der Debatte um „Erklären“ und „Verstehen“ in den Sozialwissenschaften. Er beleuchtet verschiedene methodologische Ansätze und deren theoretische Grundlagen, insbesondere die Kontroverse zwischen qualitativen und quantitativen Methoden.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt den Positivismus des 19. Jahrhunderts und seinen Einfluss auf die Sozialwissenschaften, die Entwicklung einer hermeneutischen Sozialwissenschaft als Gegenposition, die Kontroverse um „Erklären“ und „Verstehen“ mit der Rolle von Wissenschaftlern wie Dilthey und Weber, den „Neo-Positivismus“ und das Hempel-Oppenheim-Schema sowie alternative Modelle soziologischer Erklärung und die mögliche Verbindung von „Erklären“ und „Verstehen“.
Welche Wissenschaftler werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt wichtige Wissenschaftler wie Auguste Comte, John Stuart Mill, Wilhelm Dilthey, Max Weber und Vertreter des kritischen Rationalismus. Die Beiträge von Dilthey und Weber zur methodologischen Debatte werden besonders hervorgehoben.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text folgt einem chronologischen Aufbau, beginnend mit einer Einführung in die Problematik der fehlenden einheitlichen Theorie in der Soziologie. Es folgen Kapitel zum Positivismus, zur Entwicklung der hermeneutischen Sozialwissenschaft, zum Neo-Positivismus und dem Hempel-Oppenheim-Schema, zu alternativen soziologischen Erklärungsmodellen und abschließend eine Zusammenfassung und ein Ausblick.
Was ist der zentrale Konflikt, der im Text behandelt wird?
Der zentrale Konflikt ist die Auseinandersetzung zwischen der „galileischen“ (naturwissenschaftlichen) Tradition mit ihrem Fokus auf kausale Erklärungen und der „aristotelischen“ (hermeneutischen) Tradition, die sich auf das Verstehen menschlichen Handelns konzentriert. Der Text untersucht, wie dieser Konflikt die Methodologie der Sozialwissenschaften geprägt hat.
Welche methodologischen Ansätze werden verglichen?
Der Text vergleicht den positivistischen Ansatz mit der hermeneutischen Sozialwissenschaft. Es werden qualitative und quantitative Methoden diskutiert, und die Frage nach einer möglichen Integration beider Ansätze wird gestellt.
Was ist das Hempel-Oppenheim-Schema?
Das Hempel-Oppenheim-Schema ist ein Modell der deduktiv-nomologischen Erklärung, das im Rahmen des Neo-Positivismus entwickelt wurde. Der Text diskutiert dessen Rolle in der methodologischen Debatte der Sozialwissenschaften.
Welche Schlussfolgerung zieht der Text?
Der Text schließt mit der Frage nach einer möglichen „Verknüpfung“ von „Erklären“ und „Verstehen“ in den Sozialwissenschaften, wobei er verschiedene historische und methodologische Perspektiven beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Textinhalt?
Schlüsselwörter sind: Erklären, Verstehen, Positivismus, Hermeneutik, Sozialwissenschaften, Methodenstreit, Qualitative Methoden, Quantitative Methoden, Dilthey, Weber, Hempel-Oppenheim-Schema, Soziologische Erklärung, Galileische Tradition, Aristotelische Tradition.
- Quote paper
- M.A. Nicole Nieraad (Author), 2005, Erklären und Verstehen in den Sozialwissenschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50613