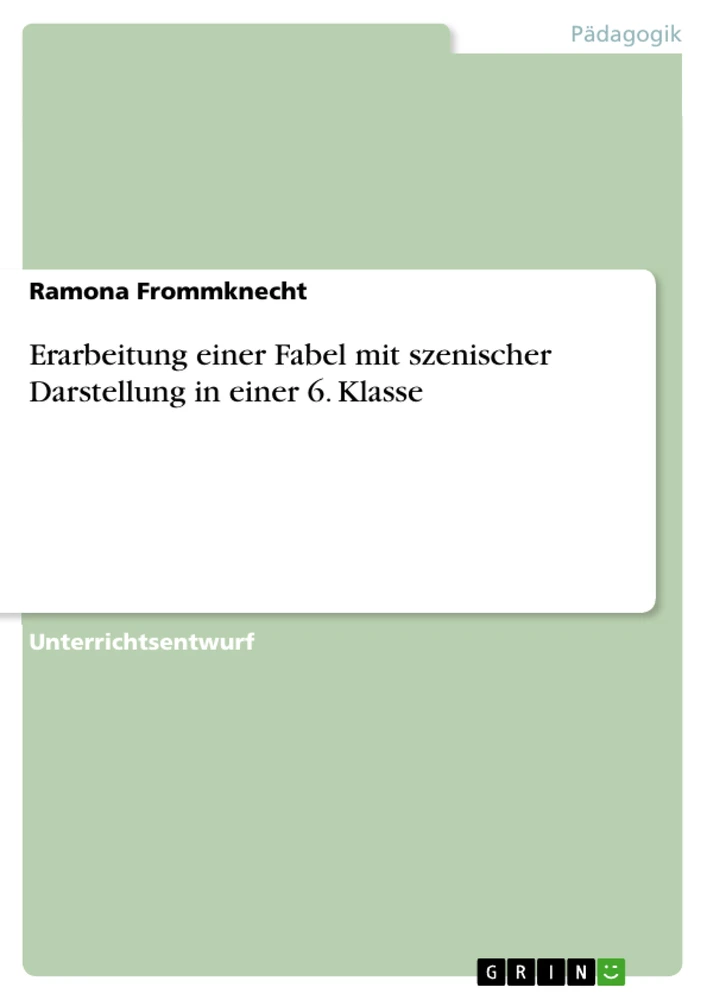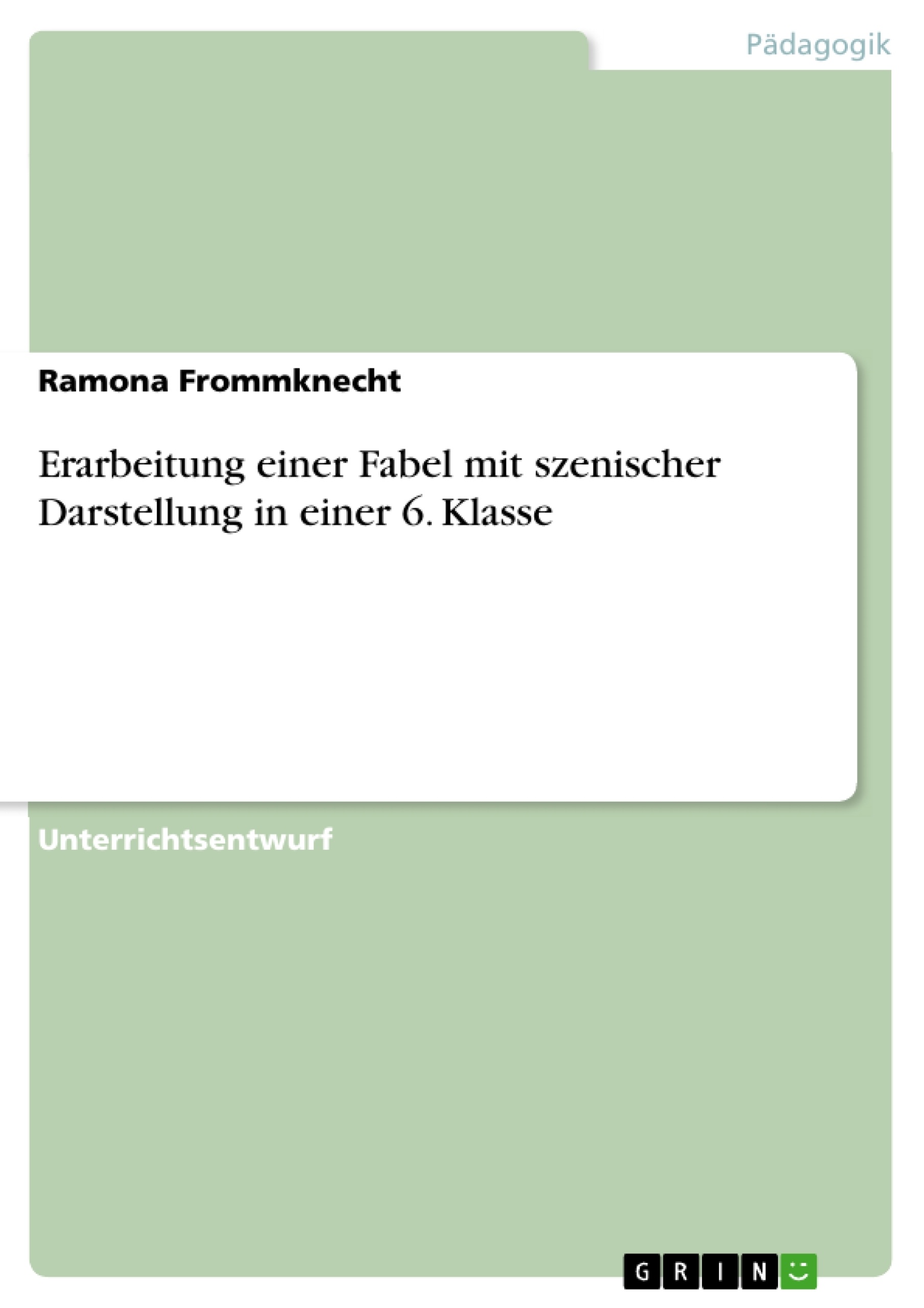Der vorliegende Unterrichtsentwurf soll den Schülern und Schülerinnen einer sechsten Klasse die Gattung der Fabel näher bringen. Dies erfolgt am Beispiel von Äsops Werk "Der Fuchs und der Ziegenbock", indem zunächst das Schema einer Fabel erläutert und der Inhalt anschließend szenisch dargestellt wird.
Die Fabel (lat. fabula = Erzählung) ist die epische Kurzform einer Erzählung. Dabei handelt es sich meist um eine Tierdichtung, die in Vers oder Prosa erzählt wird. In dieser Gattung handeln und sprechen Tiere. Sie tragen typische menschliche Eigenschaften. So wird der Fuchs meist als schlau und hinterlistig, der Esel als dumm, der Wolf als gierig und der Löwe als stark beschrieben. Durch das Handeln der Tiere können die Dichter Kritik an der Gesellschaft üben, ohne dies direkt aussprechen zu müssen. Einer der ersten uns bekannten Fabeldichter ist Äsop. Auch er versucht in seinen Fabeln "verkleidete" Wahrheiten zu erzählen und dadurch auf gesellschaftliche Missstände oder Schwächen hinzuweisen. Seine Fabeln werden bis heute gern gelesen und die Motive und Figuren seiner Fabeln wurden vielfach von anderen Dichtern variiert und aufgegriffen.
Der Aufbau einer Fabel folgt einem dreigliedrigen Schema. Zunächst wird die Ausgangssituation beschrieben. Da die Tiere häufig Gegner sind, kommt es anschließend meist zu einem Konflikt, welcher sich in einer überraschenden Wende löst, in der oft das listigere oder schwächere Tier gewinnt. Am Ende einer Fabel steht in vielen Fällen eine Lehre, die den Leser über allgemeine Wahrheiten belehren und aus der er Schlüsse für sein eigenes Verhalten ziehen soll. In der vorliegenden Fabel "Der Fuchs und der Ziegenbock" von Äsop geht es in der vordergründigen Handlung um einen Fuchs, der in einem Brunnen gefangen ist und nicht mehr herauskommt. Doch durch die Überlistung eines Ziegenbocks gelingt es dem Fuchs aus dem Brunnen herauszusteigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Durchdringung und Analyse der Sache
- 1.1 Fabeln
- 1.2 Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren
- 2. Rahmenbedingungen und heterogene Lernvoraussetzungen
- 2.1 Darstellung der Schule
- 2.2 Klassensituation
- 2.3 Analyse der Lernvoraussetzungen
- 3. Didaktische Analyse
- 3.1 Bildungswert des Unterrichtsgegenstandes
- 3.2 Bezug zum Bildungsplan
- 4. Aufgabenstellung und Differenzierung
- 4.1 Aufgabenanalyse
- 4.2 Formen der Differenzierung
- 5. Methodische Entscheidung und unterrichtspraktische Umsetzung
- 6. Strukturskizze/ Verlaufsplanung
- 7. Literaturverzeichnis
- 8. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf beschreibt die ganzheitliche Erarbeitung einer Fabel in der 6. Klasse mit anschließender szenischer Darstellung. Ziel ist es, die Schüler*innen aktiv mit dem Fabeltext auseinanderzusetzen und ihr Verständnis durch handlungs- und produktionsorientierte Verfahren zu vertiefen. Der Entwurf berücksichtigt die heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen und bietet Möglichkeiten zur Differenzierung.
- Analyse von Fabeln und deren Struktur
- Handlungs- und produktionsorientierte Methoden im Deutschunterricht
- Berücksichtigung heterogener Lernvoraussetzungen
- Differenzierung im Unterricht
- Szenische Darstellung als Methode der Textverarbeitung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Durchdringung und Analyse der Sache: Dieses Kapitel legt den Grundstein für den Unterricht, indem es die Fabel als literarische Gattung detailliert beschreibt. Es erläutert den typischen Aufbau einer Fabel – Ausgangssituation, Konflikt, überraschende Wende und Lehre – und analysiert am Beispiel von Äsops "Der Fuchs und der Ziegenbock" die einzelnen Elemente. Die Erläuterungen des typischen Aufbaus und die Analyse des Beispiels liefern einen soliden Rahmen für die anschließenden didaktischen Überlegungen und die praktische Umsetzung im Unterricht.
1.2 Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren: Dieser Abschnitt betont die Bedeutung handlungs- und produktionsorientierter Methoden im Literaturunterricht. Im Gegensatz zu rein rezeptiven Ansätzen rückt er das aktive Handeln und die kreative Auseinandersetzung der Schüler*innen in den Mittelpunkt. Der Fokus liegt auf Anschlussaktionen wie Umschreiben, szenischer Umsetzung und dem Führen von Lesetagebüchern. Die Vorteile dieser Methoden werden hervorgehoben: Stärkung der Leserrolle, Förderung der Textproduktion, Schaffung von Möglichkeiten zur Differenzierung und Steigerung der Lesemotivation. Die Erwähnung von Pädagogen wie Haas, Menzel, Waldmann und Spinner verortet den Ansatz in einem etablierten didaktischen Diskurs.
2. Rahmenbedingungen und heterogene Lernvoraussetzungen: Dieser Teil beschreibt die institutionellen Rahmenbedingungen und die spezifischen Lernvoraussetzungen der Klasse 6b. Die Beschreibung der Schule, inklusive ihres Leitbildes und ihrer räumlichen Gegebenheiten, bietet Kontext. Die detaillierte Charakterisierung der Klassensituation, inklusive der individuellen Stärken und Schwächen einzelner Schüler*innen, ermöglicht eine differenzierte Unterrichtsplanung. Das Kapitel betont die positive Klassengemeinschaft und die unterschiedlichen Lernbedürfnisse, die der Unterricht berücksichtigen soll. Die Erwähnung des Belohnungssystems gibt Einblick in die bestehende Unterrichtspraxis.
Schlüsselwörter
Fabeln, handlungsorientierter Unterricht, produktionsorientierter Unterricht, heterogene Lernvoraussetzungen, Differenzierung, szenische Darstellung, Klassenzusammensetzung, Didaktische Analyse, Äsop.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf: Ganzheitliche Erarbeitung einer Fabel in der 6. Klasse
Was ist das zentrale Thema dieses Unterrichtsentwurfs?
Der Unterrichtsentwurf beschreibt die ganzheitliche Erarbeitung einer Fabel in der 6. Klasse mit anschließender szenischer Darstellung. Das Ziel ist die aktive Auseinandersetzung der Schüler*innen mit dem Fabeltext und die Vertiefung ihres Verständnisses durch handlungs- und produktionsorientierte Verfahren unter Berücksichtigung heterogener Lernvoraussetzungen.
Welche Kapitel umfasst der Entwurf?
Der Entwurf gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Durchdringung und Analyse der Sache (inkl. 1.1 Fabeln und 1.2 Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren), 2. Rahmenbedingungen und heterogene Lernvoraussetzungen (inkl. 2.1 Darstellung der Schule, 2.2 Klassensituation und 2.3 Analyse der Lernvoraussetzungen), 3. Didaktische Analyse (inkl. 3.1 Bildungswert des Unterrichtsgegenstandes und 3.2 Bezug zum Bildungsplan), 4. Aufgabenstellung und Differenzierung (inkl. 4.1 Aufgabenanalyse und 4.2 Formen der Differenzierung), 5. Methodische Entscheidung und unterrichtspraktische Umsetzung, 6. Strukturskizze/Verlaufsplanung, 7. Literaturverzeichnis und 8. Anhang.
Welche Methoden werden im Unterricht eingesetzt?
Der Entwurf setzt auf handlungs- und produktionsorientierte Methoden, wie z.B. Umschreiben der Fabel, szenische Umsetzung und das Führen von Lesetagebüchern. Diese sollen die aktive Auseinandersetzung der Schüler*innen fördern und die Lesemotivation steigern.
Wie wird mit heterogenen Lernvoraussetzungen umgegangen?
Der Entwurf berücksichtigt explizit die heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen und bietet Möglichkeiten zur Differenzierung im Unterricht. Die detaillierte Charakterisierung der Klassensituation und der individuellen Stärken und Schwächen einzelner Schüler*innen ermöglicht eine differenzierte Unterrichtsplanung.
Welche Ziele werden mit dem Unterricht verfolgt?
Die Ziele umfassen die Analyse von Fabeln und deren Struktur, den Einsatz handlungs- und produktionsorientierter Methoden, die Berücksichtigung heterogener Lernvoraussetzungen, die Differenzierung im Unterricht und die szenische Darstellung als Methode der Textverarbeitung.
Welche Fabel wird im Unterricht behandelt?
Als Beispiel wird Äsops Fabel "Der Fuchs und der Ziegenbock" analysiert, um den typischen Aufbau einer Fabel zu veranschaulichen (Ausgangssituation, Konflikt, überraschende Wende und Lehre).
Welche didaktischen Ansätze werden im Entwurf verwendet?
Der Entwurf bezieht sich auf etablierte didaktische Ansätze und erwähnt Pädagogen wie Haas, Menzel, Waldmann und Spinner im Kontext handlungs- und produktionsorientierter Methoden im Literaturunterricht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Unterrichtsentwurf?
Schlüsselwörter sind: Fabeln, handlungsorientierter Unterricht, produktionsorientierter Unterricht, heterogene Lernvoraussetzungen, Differenzierung, szenische Darstellung, Klassenzusammensetzung, Didaktische Analyse, Äsop.
- Quote paper
- Ramona Frommknecht (Author), 2019, Erarbeitung einer Fabel mit szenischer Darstellung in einer 6. Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/506071