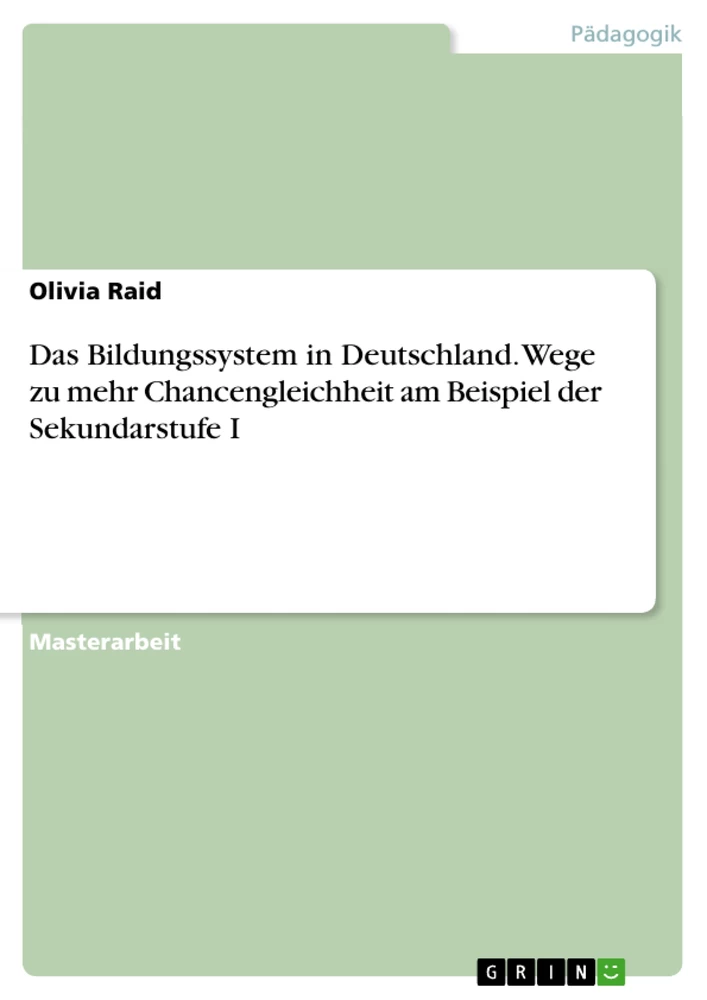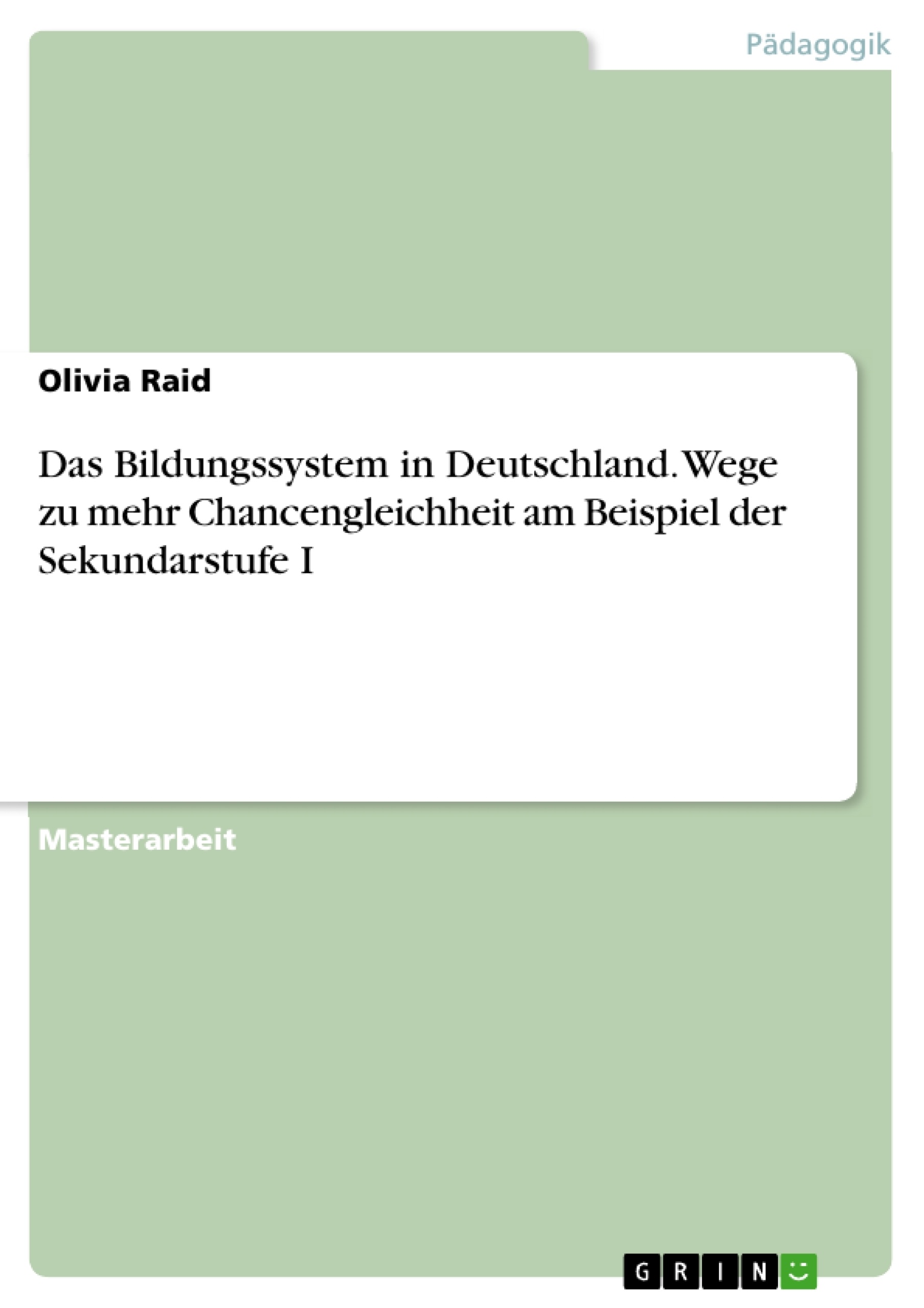Der vergleichsweise große Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg im deutschen Bildungssystem steht im Zentrum dieser Arbeit. Es soll herausgearbeitet werden, welche Ursachen für diesen Zusammenhang bestehen. Forschungsfrage I geht damit der Frage nach, wie herkunftsbedingt ungleiche Bildungschancen in Deutschland entstehen, besonders im Hinblick auf in der formalen Organisationsstruktur begründete Ursachenmechanismen.
Unter dem Begriff „herkunftsbedingt“ ist in dieser Arbeit die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler gemeint. Unter methodischen Gesichtspunkten soll darauf hingewiesen werden, dass mit dem hier verwendeten Herkunftsbegriff nur eine grobe Kategorisierung erfolgen soll. Konzentriert wird sich in dieser Arbeit auf Schülerinnen und Schüler aus „unteren“, „bildungsfernen“ Schichten als denjenigen, die im deutschen Bildungssystem besonders benachteiligt sind. Es spielt hierbei keine Rolle, ob diese Benachteiligung auf ein geringeres Einkommen oder einen insgesamt niedrigen Sozialstatus zurückzuführen ist.
Die aktuellen PISA-Studien belegen außerdem, dass Schülerinnen und Schüler bestimmter anderer europäischer Länder besonders gute Leistungen erbringen – ohne dass die erbrachte Leistung dabei so stark von der sozialen Herkunft abhängt, wie es in Deutschland der Fall ist. So attestiert die PISA-Studie 2015 Estland etwa, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg hier im internationalen Vergleich sehr klein ist und dass die estnischen Schülerinnen und Schüler überdurchschnittlich leistungsstark sind.
Dieser Umstand weckt das Interesse zu erforschen, welche institutionellen Strukturen im Bildungssystem dazu beitragen, dass die soziale Herkunft in Estland weniger über den Bildungserfolg entscheidet als dies in Deutschland der Fall ist. Die Forschungsfrage II geht daher folgender Frage nach:
Warum haben Schülerinnen und Schüler aus unteren Sozialschichten in Estland deutlich bessere Bildungschancen?
Anhand dieser gewonnenen Erkenntnisse aus Forschungsfrage I und II werden Verbesserungsvorschläge für das deutsche Bildungssystem erarbeitet. Forschungasfrage III lautet daher wie folgt:
Welche konkreten Verbesserungsvorschläge ergeben sich aus dem empirisch-theoretischen Wissen um die Wirkungsweise herkunftsbedingter Selektionsprozesse sowie dem Vergleich mit dem Schulsystem Estlands für den Abbau herkunftsbedingter Benachteiligung im Bildungssystem in Deutschland?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserklärung
- 2.1 Bildung - ein Definitionsversuch
- 2.1.1 Geschichte des Begriffs der Bildung
- 2.1.2 Die Bedeutung des Begriffs Bildung von Heute
- 2.1.3 Bildung – eine Zusammenfassung
- 2.2 Chancengleichheit
- 2.2.1 Chancengleichheit im Bildungswesen - ein Definitionsversuch
- 2.2.2 Theorien der Chancenungleichheit im Bildungswesen
- 2.2.2.1 Makrosoziologische Theorien der Chancenungleichheit
- 2.2.2.2 Mikrosoziologische Theorien der Chancenungleichheit
- 2.2.3 Chancengleichheit – eine Zusammenfassung
- 2.1 Bildung - ein Definitionsversuch
- 3 Belege für Chancenungleichheit in Deutschland
- 3.1 Konzepte und Methoden empirischer Forschung zur Bildungsungleichheit
- 3.1.1 Statistische Zusammenhänge und ihre Interpretation
- 3.1.2 Operationalisierung der Variablen „Bildungserfolg“ und „Soziale Herkunft“
- 3.1.3 Operationalisierung des Begriffs „Bildungserfolg“
- 3.1.4 Operationalisierung des Begriffs „Soziale Herkunft“
- 3.2 PISA-Studie
- 3.2.1 PISA-Studie 2015
- 3.2.1.1 Zusammenhang zwischen naturwissenschaftlichen Kompetenzen und ökonomischem Status im internationalen Vergleich
- 3.2.1.2 Verteilung von kompetenzförderlichen Merkmalen auf die EGP-Klassen
- 3.2.1.3 Leistungen der Schülerinnen und Schüler nach EGP-Klassen
- 3.2.1.4 Bildungsbeteiligung am Gymnasium nach EGP-Klassen
- 3.2.1.5 PISA 2015 und Chancengleichheit – eine Zusammenfassung
- 3.2.1 PISA-Studie 2015
- 3.3 IGLU-Studie
- 3.3.1 IGLU-Studie 2016
- 3.3.1.1 Einfluss der sozialen Herkunft auf die Testleistungen
- 3.3.1.2 Einfluss der sozialen Herkunft auf die Schullaufbahnpräferenz von Eltern und Lehrkräften
- 3.3.1.3 Einfluss der sozialen Herkunft auf Gymnasialpräferenzen von Eltern und Lehrkräften
- 3.3.2 IGLU 2016 und Chancengleichheit – eine Zusammenfassung
- 3.3.1 IGLU-Studie 2016
- 3.4 Bedeutung der PISA- und IGLU- Ergebnisse für diese Arbeit
- 3.1 Konzepte und Methoden empirischer Forschung zur Bildungsungleichheit
- 4 Das deutsche Bildungssystem
- 4.1 Geschichtliche Entwicklung des deutschen Bildungssystems
- 4.1.1 Die Jahre 1812 - 1945
- 4.1.2 1945 - 1960
- 4.1.3 Seit 1950: Die Bildungsexpansion
- 4.1.4 1960er Jahre
- 4.1.5 70er Jahre
- 4.1.6 2000 - Der PISA-Schock
- 4.1.7 2006: Kritik der UN
- 4.1.8 Die geschichtliche Entwicklung des deutschen Bildungssystems – eine Zusammenfassung
- 4.2 Struktur und Aufbau des deutschen Bildungssystems von Heute
- 4.2.1 Elementarbereich
- 4.2.2 Primarbereich
- 4.2.3 Sekundarstufe I
- 4.1 Geschichtliche Entwicklung des deutschen Bildungssystems
- 5 Im Vergleich dazu: Das estnische Bildungssystem
- 5.1 Geschichtliche Entwicklung des estnischen Bildungssystems
- 5.2 Struktur und Aufbau des estnischen Bildungswesens
- 5.2.1 Elementarbereich
- 5.2.2 Grund- und Hauptschulbildung
- 5.3 Das estnische Bildungssystem – eine Zusammenfassung
- 6 Ursachen für den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland
- 6.1 Familiäre Ursachen der herkunftsbedingten Benachteiligung
- 6.1.1 Herkunftsbedingte Sozialisation
- 6.1.2 Bildungsaspiration der Eltern
- 6.1.3 Familiäre Ursachen der herkunftsbedingten Chancenungleichheit – eine Zusammenfassung
- 6.2 Institutionelle Ursachen der herkunftsbedingten Benachteiligung
- 6.2.1 Soziale Selektion durch Schwellen im Bildungssystem
- 6.2.2 Frühes Ende der Grundschule
- 6.2.3 Herkunftsbedingte Grundschulempfehlung
- 6.2.4 Unterschiedliche Leistungs- und Entwicklungsmilieus der Schulformen
- 6.2.5 Geringe Durchlässigkeit des Schulsystems
- 6.3 Konklusion und Beantwortung der Forschungsfrage I und II
- 6.1 Familiäre Ursachen der herkunftsbedingten Benachteiligung
- 7 Wege zu mehr Chancengleichheit: Empfehlungen zum Abbau herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung
- 7.1 Lösungsansatz I: Mehr Chancengleichheit durch verpflichtende Vorschule
- 7.2 Lösungsansatz II: Mehr Chancengleichheit durch Abschaffung der Mehrgliedrigkeit
- 7.3 Lösungsansatz III: Mehr Chancengleichheit durch mehr Ganztagsschulen
- 8 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen für Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem, insbesondere in der Sekundarstufe I. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg und vergleicht das deutsche System mit dem estnischen, um mögliche Lösungsansätze für mehr Chancengleichheit zu entwickeln.
- Analyse des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland.
- Untersuchung der familiären und institutionellen Ursachen für Chancenungleichheit.
- Vergleich des deutschen und estnischen Bildungssystems hinsichtlich Chancengleichheit.
- Entwicklung von konkreten Verbesserungsvorschlägen für das deutsche Bildungssystem.
- Bewertung der Umsetzbarkeit der Lösungsansätze im Kontext der deutschen Bildungspolitik.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht den starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland, basierend auf den Ergebnissen der PISA-Studien. Sie formuliert drei Forschungsfragen: Erstens, wie herkunftsbedingte Chancenungleichheit entsteht; zweitens, warum estnische Schüler aus unteren Sozialschichten bessere Chancen haben; und drittens, welche Verbesserungsvorschläge sich daraus für Deutschland ergeben.
2 Begriffserklärung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe "Bildung" und "Chancengleichheit". Es beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Bildung" und sein heutiges Verständnis als Weg zur Selbstbestimmung und Teilhabe. Chancengleichheit wird als "Chancengleichheit durch Bildung zur Bildung" definiert, wobei sowohl formale als auch faire Chancengleichheit berücksichtigt werden. Makro- und mikrosoziologische Theorien zur Erklärung von Chancenungleichheit werden vorgestellt.
3 Belege für Chancenungleichheit in Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert empirische Belege aus PISA und IGLU-Studien, die einen starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland aufzeigen. Die Studien belegen, dass der soziale Gradient und die Varianzaufklärung in Deutschland deutlich über dem OECD-Durchschnitt liegen, im Gegensatz zu Ländern wie Estland.
4 Das deutsche Bildungssystem: Dieses Kapitel skizziert die historische Entwicklung des deutschen Bildungssystems, von der ständischen Ordnung bis zur Bildungsexpansion und den Reaktionen auf den PISA-Schock und die Kritik der UN. Es beschreibt die heutige Struktur des mehrgliedrigen Schulsystems mit seinen Übergängen und Entscheidungspunkten.
5 Im Vergleich dazu: Das estnische Bildungssystem: Dieser Abschnitt stellt das estnische Bildungssystem vor und vergleicht es mit dem deutschen System. Im Fokus steht der deutlich geringere Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Estland. Das estnische System zeichnet sich durch ein Einheitsschulsystem und eine verpflichtende Vorschule aus.
6 Ursachen für den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die familiären und institutionellen Ursachen für Chancenungleichheit in Deutschland. Familiäre Faktoren wie Sozialisation und Bildungsaspiration der Eltern werden ebenso untersucht wie institutionelle Faktoren wie die frühe Selektion im mehrgliedrigen Schulsystem, die Grundschulempfehlung und die geringe Durchlässigkeit.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungsungleichheit, Bildungssystem Deutschland, Bildungssystem Estland, Soziale Herkunft, Bildungserfolg, PISA-Studie, IGLU-Studie, Sekundarstufe I, Mehrgliedrigkeit, Einheitsschule, Ganztagsschule, Vorschule, soziale Selektion, Herkunftseffekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem: Ein Vergleich mit Estland"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen für Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem, insbesondere in der Sekundarstufe I. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg und vergleicht das deutsche System mit dem estnischen, um mögliche Lösungsansätze für mehr Chancengleichheit zu entwickeln.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit formuliert drei zentrale Forschungsfragen: Erstens, wie herkunftsbedingte Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem entsteht; zweitens, warum estnische Schüler aus unteren Sozialschichten bessere Chancen haben als ihre deutschen Altersgenossen; und drittens, welche Verbesserungsvorschläge sich daraus für das deutsche Bildungssystem ergeben.
Wie werden die Begriffe "Bildung" und "Chancengleichheit" definiert?
Der Begriff "Bildung" wird historisch beleuchtet und als Weg zur Selbstbestimmung und Teilhabe verstanden. Chancengleichheit wird als "Chancengleichheit durch Bildung zur Bildung" definiert, wobei sowohl formale als auch faire Chancengleichheit berücksichtigt werden. Makro- und mikrosoziologische Theorien zur Erklärung von Chancenungleichheit werden vorgestellt.
Welche empirischen Daten werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf empirische Daten aus den PISA- und IGLU-Studien, die einen starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland aufzeigen. Die Studien belegen, dass der soziale Gradient und die Varianzaufklärung in Deutschland deutlich über dem OECD-Durchschnitt liegen, im Gegensatz zu Ländern wie Estland.
Wie wird das deutsche Bildungssystem beschrieben?
Die Arbeit skizziert die historische Entwicklung des deutschen Bildungssystems von der ständischen Ordnung bis zur Bildungsexpansion und den Reaktionen auf den PISA-Schock und die Kritik der UN. Sie beschreibt die heutige Struktur des mehrgliedrigen Schulsystems mit seinen Übergängen und Entscheidungspunkten.
Wie wird das estnische Bildungssystem im Vergleich dargestellt?
Das estnische Bildungssystem wird vorgestellt und mit dem deutschen System verglichen. Im Fokus steht der deutlich geringere Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Estland. Das estnische System zeichnet sich durch ein Einheitsschulsystem und eine verpflichtende Vorschule aus.
Welche Ursachen für Chancenungleichheit werden analysiert?
Die Arbeit analysiert familiäre Ursachen wie Sozialisation und Bildungsaspiration der Eltern sowie institutionelle Faktoren wie die frühe Selektion im mehrgliedrigen Schulsystem, die Grundschulempfehlung und die geringe Durchlässigkeit des deutschen Systems.
Welche Lösungsansätze zur Verbesserung der Chancengleichheit werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt verschiedene Lösungsansätze vor, darunter die Einführung einer verpflichtenden Vorschule, die Abschaffung der Mehrgliedrigkeit des Schulsystems und die Ausweitung von Ganztagsschulen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Chancengleichheit, Bildungsungleichheit, Bildungssystem Deutschland, Bildungssystem Estland, Soziale Herkunft, Bildungserfolg, PISA-Studie, IGLU-Studie, Sekundarstufe I, Mehrgliedrigkeit, Einheitsschule, Ganztagsschule, Vorschule, soziale Selektion, Herkunftseffekte.
- Quote paper
- Olivia Raid (Author), 2019, Das Bildungssystem in Deutschland. Wege zu mehr Chancengleichheit am Beispiel der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505712