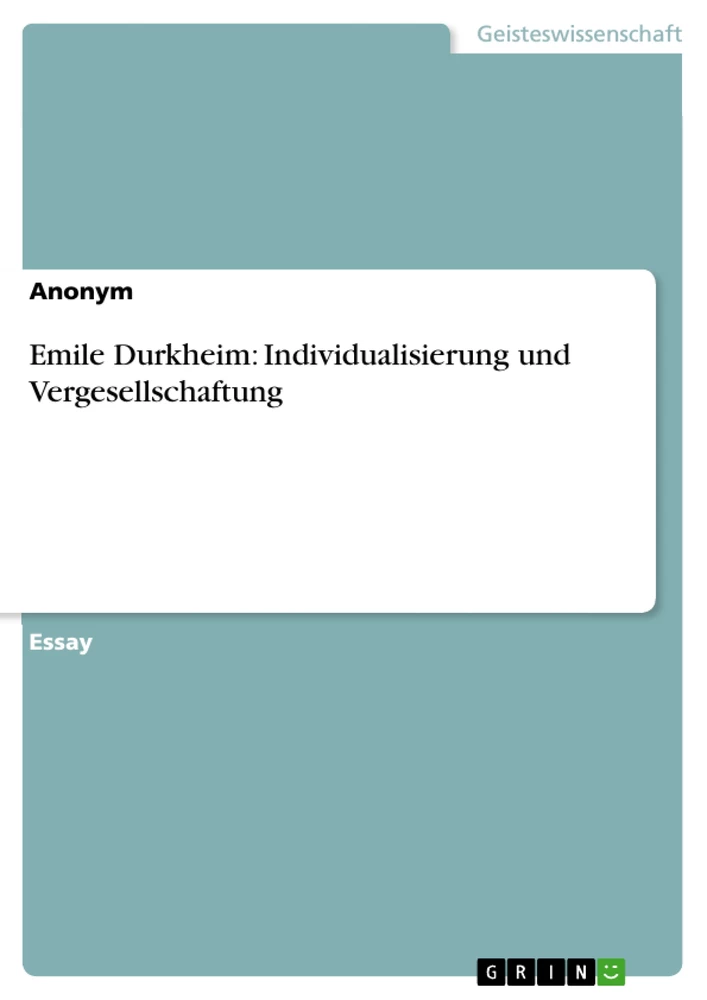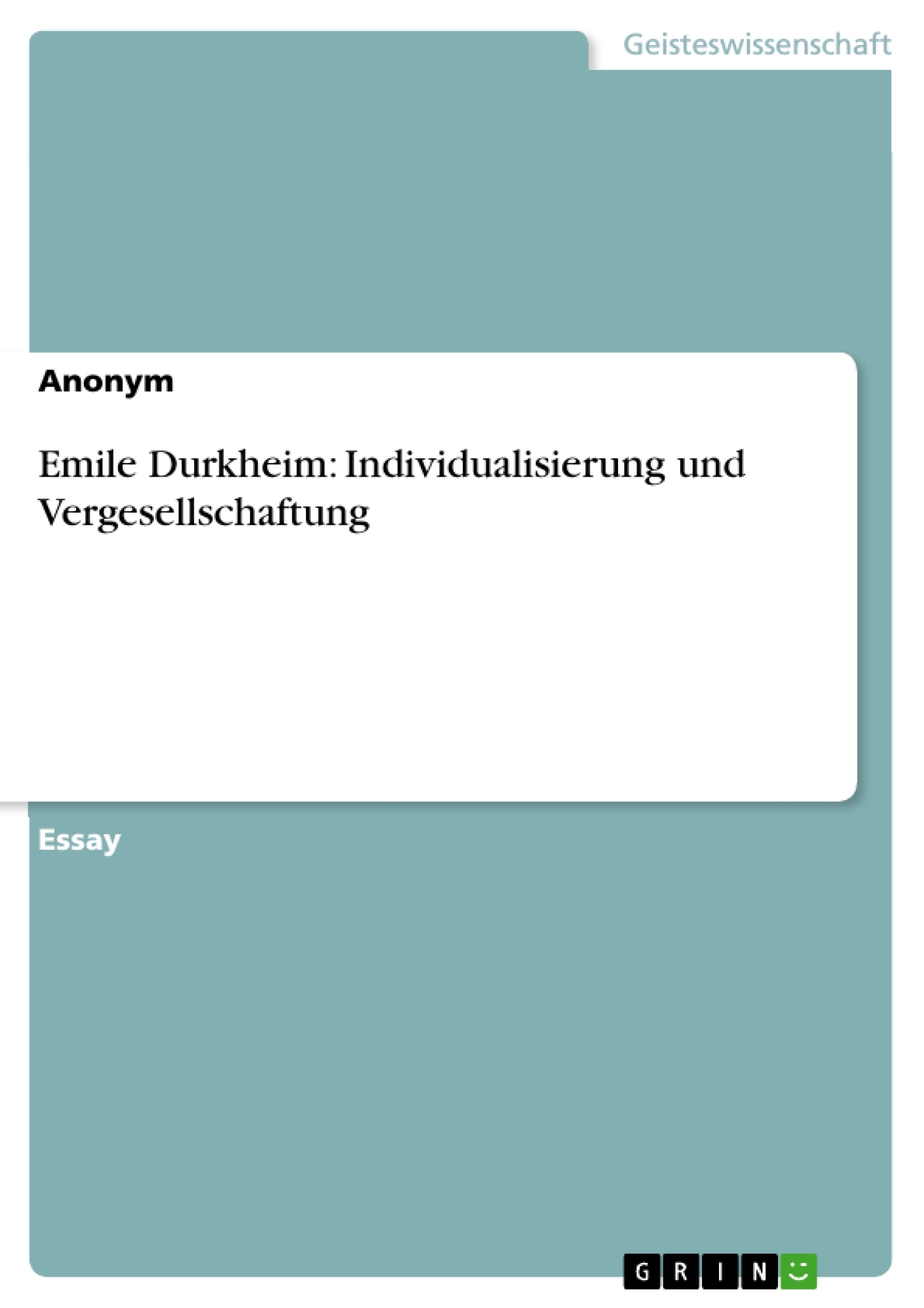Im Bereich der Arbeit unterscheidet Durkheim drei Bereiche die noch von anomischer Arbeitsteilung „befallen“ sind. Diese Bereiche sind industrielle/kommerzielle Organisation, die sich in Krisen ausdrückt, die Feindschaft zwischen Arbeit und Kapital, die sich in Revolten der Arbeiter gegen die Meister zeigt, sowie die Spezialisierung der Wissenschaften, bei der die Wissenschaftler sich auf ein Spezialgebiet beschränken, dieses für das wichtigste halten und den Gesamtzusammenhang aus den Augen verlieren. Für heutige Sichtweise sind diese „Pathologien“ nur Anzeichen für die Freiheit der Arbeiter bzw. Wissenschaftler, für Durkheim sind es ungeregelte Gebiete die keine Solidarität und Abhängigkeit erzeugen und somit Integrationshemmend und schädlich für die Menschheit sind. Da Durkheim die Vernetzung der einzelnen differenzierten Funktionen feststellt (eine Art Kettenreaktion, denn Geschehnisse in einem Bereich wirken sich auf einen anderen aus) sieht er auch die Notwendigkeit von Regeln zwischen diesen, um einen geregelten Ablauf von Interaktionen zu ermöglichen. Diese Regeln sollen von einer unabhängigen Instanz gesetzt werden. Für das menschliche Verhalten ist diese die Regierung, für die Wissenschaft die Philosophie. Die Regeln sollen den Zusammenhang der Funktionen herstellen, wobei sie die wesentlichen und die am öftesten vorkommenden Berührungspunkte festlegen, damit grundsätzliche Sachen nicht immer wieder neu verhandelt werden müssen. Der übrige Spielraum bleibt den Individuen frei zur Ausgestaltung und sie sind nur angewiesen, nicht den Gesamtzusammenhang aus den Augen zu verlieren.
Inhaltsverzeichnis
- Emile Durkheim: Individualisierung und Vergesellschaftung
- Die Terminologie „Freiheit des Individuums“ und „Gesellschaftliche Zwänge“
- Durkheims Kollektivistische Theorie der Gesellschaft
- Arbeitsteilung und soziale Integration
- Die Moral und ihre Regelwerke
- Die Rolle des Berufs in der Gesellschaft
- Anomische Arbeitsteilung
- Die Notwendigkeit von Regeln in der Arbeitswelt
- Die Gesellschaft und der Selbstmord
- Die Abhängigkeit des Individuums von der Gesellschaft
- Die Vorteile der gesellschaftlichen Abhängigkeit
- Die Grenzen der Individualität
- Das Kollektivgefühl und das „Doppelleben der Individuen“
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Theorie Emile Durkheims hinsichtlich der Frage nach der Freiheit und Autonomie des Individuums in der modernen Gesellschaft. Durkheims kollektivistische Sichtweise auf die Gesellschaft wird beleuchtet, wobei die Rolle von Werten, Arbeitsteilung und Moral im Zentrum der Betrachtung stehen.
- Die Rolle der Gesellschaft in der Gestaltung der individuellen Freiheit
- Das Verhältnis von Individualität und gesellschaftlichen Zwängen
- Die Bedeutung von Werten und Moral für die Integration in die Gesellschaft
- Der Einfluss der Arbeitsteilung auf das Individuum und die soziale Solidarität
- Die Relevanz von Regeln und Normen für ein geordnetes Zusammenleben
Zusammenfassung der Kapitel
- Emile Durkheim: Individualisierung und Vergesellschaftung: Dieser Abschnitt stellt die zentrale Fragestellung des Essays vor: Wie frei und autonom ist das Individuum in der modernen Gesellschaft? Die Arbeit untersucht Durkheims Theorien zum Verhältnis von Individualität und gesellschaftlichen Zwängen.
- Die Terminologie „Freiheit des Individuums“ und „Gesellschaftliche Zwänge“: Hier wird Durkheims Verständnis von Freiheit und Zwang in den Kontext seiner Zeit und der heutigen Auffassung gesetzt. Durkheim argumentiert, dass die Abhängigkeit von der Gesellschaft essenziell für das menschliche Leben ist.
- Durkheims Kollektivistische Theorie der Gesellschaft: Dieser Abschnitt beschreibt Durkheims Theorie, die davon ausgeht, dass auch moderne Gesellschaften ein gemeinsames Wertesystem haben. Dieses basiert auf moralischem Individualismus und einem kollektiv geschaffenen Wertesystem, das durch gemeinsame Werte wie Menschenrechte, Weltfrieden und Demokratie geprägt ist.
- Arbeitsteilung und soziale Integration: Der Essay beleuchtet Durkheims Sichtweise auf die Arbeitsteilung, die er als Integrationsfördernd betrachtet. Durch die soziale Differenzierung entstehen Interdependenzen und somit Solidarität und moralische Ordnung.
- Die Moral und ihre Regelwerke: Dieser Abschnitt erläutert Durkheims Konzept der universellen Moral, die zwei Pole umfasst: Rechte und Pflichten gegenüber sich selbst und gegenüber der Menschheit. Zwischen diesen Polen stehen die partikularen Moralsysteme für verschiedene soziale Gruppen.
- Die Rolle des Berufs in der Gesellschaft: Durkheim argumentiert, dass der Beruf die wichtigste Instanz für Integration und Solidarität in der Gesellschaft ist. Die Arbeit fördere sowohl die Individualität als auch die gesellschaftliche Integration.
- Anomische Arbeitsteilung: Durkheim identifiziert drei Bereiche, die von anomischer Arbeitsteilung „befallen\" sind: industrielle/kommerzielle Organisation, die Feindschaft zwischen Arbeit und Kapital sowie die Spezialisierung der Wissenschaften.
- Die Notwendigkeit von Regeln in der Arbeitswelt: Durkheim betont die Notwendigkeit von Regeln, die den geregelten Ablauf von Interaktionen zwischen verschiedenen Funktionen gewährleisten sollen. Diese Regeln sollten von einer unabhängigen Instanz wie der Regierung oder der Philosophie gesetzt werden.
- Die Gesellschaft und der Selbstmord: Durkheim untersucht den Einfluss der Gesellschaft auf den Selbstmord und kommt zu der Erkenntnis, dass die Verbundenheit mit der Gesellschaft die Voraussetzung für das menschliche Leben ist.
- Die Abhängigkeit des Individuums von der Gesellschaft: Dieser Abschnitt beleuchtet Durkheims Argumentation, dass die Individuen von der Gesellschaft abhängig sind und nicht in der Lage sind, selbst Einfluss auf ihre eigene Verfassung auszuüben.
- Die Vorteile der gesellschaftlichen Abhängigkeit: Durkheim argumentiert, dass die Vorteile der gesellschaftlichen Abhängigkeit, wie z.B. die Befriedigung von Bedürfnissen, die Nachteile für die Individuen überwiegen.
- Die Grenzen der Individualität: Der Essay erklärt, dass die Gesellschaft Rahmenvorgaben für die Lebensumstände der Individuen setzt und diese somit nur innerhalb dieser Grenzen frei sind.
- Das Kollektivgefühl und das „Doppelleben der Individuen“: Durkheim stellt das Kollektivgefühl als ein Ergebnis der moralischen und sozialen Schranken der Handlungsfreiheit dar. Dieses Gefühl kontrolliert das bewusste Handeln des Einzelnen.
Schlüsselwörter
Dieser Essay behandelt zentrale Themen wie Individualismus, Vergesellschaftung, gesellschaftliche Zwänge, Arbeitsteilung, Moral, Solidarität, Integration, Anomie und Selbstmord. Durkheims kollektivistische Theorie der Gesellschaft und seine Kritik an übermäßigem Individualismus bilden den thematischen Kern der Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Emile Durkheim das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft?
Durkheim vertritt eine kollektivistische Theorie, nach der das Individuum essenziell von der Gesellschaft abhängig ist. Freiheit existiert für ihn nur innerhalb der von der Gesellschaft gesetzten moralischen und sozialen Schranken.
Was versteht Durkheim unter „anomischer Arbeitsteilung“?
Anomie beschreibt einen Zustand der Regellosigkeit. In der Arbeitsteilung tritt sie auf, wenn soziale Funktionen nicht ausreichend koordiniert sind, was zu Krisen zwischen Kapital und Arbeit oder zur Isolation in den Wissenschaften führt.
Welche Rolle spielt der Beruf laut Durkheim für die soziale Integration?
Der Beruf ist für Durkheim die wichtigste Instanz für Solidarität in der modernen Gesellschaft. Er schafft Abhängigkeiten (Interdependenzen), die den Einzelnen in ein moralisches Gesamtsystem eingliedern.
Warum sind Regeln in der Arbeitswelt für Durkheim so wichtig?
Regeln verhindern anomische Zustände und ermöglichen einen geregelten Ablauf von Interaktionen. Ohne diese Regeln entstünde keine Solidarität, was für die gesellschaftliche Integration schädlich wäre.
Was ist das „Doppelleben der Individuen“ bei Durkheim?
Es beschreibt die Spannung zwischen persönlichen Antrieben und dem Kollektivgefühl. Das Kollektivgefühl wirkt als innere moralische Schranke, die das bewusste Handeln des Einzelnen im Sinne der Gemeinschaft kontrolliert.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2005, Emile Durkheim: Individualisierung und Vergesellschaftung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50511