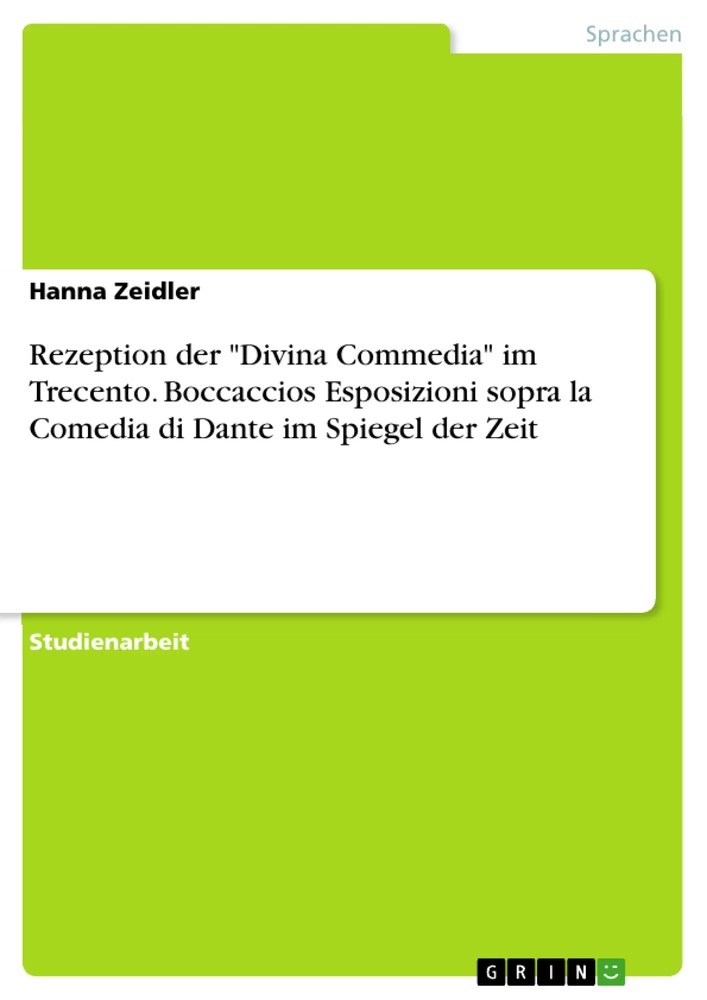Dante Alighieris poetische Jenseitsreise durch das Inferno (Hölle), Purgatorio (Läuterungsberg) und das Paradiso (Paradies), ist als eines der bedeutendsten Werke des Mittelalters in die Weltliteratur eingegangen. Entstanden ist die Divina Commedia wahrscheinlich zwischen 1304 und 1321. Bereits kurz nach Dantes Tod, am 13-14 September 1321 , beginnt die Dante- Rezeption und setzte sich bis heute fort. Sie lässt sich dabei in drei große kulturelle Phasen einteilen: von der Scholastik bis zum Humanismus, von der Renaissance bis zur Aufklärung und von der Romantik bis zum Strukturalismus. Im Rahmen dieser Arbeit soll die Rezeption der Commedia im Trecento näher betrachtet werden. Besonderes Augenmerk wurde auf Giovanni Bocaccio (1313-1375) gelegt, der unter anderem für seine Novellensammlung Decameron Berühmtheit erlangt hat. Uns sind seine Esposizioni sopra la Comedia di Dante (1373-1374), die auch als Cometo bezeichnet werden, überliefert. Diese sollen in dieser Arbeit näher beleuchtet werden und in den zeitgeschichtlichen Kontext gestellt werden. Es lassen sich zahlreiche Gründe für die Relevanz dieser thematischen Wahl finden: zum ersten gilt das Trecento aus literaturwissenschaftlicher Sicht als ein goldenes Jahrhundert, in dem Autoren die Dante zeitnah waren, den unumstrittenen Vorteil gegenüber den modernen Autoren haben, die Sprache auch als kulturelle Konnotationen unmittelbar entschlüsseln zu können . Boccaccio erkennt den unschätzbaren Wert der Commedia und Dantes, dem es nämlich gelingt ein episches Lehrgedicht in der Sprache des Volkes und nicht auf Latein, der Sprache der Intellektuellen, zu verfassen. Die aus heutiger Sicht nur noch schwer entschlüsselbare Enzyklopädie des Mittelalters, vereint kosmologisches, theologisches, mythologisches, politisches, zeitgenössisches und biblisches Wissen in einem kohärenten Wissenssystem. De Sanctis (1855) schreibt dazu: „La Divina Commedia è la più vasta unità che la mente umana abbia concetta, universo poetico con leggi e ordini a suoi proprii“ . Das Volgare wird kunstvoll verwendet, gleichwohl erst etwa ein Jahrhundert zuvor zum ersten Mal auf Italienisch geschrieben worden war. Mit Boccaccio beginnt somit erstmals ein volkssprachliches Kommentarwesen .
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitende Gedanken
- 2. Dante-Rezeption im Trecento
- 2.1 Vorläufer Boccaccios
- 2.2 Boccaccios Lesungen
- 2.3 Esposizione litterale und allegorica
- 2.4 Grenzen der Auslegung
- 3. Boccaccio zwischen sprachlicher, theologischer und ideologischer Kritiken
- 3.1 Das sprachliche Spannungsfeld
- 3.2 Theologische Skepsis gegenüber der DC
- 3.3 Die humanistische Auslegung der DC
- 4. Ausblick zur Rezeptionsgeschichte bis heute
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Divina Commedia im Trecento, insbesondere Boccaccios Esposizioni sopra la Comedia di Dante. Ziel ist es aufzuzeigen, wie soziale, kulturelle und sprachliche Einflüsse Boccaccios Interpretation beeinflusst haben und wie die Ideale des Humanismus eine neue Auslegung des Werkes ermöglichten.
- Die Dante-Rezeption im 14. Jahrhundert
- Boccaccios Esposizioni und ihre Entstehungsbedingungen
- Die sprachlichen, theologischen und ideologischen Kontroversen um die Divina Commedia
- Der Einfluss des Humanismus auf die Interpretation der Divina Commedia
- Die Bedeutung von Boccaccios Werk für die Rezeptionsgeschichte der Divina Commedia
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Gedanken: Die Einleitung führt in die Thematik der Rezeption der Divina Commedia ein und hebt die Bedeutung des Werkes als eines der wichtigsten Werke des Mittelalters hervor. Sie betont den Beginn der Rezeption kurz nach Dantes Tod und die Einteilung der Rezeptionsgeschichte in drei Phasen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Rezeption im Trecento, insbesondere auf Giovanni Boccaccio und seine Esposizioni sopra la Comedia di Dante. Die Wahl des Themas wird begründet durch die Bedeutung des Trecento als "goldenes Jahrhundert" der Literatur und Boccaccios Anerkennung des unschätzbaren Wertes der Commedia, verfasst in der Volkssprache und nicht in Latein. Die Commedia wird als eine Enzyklopädie des Mittelalters beschrieben, die kosmologisches, theologisches, mythologisches, politisches, zeitgenössisches und biblisches Wissen vereint. Boccaccios Kommentarwerk wird als Beginn eines volkssprachlichen Kommentarwesens hervorgehoben.
2. Dante-Rezeption im Trecento: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Dante-Rezeption im Trecento vor Boccaccio, mit Kommentaren, die eine unvollständige oder vollständige Analyse der Commedia lieferten. Es werden wichtige Dante-Kommentatoren wie Iacopo Alighieri, Graziolo Bambaglioli und Jacopo della Lana erwähnt. Der Ottimo Commento und Guido da Pisa werden ebenfalls als bedeutende Beiträge zur frühen Dante-Exegese genannt. Das Kapitel betont die "vorbereitende, stimulierende Funktion" dieser frühen Kommentare für die spätere Dante-Philologie und legt den Grundstein für die Analyse von Boccaccios Werk im Kontext dieser vorangegangenen Interpretationsversuche.
3. Boccaccio zwischen sprachlicher, theologischer und ideologischer Kritiken: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen und Spannungen, denen Boccaccio bei seiner Interpretation der Divina Commedia begegnete. Es analysiert das Spannungsfeld zwischen der Verwendung des Volgare und den Erwartungen der Gelehrten, die das Latein bevorzugten. Weiterhin befasst es sich mit der anhaltenden theologischen Kritik an Dantes Werk und den Auswirkungen dieser Kritik auf Boccaccios Rezeption. Schließlich wird die Veränderung in der Auslegung der Divina Commedia durch Boccaccio unter dem Einfluss des humanistischen Denkens dargestellt. Das Kapitel zeigt auf, wie Boccaccio zwischen verschiedenen gegensätzlichen Ansprüchen navigierte und wie seine Interpretation von diesen Einflüssen geprägt wurde.
Schlüsselwörter
Divina Commedia, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Trecento, Rezeption, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, Humanismus, Volgare, Theologische Kritik, Sprachliche Kritik, Literaturwissenschaft, Exegese, Kommentar, Italienische Literatur.
Häufig gestellte Fragen: Rezeption der Divina Commedia im Trecento – insbesondere Boccaccios Esposizioni
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Divina Commedia im 14. Jahrhundert (Trecento), mit besonderem Fokus auf Giovanni Boccaccios Kommentarwerk "Esposizioni sopra la Comedia di Dante". Sie analysiert, wie soziale, kulturelle und sprachliche Einflüsse Boccaccios Interpretation beeinflusst haben und wie der Humanismus eine neue Auslegung Dantes ermöglichte.
Welche Aspekte der Dante-Rezeption werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Dante-Rezeption im Trecento vor Boccaccio, einschließlich wichtiger Kommentatoren wie Iacopo Alighieri, Graziolo Bambaglioli und Jacopo della Lana, sowie den Ottimo Commento und Guido da Pisa. Sie analysiert Boccaccios "Esposizioni" im Kontext dieser früheren Interpretationsversuche und untersucht die sprachlichen, theologischen und ideologischen Kontroversen um die Divina Commedia. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss des Humanismus auf die Interpretation der Divina Commedia und der Bedeutung von Boccaccios Werk für die gesamte Rezeptionsgeschichte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem einzelnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitende Gedanken) bietet eine Einführung in die Thematik und die Bedeutung der Divina Commedia. Kapitel 2 (Dante-Rezeption im Trecento) gibt einen Überblick über die Dante-Rezeption vor Boccaccio. Kapitel 3 (Boccaccio zwischen sprachlicher, theologischer und ideologischer Kritiken) analysiert die Herausforderungen und Spannungen, denen Boccaccio bei seiner Interpretation begegnete. Kapitel 4 (Ausblick zur Rezeptionsgeschichte bis heute) bietet einen Ausblick (in der Originaldatei fehlt der Inhalt dieses Kapitels). Kapitel 5 (Resümee) fasst die Ergebnisse zusammen (in der Originaldatei fehlt der Inhalt dieses Kapitels).
Welche Bedeutung hat Boccaccios "Esposizioni" für die Dante-Rezeption?
Boccaccios "Esposizioni" wird als Beginn eines volkssprachlichen Kommentarwesens hervorgehoben und als ein Schlüsselwerk für das Verständnis der Rezeption der Divina Commedia im Trecento angesehen. Seine Interpretation wurde von sozialen, kulturellen und sprachlichen Einflüssen, sowie vom aufkommenden Humanismus geprägt.
Welche Rolle spielte der Humanismus bei der Interpretation der Divina Commedia?
Der Humanismus beeinflusste maßgeblich Boccaccios Interpretation der Divina Commedia. Die Arbeit zeigt auf, wie die humanistischen Ideale eine neue Auslegung des Werkes ermöglichten und wie Boccaccio zwischen verschiedenen gegensätzlichen Ansprüchen (z.B. die Verwendung des Volgare vs. Latein) navigierte.
Welche sprachlichen und theologischen Kontroversen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Spannungen zwischen der Verwendung des Volgare (der Volkssprache) und dem Latein, das von Gelehrten bevorzugt wurde. Weiterhin werden die anhaltenden theologischen Kritiken an Dantes Werk und deren Auswirkungen auf Boccaccios Rezeption analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Divina Commedia, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Trecento, Rezeption, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, Humanismus, Volgare, Theologische Kritik, Sprachliche Kritik, Literaturwissenschaft, Exegese, Kommentar, Italienische Literatur.
- Quote paper
- Hanna Zeidler (Author), 2013, Rezeption der "Divina Commedia" im Trecento. Boccaccios Esposizioni sopra la Comedia di Dante im Spiegel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504590