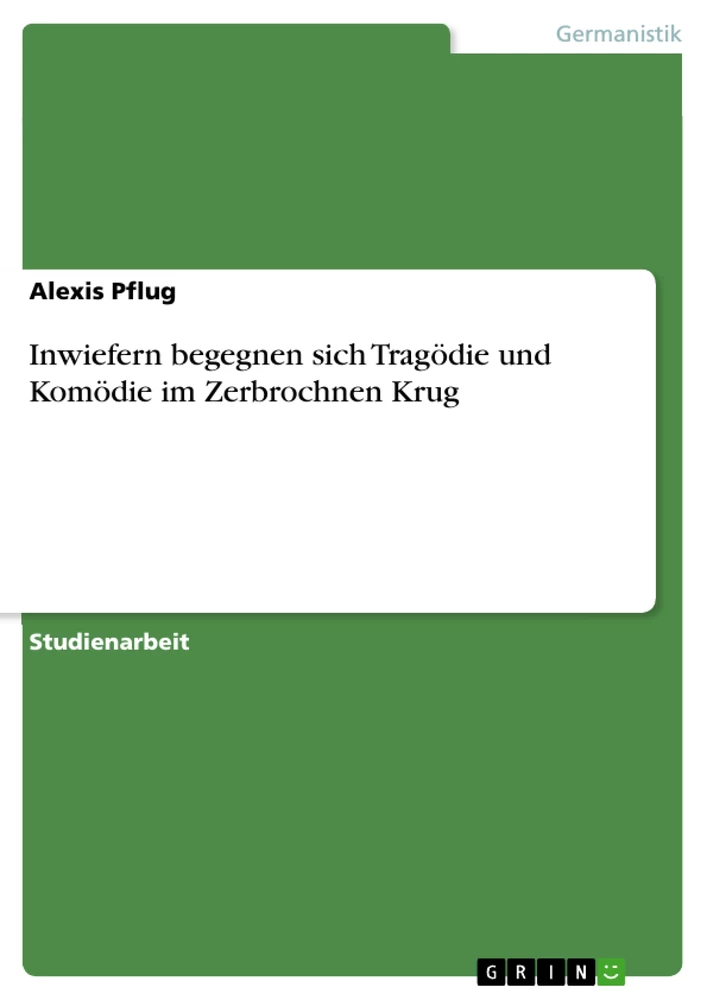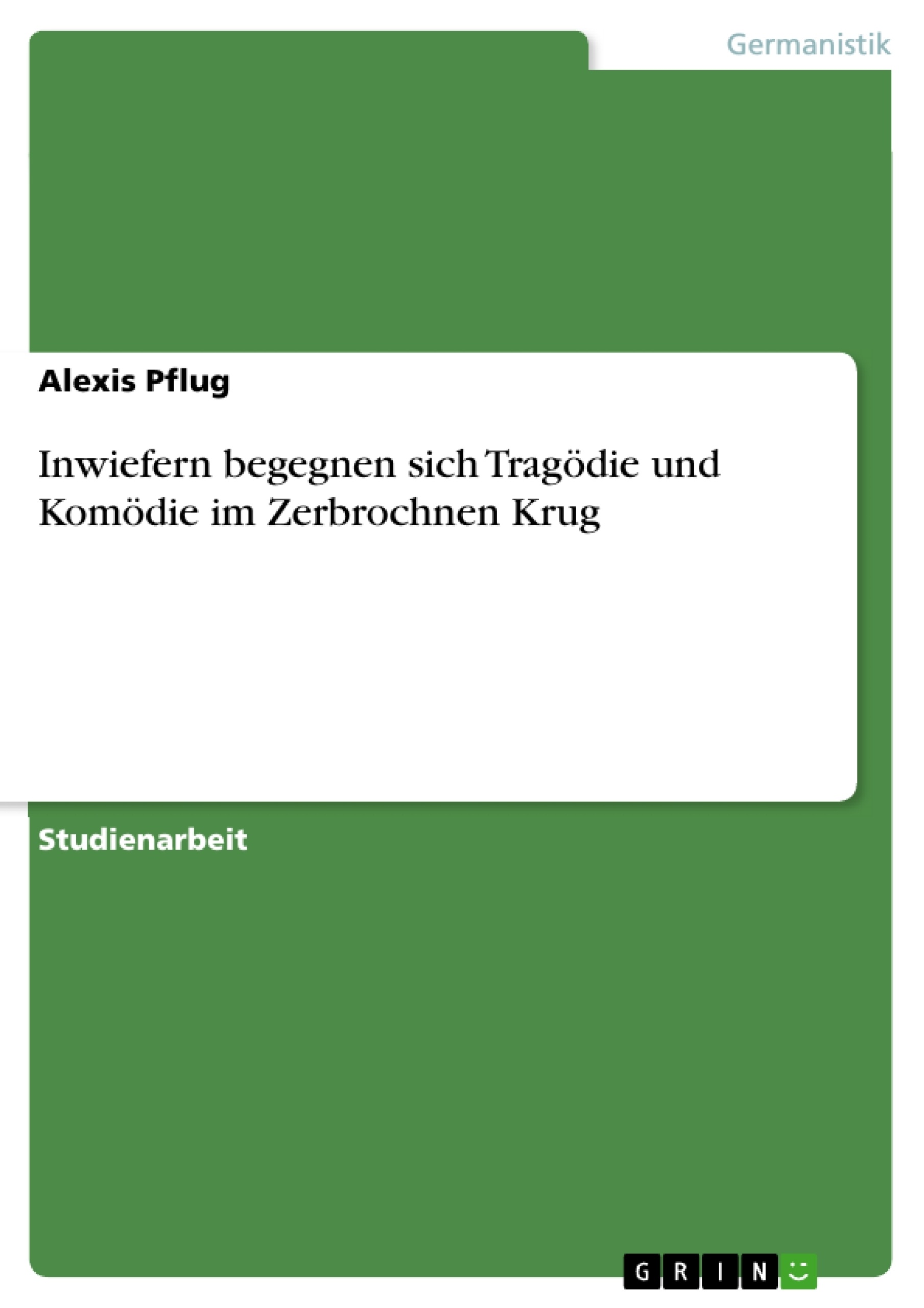Auch wenn Goethe’s unglückliche Inszenierung eine Mitschuld (und nach dem späteren Erfolg des Stückes zu urteilen, eine Hauptschuld) trug: Die Zuschauer der Weimarer Uraufführung des ‚zerbrochnen Kruges‘ 1808 hielten ihn weder für komisch noch tragisch; sie fanden ihn stattdessen langweilig.
In der gekürzten Fassung ohne den sogenannten ‚Variant‘ gilt er heute hingegen als eine der gelungensten unter den spärlich gesäten, überhaupt als gelungen zu betrachtenden deutschen Komödien.
Kleist hatte nach der desaströsen Premiere die ausufernde Schlussszene, die das Publikum schwer verstimmt hatte, um ca. 500 Verse gestrichen und sie später als ‚Variant‘ in seiner Zeitschrift ‚Phöbus‘ separat veröffentlicht. So endet das Werk genau so auseinander gebrochen wie sein Namensgeber, dessen Name selbst wiederum zerbrochen ist (‚Der zerbroch-ne Krug‘). Seitdem die meistgespielte deutsche Komödie, warf der ‚Krug‘ seither immer wieder die Frage nach seiner dramatischen Gattung auf, die vielfältige Antworten hervorbrachte. Hans Joachim Schrimpf legte hier eine Sammlung an und fand, dass der Krug, von Kleist als Lustspiel ausgewiesen, schon als ‚‚Komisches Idyll‘, ‚burleskes Genre-Bild‘, ‚stilisiertes Volksstück‘, ‚Idyllische Komödie‘, ‚Lustspiel, geboren aus dem Geist der Komödie‘ oder auch als ‚Reine Komödie‘, ‚Schicksalskomödie‘ und ‚Tragikomödie der modernen Subjektivität‘ aufgefasst wurde.
Um das komplizierte Zusammenspiel des ‚Tragischen‘ und des ‚Komischen‘ auflösen zu können, das in Weimar durch misslungene Interpretation in Kombination mit Überlänge scheiterte und im Gegensatz dazu heute unter anderer Beleuchtung den ‚Krug‘ als bedeutendes Kunstwerk auszeichnet, bedarf es der grundlegenden Klärung der Frage, wo das ‚Komische‘ und das ‚Tragische‘ sich begegnen, worüber wir lachen oder trauern und warum.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 2.1. Begriffsklärung „Tragödie“
- 2.2. Begriffsklärung „Komödie“
- 3. Kurze Sammlung von Tragischem und Komischem im „Zerbrochnen Krug“
- 3.1. Tragisches und typisch Tragisches
- 3.2. Komisches
- 4. Hintergründe und Zutaten
- 5. Wo begegnen sich Tragik und Komik allgemein? Worüber trauern oder lachen wir?
- 6. Verhältnis und Zusammenspiel von Tragödie und Komödie im Zerbrochnen Krug
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das komplexe Wechselspiel von Tragödie und Komödie in Heinrich von Kleists „Zerbrochnen Krug“. Ziel ist es, die unterschiedlichen Interpretationen des Stücks zu beleuchten und zu analysieren, warum es in seiner Uraufführung als langweilig empfunden wurde, während es heute als gelungene Komödie gefeiert wird. Die Arbeit befasst sich mit der Klärung der Begriffe „Tragödie“ und „Komödie“ und deren Anwendung auf das Stück.
- Begriffliche Abgrenzung von Tragödie und Komödie
- Analyse der tragischen und komischen Elemente im „Zerbrochnen Krug“
- Untersuchung des Verhältnisses von Tragik und Komik im Stück
- Interpretation der unterschiedlichen Rezeption des Stücks
- Bedeutung der gekürzten Fassung für die heutige Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung thematisiert die gegensätzliche Rezeption von Kleists „Zerbrochnen Krug“: Während die Uraufführung 1808 als langweilig empfunden wurde, gilt das Stück heute – in seiner gekürzten Fassung – als eine der gelungensten deutschen Komödien. Die unterschiedliche Rezeption wird auf die ursprüngliche, ausufernde Schlussszene zurückgeführt, die später als „Variant“ veröffentlicht wurde. Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem komplizierten Zusammenspiel von Tragischem und Komischem im Stück und der Notwendigkeit, die Begriffe „Tragödie“ und „Komödie“ zu klären, um diese Frage zu beantworten.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel liefert eine detaillierte Begriffsklärung von „Tragödie“ und „Komödie“. Es beschreibt die Tragödie als die älteste und höchste Form des Dramas, geprägt durch den unausgleichbaren Gegensatz zwischen dem Einzelnen und einem übermächtigen Schicksal. Der tragische Held stürzt unausweichlich in sein Verderben, oft aufgrund eines Fehlers in einer Grenzsituation. Die Komödie hingegen wird als Gegenstück zur Tragödie definiert, mit heiterem Inhalt und glücklichem Ausgang. Sie bewirkt Heiterkeit durch Spott über menschliche Schwächen oder gesellschaftliche Missstände. Das Kapitel unterscheidet verschiedene Arten von Komödien (formal, inhaltlich-struktural, intentional) und diskutiert die problematische Unterscheidung zwischen Komödie und Lustspiel.
3. Kurze Sammlung von Tragischem und Komischem im „Zerbrochnen Krug“: Dieser Abschnitt analysiert die konkreten tragischen und komischen Elemente in Kleists Stück. Es werden Beispiele für typisch tragische und komische Szenen und Charaktere aus dem Drama vorgestellt und analysiert wie diese Elemente im Stück miteinander agieren und aufeinander einwirken.
4. Hintergründe und Zutaten: Dieses Kapitel beleuchtet die Hintergründe und die wesentlichen Zutaten der Dramenhandlung. Es untersucht die Kontexte, die zur Entstehung des Stücks beigetragen haben und analysiert stilistische Mittel und Elemente die zum Gelingen des Stücks beitragen.
5. Wo begegnen sich Tragik und Komik allgemein? Worüber trauern oder lachen wir?: Dieser Abschnitt vertieft die philosophische und allgemeinere Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Tragik und Komik. Es werden allgemeine Gründe dafür erörtert, warum Menschen über bestimmte Dinge lachen oder trauern und inwiefern dieses Verständnis mit der Dramenhandlung zusammenhängt.
6. Verhältnis und Zusammenspiel von Tragödie und Komödie im Zerbrochnen Krug: In diesem zentralen Kapitel wird das komplexe Verhältnis und Zusammenspiel von Tragödie und Komödie im „Zerbrochnen Krug“ im Detail analysiert. Es wird untersucht wie die verschiedenen Elemente des Dramas miteinander verschmelzen und zueinander in Beziehung stehen.
Schlüsselwörter
Zerbrochener Krug, Heinrich von Kleist, Tragödie, Komödie, Lustspiel, Tragikomödie, Gattung, Rezeption, Interpretation, Komisches, Tragisches, menschliche Schwächen, gesellschaftliche Missstände, Weimarer Uraufführung, „Variant“.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich von Kleists "Zerbrochener Krug"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das komplexe Wechselspiel von Tragödie und Komödie in Heinrich von Kleists "Zerbrochnen Krug". Sie untersucht die unterschiedlichen Interpretationen des Stücks, insbesondere den Grund für die langweilige Rezeption der Uraufführung im Gegensatz zur heutigen Würdigung als gelungene Komödie. Die Arbeit klärt die Begriffe "Tragödie" und "Komödie" und wendet diese auf das Stück an.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriffliche Abgrenzung von Tragödie und Komödie; Analyse der tragischen und komischen Elemente im "Zerbrochnen Krug"; Untersuchung des Verhältnisses von Tragik und Komik im Stück; Interpretation der unterschiedlichen Rezeption des Stücks; Bedeutung der gekürzten Fassung für die heutige Rezeption.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsklärung (Tragödie und Komödie), Kurze Sammlung von Tragischem und Komischem im "Zerbrochnen Krug", Hintergründe und Zutaten, Wo begegnen sich Tragik und Komik allgemein?, Verhältnis und Zusammenspiel von Tragödie und Komödie im "Zerbrochnen Krug", Fazit.
Wie wird die Tragödie im "Zerbrochnen Krug" definiert?
Die Arbeit definiert die Tragödie als die älteste und höchste Form des Dramas, geprägt durch den unausgleichbaren Gegensatz zwischen dem Einzelnen und einem übermächtigen Schicksal. Der tragische Held stürzt unausweichlich in sein Verderben, oft aufgrund eines Fehlers in einer Grenzsituation.
Wie wird die Komödie im "Zerbrochnen Krug" definiert?
Die Komödie wird als Gegenstück zur Tragödie definiert, mit heiterem Inhalt und glücklichem Ausgang. Sie bewirkt Heiterkeit durch Spott über menschliche Schwächen oder gesellschaftliche Missstände. Verschiedene Arten von Komödien (formal, inhaltlich-struktural, intentional) und die problematische Unterscheidung zwischen Komödie und Lustspiel werden diskutiert.
Wie werden Tragik und Komik im "Zerbrochnen Krug" analysiert?
Die Arbeit analysiert konkrete tragische und komische Elemente in Kleists Stück. Beispiele für typisch tragische und komische Szenen und Charaktere werden vorgestellt und analysiert, wie diese Elemente im Stück miteinander agieren und aufeinander einwirken. Das zentrale Kapitel untersucht detailliert das komplexe Verhältnis und Zusammenspiel beider Elemente im Stück.
Welche Hintergründe werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe und wesentlichen Zutaten der Dramenhandlung. Sie untersucht die Kontexte, die zur Entstehung des Stücks beigetragen haben und analysiert stilistische Mittel und Elemente, die zum Gelingen des Stücks beitragen.
Welche philosophische Fragestellung wird behandelt?
Die Arbeit erörtert allgemeinere Gründe, warum Menschen über bestimmte Dinge lachen oder trauern und inwiefern dieses Verständnis mit der Dramenhandlung zusammenhängt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Zerbrochener Krug, Heinrich von Kleist, Tragödie, Komödie, Lustspiel, Tragikomödie, Gattung, Rezeption, Interpretation, Komisches, Tragisches, menschliche Schwächen, gesellschaftliche Missstände, Weimarer Uraufführung, „Variant“.
Warum wurde das Stück in der Uraufführung als langweilig empfunden?
Die unterschiedliche Rezeption des Stücks wird auf die ursprüngliche, ausufernde Schlussszene zurückgeführt, die später als „Variant“ veröffentlicht wurde.
- Quote paper
- Alexis Pflug (Author), 2002, Inwiefern begegnen sich Tragödie und Komödie im Zerbrochnen Krug, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50444