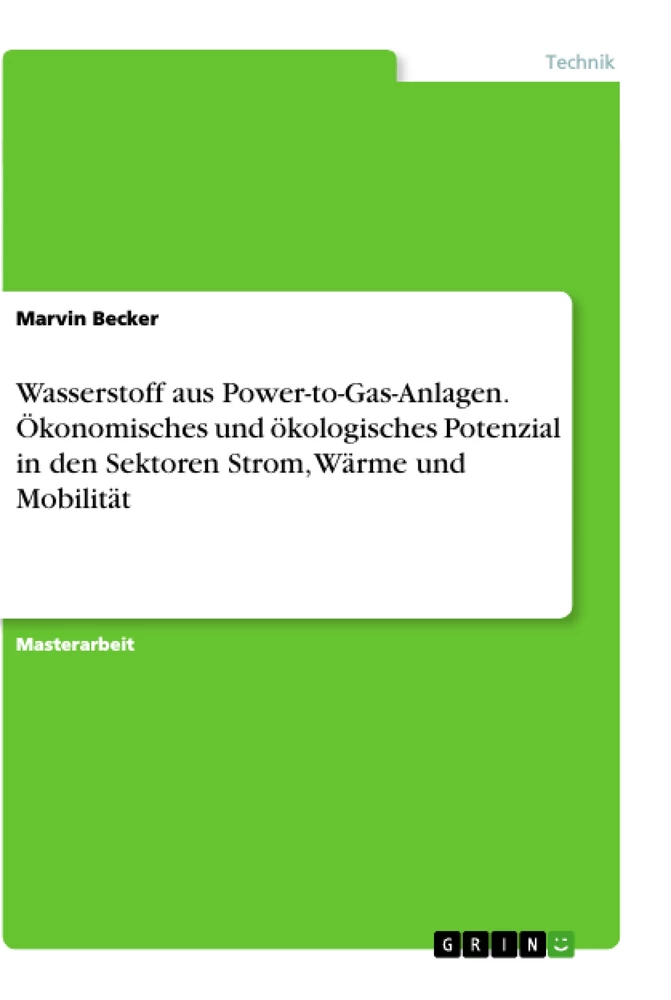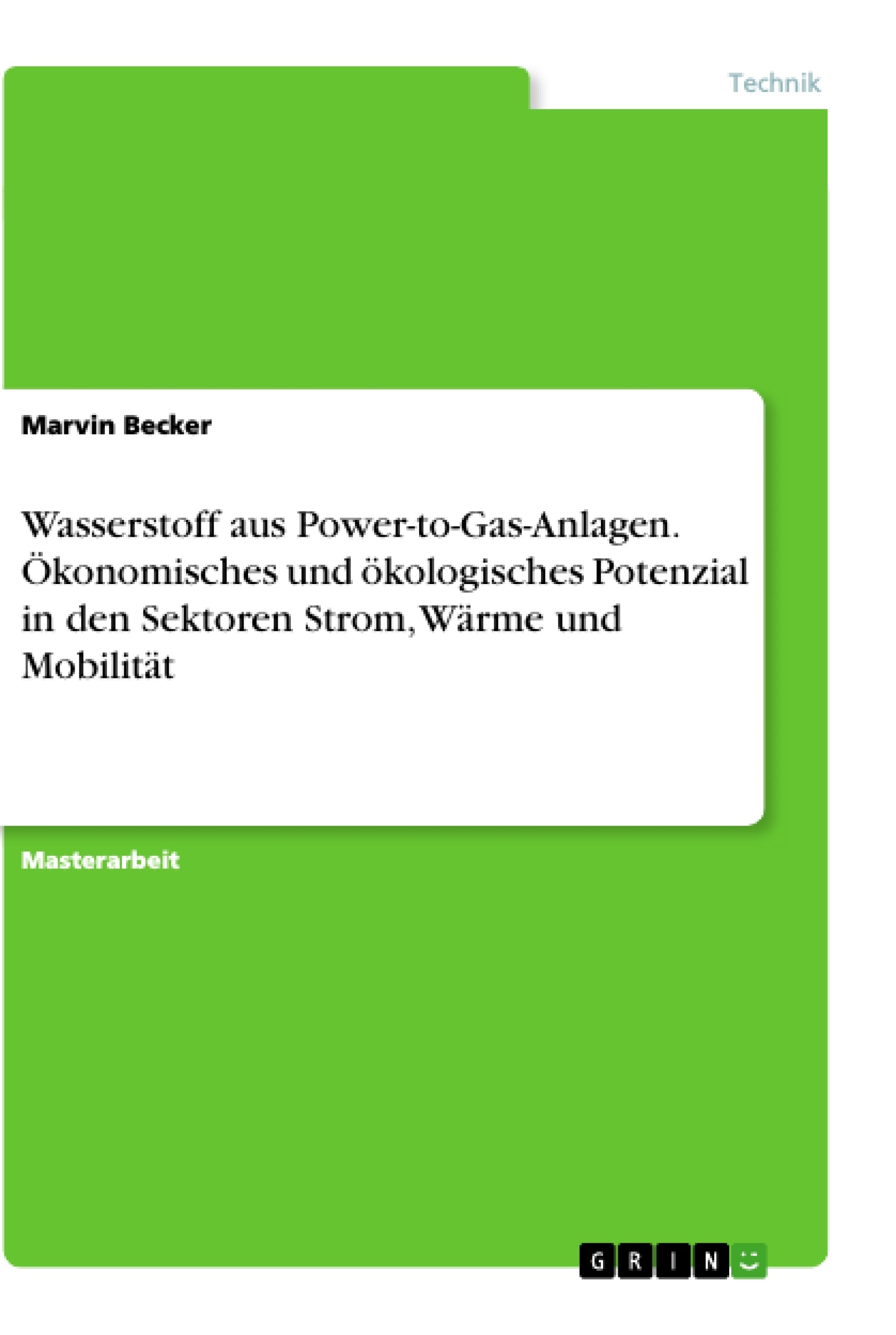Die Master-Thesis befasst sich mit dem ökonomischen und ökologischen Potenzial von Wasserstoff aus Power-to-Gas-Anlagen in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität. Das derzeitige Potenzial wird auf Basis der aktuell verfügbaren Infrastruktur und der vorliegenden Rahmenbedingungen dargestellt. Als Grundlage für die Potenziale in den Jahren 2030 und 2050, insbesondere mit Blick auf die in Deutschland anvisierten Klimaziele, werden vier ausgewählte Studien analysiert und die relevanten Benchmarks und Empfehlungen gegenübergestellt und interpretiert.
Der Stromsektor ist mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien bereits auf einem vielversprechenden Weg, jedoch müssen Wind- und Solarenergie auch verstärkt in den Sektoren Wärme und Mobilität eingesetzt werden. Eine Sektorkopplung durch Power-to-X und der Aufbau einer Infrastruktur für grüne Gase (wie z.B. Wasserstoff) sind für das Erreichen der Klimaziele von großer Bedeutung.
Insbesondere im Sektor Mobilität müssen allerdings Treibhausgas-Minderungen mit Umwandlungsverlusten abgewogen werden und batterieelektrische Fahrzeuge sollten aufgrund der hohen Effizienz die erste Wahl für Kurzstrecken sein. Ähnlich wie im Mobilitätssektor ist im Sektor Wärme die direktelektrische Variante mit Wärmepumpen deutlich effizienter als die Nutzung von Wasserstoff oder anderen grünen Gasen aus Power-to-X-Anlagen. Aufgrund der Fragmentierung im Wärmesektor ist eine hohe Flexibilität bei der Bereitstellung von Wärme erforderlich. Wasserstoff bietet hier als Grundstoff viele Möglichkeiten um eine Minderung von Treibhausgasen zu realisieren.
Neben einer Anpassung der Rahmenbedingungen (z.B. keine EEG-Umlage für PtX-Anlagen) und der Implementierung geeigneter Förderinstrumente (z.B. CO2-Bepreisung) sollte ein Massenbilanzsystem eingeführt werden, um die grüne Eigenschaft der erneuerbaren Energien nachverfolgbar auf Wasserstoff übertragen zu können. Damit die Transformation zu einem nachhaltigen Energiesystem mittelfristig gelingt, muss auf der einen Seite die Sektorkopplung durch den Einsatz von Wasserstoff aus PtG-Anlagen ermöglicht und gefördert werden. Auf der anderen Seite muss eine Elektrifizierung überall dort stattfinden, wo sie ökonomisch und ökologisch sinnvoller ist als der Einsatz grüner Gase. Es sollte ein Technologiemix angestrebt werden mit dem Ziel, sowohl die Kosten als auch die Umweltbelastung zu minimieren und dabei Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Wasserstoff als Bindeglied der Energiewende
- 1.1 Herausforderungen der Energiewende
- 1.2 Langzeitspeicher im Stromnetz
- 1.3 Sektorkopplung mit Power-to-X
- 1.4 All-Electric-Society vs. Green-Gas-Society/Technologiemix
- 2 Grundlagen von Wasserstoff
- 2.1 Geschichte des Wasserstoffs
- 2.2 Energiedichte und Reinheit
- 2.3 Produktion und Differenzierung
- 2.4 Vor- und Nachteile von Wasserstoff im heutigen Energiesystem
- 3 Sektorübergreifender Wasserstoffeinsatz: Prozesse
- 3.1 Elektrolyse (PtG)
- 3.1.1 Alkalische Elektrolyse (AE)
- 3.1.2 Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (PEME)
- 3.1.3 Festoxid-Elektrolyse (SOE)
- 3.2 Methanisierung (PtM)
- 3.2.1 Katalytische Methanisierung
- 3.2.2 Biologische Methanisierung
- 3.3 Kraftstoffsynthese (PtL)
- 3.3.1 Methanol-Synthese
- 3.3.2 Fischer-Tropsch-Synthese
- 3.4 Brennstoffzelle
- 3.4.1 Reversible Brennstoffzellen als Energiespeicher
- 3.4.2 Kraft-Wärme-Kopplung
- 3.4.3 Mobilität mit Brennstoffzellen
- 3.5 CO2-Gewinnung/CO2-Quellen
- 4 Infrastruktur
- 4.1 Speicher- und Transportmöglichkeiten
- 4.2 Betriebsmittel und Wasserstoffbeimischung
- 4.3 Power-to-X-Projekte in Deutschland
- 4.4 Ideenwettbewerb: Reallabore der Energiewende
- 5 Rahmenbedingungen
- 5.1 EnWG und EEG
- 5.2 Netzentwicklungsplan
- 5.3 Sektorübergreifende CO2-Bepreisung
- 6 Potenzialanalyse nach Sektoren
- 6.1 Benchmarks und Ergebnisse der untersuchten Studien
- 6.1.1 dena-Leitstudie „Integrierte Energiewende“
- 6.1.2 MWIDE „Wasserstoffstudie Nordrhein-Westfalen“
- 6.1.3 NOW „Studie IndWEDe“
- 6.1.4 Agora „SynCost-Studie“
- 6.2 Ökonomisches Potenzial
- 6.2.1 Definition und Ansatz
- 6.2.2 Sektor Strom
- 6.2.3 Sektor Wärme
- 6.2.4 Sektor Mobilität
- 6.2.5 Auswertung: ökonomisches Potenzial
- 6.3 Ökologisches Potenzial
- 6.3.1 Definition und Ansatz
- 6.3.2 Sektor Strom
- 6.3.3 Sektor Wärme
- 6.3.4 Sektor Mobilität
- 6.3.5 Auswertung: ökologisches Potenzial
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das ökonomische und ökologische Potenzial von Wasserstoff aus Power-to-Gas-Anlagen in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität. Ziel ist es, das aktuelle Potenzial basierend auf der bestehenden Infrastruktur und den rechtlichen Rahmenbedingungen zu ermitteln und zukünftige Entwicklungen bis 2030 und 2050 im Hinblick auf die deutschen Klimaziele zu prognostizieren.
- Analyse des ökonomischen Potenzials von Wasserstoff
- Bewertung des ökologischen Potenzials von Wasserstoff
- Untersuchung der Sektorkopplung durch Power-to-X
- Bewertung verschiedener Technologien zur Wasserstoffgewinnung und -nutzung
- Analyse der notwendigen Infrastruktur und Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Wasserstoff als Bindeglied der Energiewende: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die Herausforderungen der Energiewende, die Rolle von Langzeitspeichern im Stromnetz und die Bedeutung der Sektorkopplung mittels Power-to-X. Es werden verschiedene Szenarien ("All-Electric-Society" vs. "Green-Gas-Society") diskutiert, um die verschiedenen Möglichkeiten der zukünftigen Energieversorgung aufzuzeigen und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes zu betonen. Die verschiedenen Herausforderungen und Möglichkeiten der Energiewende werden hier umfassend beleuchtet, um den Kontext für die spätere Analyse des Wasserstoffs als Bindeglied zu schaffen.
2 Grundlagen von Wasserstoff: Dieses Kapitel vermittelt grundlegendes Wissen über Wasserstoff, einschließlich seiner Geschichte, Energiedichte, Reinheit, Produktionsmethoden und Vor- und Nachteile im aktuellen Energiesystem. Es bildet die fachliche Basis für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel, indem es die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasserstoff sowie seine verschiedenen Produktionswege detailliert beschreibt und seine Stärken und Schwächen im Vergleich zu anderen Energieträgern herausstellt. Dieser Überblick ist essentiell für die Bewertung seines Potenzials in verschiedenen Sektoren.
3 Sektorübergreifender Wasserstoffeinsatz: Prozesse: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die verschiedenen Prozesse der Wasserstoffnutzung, inklusive Elektrolyse (mit Unterteilung in alkalische, PEM und Festoxid-Elektrolyse), Methanisierung, Kraftstoffsynthese und Brennstoffzellentechnologie. Es erläutert die jeweiligen Verfahren und deren Wirkungsgrade, die Rolle von CO2-Gewinnung und -Quellen, und die Möglichkeiten der Kraft-Wärme-Kopplung und Mobilität mit Brennstoffzellen. Die umfassende Darstellung der verschiedenen Prozesse ist unerlässlich für das Verständnis der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff und die Beurteilung ihrer jeweiligen Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
4 Infrastruktur: Dieses Kapitel behandelt die Infrastruktur, die für den großflächigen Einsatz von Wasserstoff notwendig ist. Es werden die Speicher- und Transportmöglichkeiten, Betriebsmittel, Wasserstoffbeimischung, Power-to-X-Projekte in Deutschland und "Reallabore der Energiewende" diskutiert. Die Analyse der Infrastruktur-Anforderungen ist essentiell für die Beurteilung der Realisierbarkeit einer Wasserstoffwirtschaft und zeigt die Herausforderungen auf, die bei der Umsetzung zu bewältigen sind. Der Fokus liegt dabei auf den verschiedenen Aspekten der notwendigen Infrastruktur, von der Speicherung und dem Transport bis hin zu den politischen Rahmenbedingungen und laufenden Projekten.
5 Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Wasserstoff, darunter die EnWG und EEG, den Netzentwicklungsplan und die sektorübergreifende CO2-Bepreisung. Die Analyse der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen ist entscheidend für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und der Umsetzbarkeit der Wasserstofftechnologie. Sie liefert die Grundlage für die Einschätzung, wie die politischen Entscheidungen die Entwicklung und Verbreitung der Technologie beeinflussen.
6 Potenzialanalyse nach Sektoren: In diesem Kapitel werden verschiedene Studien (dena, MWIDE, NOW, Agora) verglichen und die Ergebnisse bezüglich des ökonomischen und ökologischen Potenzials von Wasserstoff in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität ausgewertet. Der Vergleich verschiedener Studien und deren Ergebnisse ist zentral für die Validierung der Ergebnisse und die Beurteilung der Robustheit der Schlussfolgerungen. Die detaillierte Analyse der ökonomischen und ökologischen Aspekte in den verschiedenen Sektoren ermöglicht eine umfassende Beurteilung des Potenzials von Wasserstoff und stellt die unterschiedlichen Herausforderungen und Chancen in den verschiedenen Sektoren heraus.
Schlüsselwörter
Wasserstoff, Power-to-Gas, Energiewende, Sektorkopplung, Elektrolyse, Methanisierung, Brennstoffzelle, Ökonomisches Potenzial, Ökologisches Potenzial, Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Klimaziele, erneuerbare Energien, Mobilität, Wärme, Strom.
FAQ: Wasserstoff als Bindeglied der Energiewende
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das ökonomische und ökologische Potenzial von Wasserstoff aus Power-to-Gas-Anlagen in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität. Ziel ist die Ermittlung des aktuellen Potenzials und die Prognose zukünftiger Entwicklungen bis 2030 und 2050 im Hinblick auf die deutschen Klimaziele.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Herausforderungen der Energiewende, die Rolle von Wasserstoff als Langzeitspeicher, die Sektorkopplung durch Power-to-X, verschiedene Wasserstoffgewinnungs- und -nutzungstechnologien (Elektrolyse, Methanisierung, Brennstoffzellen), die notwendige Infrastruktur, rechtliche Rahmenbedingungen (EnWG, EEG, Netzentwicklungsplan, CO2-Bepreisung), sowie eine Potenzialanalyse nach Sektoren (Strom, Wärme, Mobilität) basierend auf verschiedenen Studien (dena, MWIDE, NOW, Agora).
Welche Technologien zur Wasserstoffgewinnung und -nutzung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Elektrolyse (alkalisch, PEM, Festoxid), die Methanisierung (katalytisch, biologisch), die Kraftstoffsynthese (Methanol-, Fischer-Tropsch-Synthese) und die Brennstoffzellentechnologie. Die jeweiligen Verfahren und Wirkungsgrade werden detailliert beschrieben.
Welche Sektoren werden in der Potenzialanalyse betrachtet?
Die Potenzialanalyse betrachtet die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität, sowohl hinsichtlich des ökonomischen als auch des ökologischen Potenzials von Wasserstoff.
Welche Studien wurden zur Potenzialanalyse herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf Studien der dena („Integrierte Energiewende“), MWIDE („Wasserstoffstudie Nordrhein-Westfalen“), NOW („Studie IndWEDe“) und Agora („SynCost-Studie“), um das ökonomische und ökologische Potenzial von Wasserstoff zu bewerten.
Wie wird die notwendige Infrastruktur für den Wasserstoffeinsatz behandelt?
Die Arbeit analysiert die notwendigen Speicher- und Transportmöglichkeiten, Betriebsmittel, Wasserstoffbeimischung und relevante Power-to-X-Projekte in Deutschland. Auch „Reallabore der Energiewende“ werden diskutiert.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Energie-Wirtschaft-Gesetz (EnWG), den Netzentwicklungsplan und die sektorübergreifende CO2-Bepreisung.
Welche Szenarien werden im Hinblick auf die zukünftige Energieversorgung diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Szenarien „All-Electric-Society“ und „Green-Gas-Society“, um verschiedene Möglichkeiten der zukünftigen Energieversorgung aufzuzeigen und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes zu betonen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wasserstoff, Power-to-Gas, Energiewende, Sektorkopplung, Elektrolyse, Methanisierung, Brennstoffzelle, Ökonomisches Potenzial, Ökologisches Potenzial, Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Klimaziele, erneuerbare Energien, Mobilität, Wärme, Strom.
Wie sind die Kapitel der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert in Kapitel zu: Wasserstoff als Bindeglied der Energiewende, Grundlagen von Wasserstoff, Sektorübergreifender Wasserstoffeinsatz: Prozesse, Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Potenzialanalyse nach Sektoren und Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
- Quote paper
- Marvin Becker (Author), 2019, Wasserstoff aus Power-to-Gas-Anlagen. Ökonomisches und ökologisches Potenzial in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504391