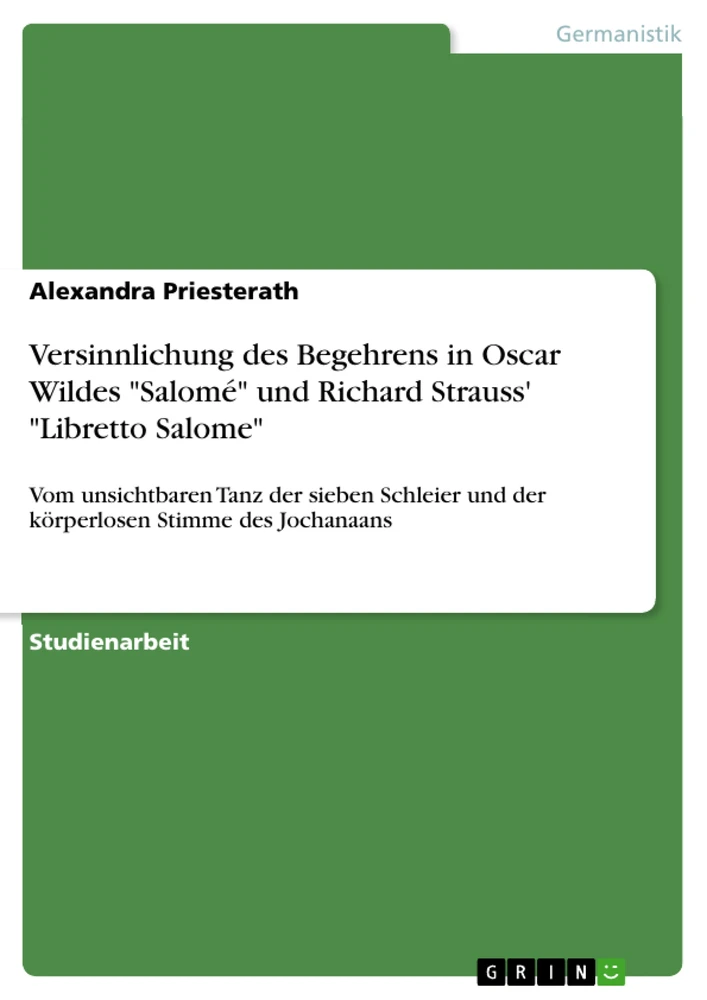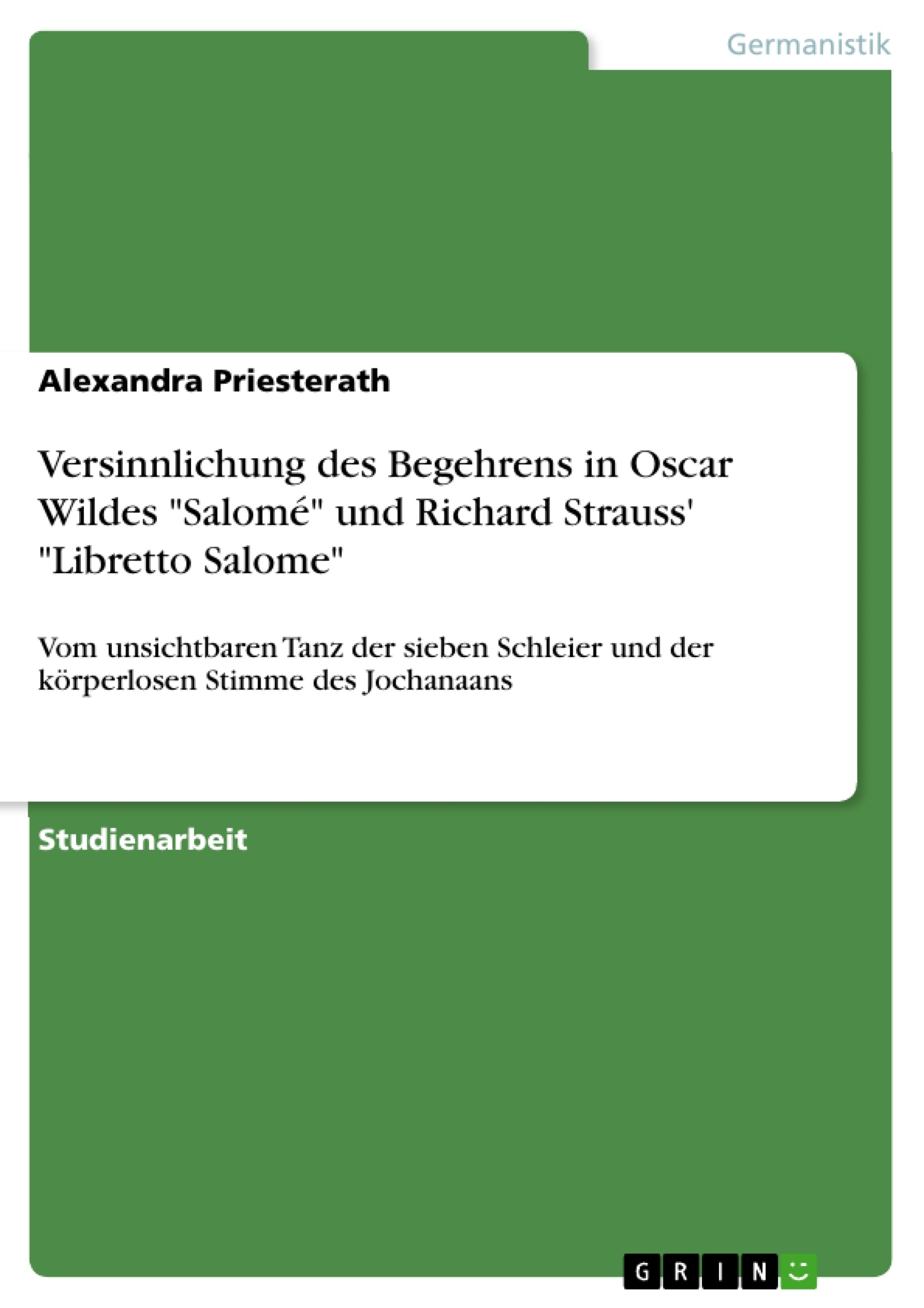Diese Arbeit soll textnah, mit Einbeziehung des historischen Kontextes, die Versinnlichung des Begehrens in Wildes "Salomé" und Strauss‘ "Libretto" herausarbeiten und fruchtbringende Vergleichspunkte aufzeigen. Es sollen zuerst die Exotik und Erotik auf der fin de siècle-Bühne, der Begriff der Femme fatale sowie der freudsche Narzissmus für eine historisch-theoretische Grundlage erläutert werden. Im Anschluss werden die Zensurmaßnahmen kurz ausgeführt. Schließlich folgt die Analyse der einzelnen Sinneswahrnehmungen, die in die Hauptmotive (Mond, Blick, Tanz, Stimme) untergliedert sind.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung (Wildes und Strauss' Quellen, Fragestellung, Forschungsüberblick)
- II) Exotik und Erotik auf der fin de siècle-Bühne
- III) Femme fatale und freudscher Narzissmus
- IV) Homosexuelles Begehren und Zensur
- V) Analyse der Sinneswahrnehmungen
- VI) Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Versinnlichung des Begehrens in Oscar Wildes und Richard Strauss' "Salome", indem sie textnahe Analysen mit dem historischen Kontext verbindet. Ziel ist es, fruchtbare Vergleichspunkte zwischen beiden Werken aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet zunächst die Exotik und Erotik auf der fin de siècle-Bühne, den Begriff der Femme fatale und den freudschen Narzissmus als historisch-theoretische Grundlage. Die Zensurmaßnahmen werden kurz erläutert, bevor die Analyse der Sinneswahrnehmungen im Werk folgt.
- Die Darstellung von Exotik und Erotik im Kontext der Fin de Siècle-Ästhetik
- Die Rolle der Femme fatale und des freudschen Narzissmus
- Die Zensur und ihre Auswirkungen auf die Rezeption beider Werke
- Analyse der Sinneswahrnehmungen (Mond, Blick, Tanz, Stimme)
- Vergleich der Interpretationen von Wilde und Strauss
Zusammenfassung der Kapitel
I) Einleitung (Wildes und Strauss' Quellen, Fragestellung, Forschungsüberblick): Die Einleitung beschreibt die Renaissance der Salome-Figur im späten 19. Jahrhundert und die zahlreichen künstlerischen Adaptionen des biblischen Stoffes. Sie nennt Wildes Quellen (Flaubert, Moreau) und die Entstehungsgeschichte seines Dramas, einschließlich der Zensurprobleme und der unterschiedlichen Versionen (französisch, englisch). Die Arbeit wird als textnahe Analyse mit Einbezug des historischen Kontextes vorgestellt, welche die Versinnlichung des Begehrens in Wildes und Strauss' Werk erforscht. Die methodische Herangehensweise an die Thematik wird erläutert, mit Fokus auf den Vergleich der beiden Werke.
II) Exotik und Erotik auf der fin de siècle-Bühne: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung von Sexualität in Wildes und Strauss' "Salome" mit besonderer Berücksichtigung der Motive von Exotik und Erotik und deren Korrelation. Es wird argumentiert, dass die zeitliche und räumliche Exotik des biblischen Stoffes instrumentalisiert wird, um die Fremdheit als verführerisch und gefährlich darzustellen. Die hypersexualisierte Frau, jenseits ihrer mütterlichen Funktion, wird als sexuelle Bedrohung für die männlichen Figuren (Herodes, Narraboth, Jochanaan) dargestellt. Das Kapitel beleuchtet den Wandel der Darstellung weiblicher Figuren von der Idealisierung der Romantik hin zur Projektionsfläche für gesellschaftliche Ängste im Fin de Siècle und die Rolle des Blicks als Motiv und Symbol für Voyeurismus.
Schlüsselwörter
Salome, Oscar Wilde, Richard Strauss, Fin de Siècle, Exotik, Erotik, Femme fatale, Freudscher Narzissmus, Zensur, Sinneswahrnehmungen, Begehren, Libretto, Oper, Drama, Symbolismus, Sexualität, Weiblichkeit.
Häufig gestellte Fragen zu "Salome" von Oscar Wilde und Richard Strauss
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Versinnlichung des Begehrens in Oscar Wildes und Richard Strauss' "Salome" durch textnahe Analysen im historischen Kontext. Sie sucht nach Vergleichspunkten zwischen beiden Werken und beleuchtet dabei die Exotik und Erotik auf der fin de siècle-Bühne, die Femme fatale, den freudschen Narzissmus, Zensurmaßnahmen und die Sinneswahrnehmungen im Werk.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung von Exotik und Erotik im Kontext der Fin de Siècle-Ästhetik, die Rolle der Femme fatale und des freudschen Narzissmus, die Auswirkungen der Zensur auf die Rezeption, die Analyse der Sinneswahrnehmungen (Mond, Blick, Tanz, Stimme) und einen Vergleich der Interpretationen von Wilde und Strauss.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel I (Einleitung) behandelt die Quellen, die Fragestellung und den Forschungsüberblick. Kapitel II (Exotik und Erotik) analysiert die Darstellung von Sexualität und die Instrumentalisierung von Exotik. Kapitel III (Femme fatale und Narzissmus) untersucht den Begriff der Femme fatale im Kontext des freudschen Narzissmus. Kapitel IV (Homosexuelles Begehren und Zensur) befasst sich mit der Zensur und ihren Auswirkungen. Kapitel V (Analyse der Sinneswahrnehmungen) konzentriert sich auf die Sinneswahrnehmungen im Werk. Kapitel VI (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Quellen werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf Wildes Quellen (Flaubert, Moreau) und die Entstehungsgeschichte seines Dramas, inklusive Zensurprobleme und verschiedener Versionen (französisch, englisch). Sie berücksichtigt den historischen Kontext und die zahlreichen künstlerischen Adaptionen des biblischen Stoffes.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine textnahe Analyse, die den historischen Kontext mit einbezieht, um die Versinnlichung des Begehrens in Wildes und Strauss' Werk zu erforschen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Werke.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Salome, Oscar Wilde, Richard Strauss, Fin de Siècle, Exotik, Erotik, Femme fatale, Freudscher Narzissmus, Zensur, Sinneswahrnehmungen, Begehren, Libretto, Oper, Drama, Symbolismus, Sexualität, Weiblichkeit.
- Citar trabajo
- Alexandra Priesterath (Autor), 2019, Versinnlichung des Begehrens in Oscar Wildes "Salomé" und Richard Strauss' "Libretto Salome", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504353