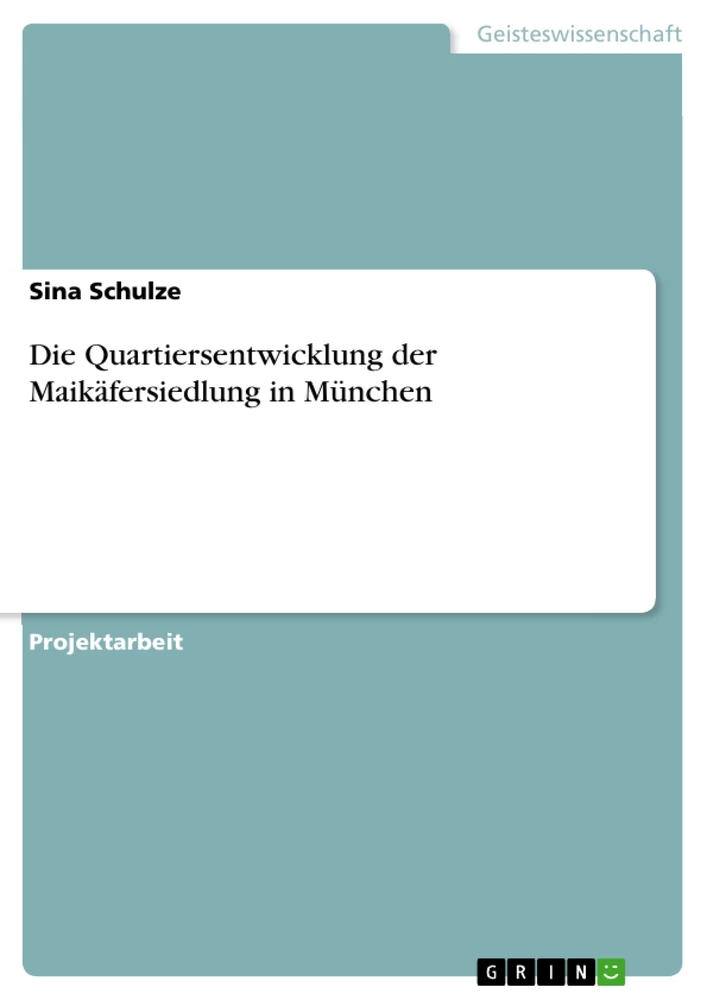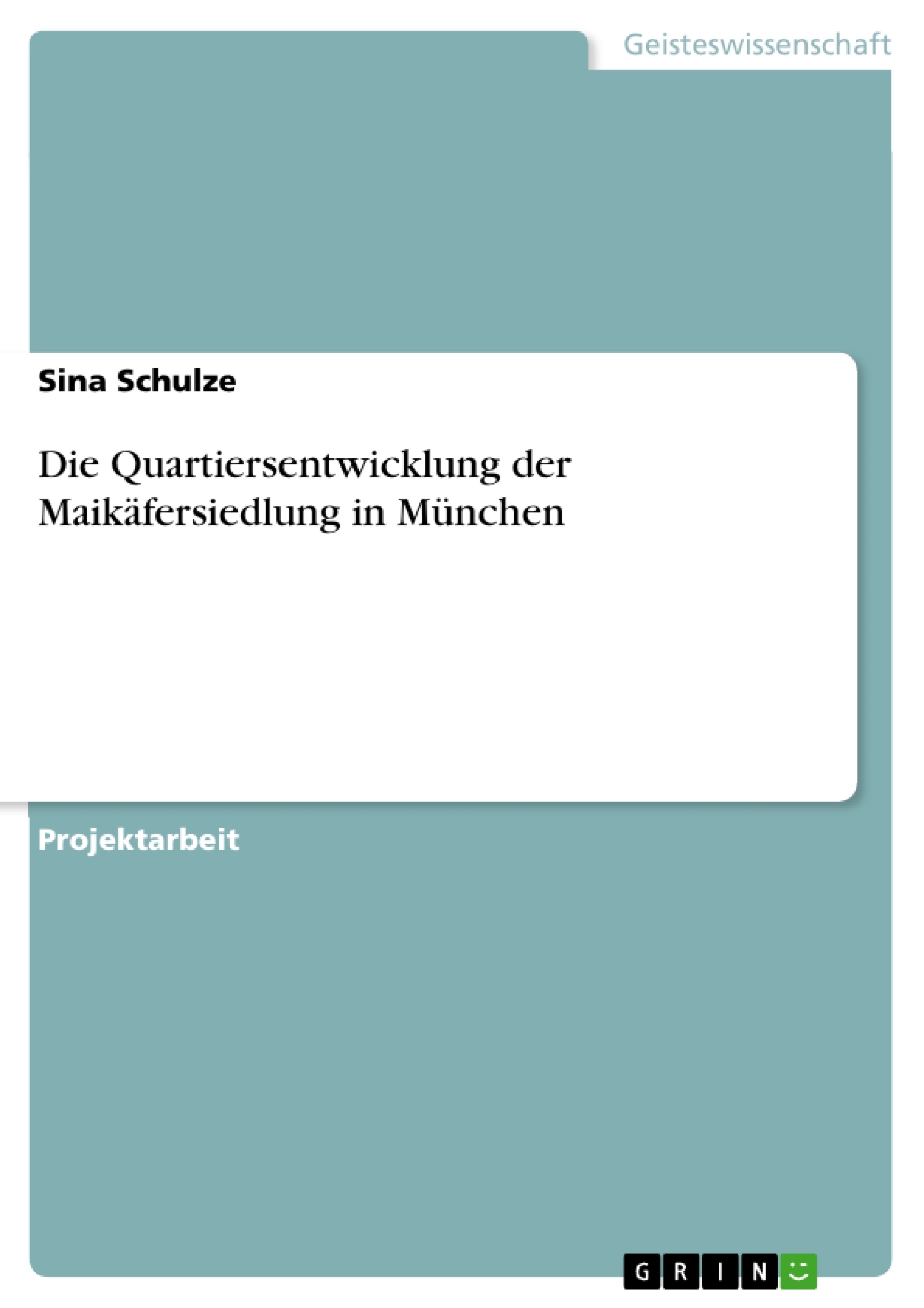Diese Arbeit behandelt die Quartiersentwicklung am Beispiel der Maikäfersiedlung in München. Zu Beginn wird der geschichtliche Hintergrund der Siedlung beschrieben und die Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus aufgegriffen. In einem weiteren Unterkapitel wird die Entstehung der Siedlung sowie die damalige vorzufindende Architektur dargestellt. Hierbei wird außerdem auf die Arbeit der gemeinnützigen Wohnstätten- und Siedlungsgesellschaft (GWG) in Zusammenarbeit mit dem Architekten Guido Harbers eingegangen. Das dritte Kapitel beschreibt die Entwicklung der Maikäfersiedlung in der Nachkriegszeit bis zur Neustrukturierung heute, da die GWG in den siebziger Jahren beschloss, die Siedlung nahezu in Gänze abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Hauptgrund für die mehr oder weniger nicht vermeidbare Neukonstruktion war der zur Bauzeit verwendete Porenbetonstein, welcher als sehr feuchtigkeitsanfällig gilt und verantwortlich für die schweren Bauschäden wurde.
Bereits seit mehreren Jahrzehnten zählt der Wohnungsmarkt in München zu den angespanntesten in ganz Deutschland. Daher kommt der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere in Bezug auf den sozialen Wohnungsbau eine besondere Bedeutung zu. Unter anderem die GWG hat sich schon zu Beginn ihrer Tätigkeit die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Form von Volkswohnungsanlagen zur Aufgabe gemacht. Volkswohnungen sind billigste Kleinstmietwohnungen in ein- oder mehrgeschossiger Bauweise. So entstand in den dreißiger Jahren als erstes großes Wohnprojekt der GWG die "Maikäfersiedlung" im Osten Münchens, welche noch heute ihre Bedeutung als ein Areal mit bewegter Vergangenheit hat und im Dritten Reich als Musterbeispiel für den sozialen Wohnungsbau galt. Wann und warum der Name "Maikäfersiedlung" eigentlich entstanden ist, ist heute umstritten. Einerseits wird behauptet, es habe zur Entstehungszeit viele Maikäfer in der Gegend gegeben, andere meinen, man sei sich aufgrund der Kleinstwohnungen wie ein Krabbeltier in einer Schachtel vorgekommen und wieder eine andere Version besagt, die Familien seien damals so groß gewesen wie die der Maikäfer.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die „Maikäfersiedlung“
- Geschichte und sozialer Wohnungsbau
- Entstehung und Architektur
- Die „Maikäfersiedlung“ nach dem Krieg bis heute
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Quartiersentwicklung der „Maikäfersiedlung“ in München und beleuchtet die Geschichte dieser Siedlung im Kontext des sozialen Wohnungsbaus. Sie analysiert die Entstehung der Siedlung sowie die Architektur und geht auf die Entwicklung der „Maikäfersiedlung“ in der Nachkriegszeit bis zur heutigen Neugestaltung ein.
- Der soziale Wohnungsbau im Kontext der Industrialisierung und der Entstehung von Armut in München
- Die „Maikäfersiedlung“ als Beispiel für Volkswohnungsanlagen in den 1930er Jahren
- Die Architektur der „Maikäfersiedlung“ und die Zusammenarbeit zwischen der GWG und Guido Harbers
- Die Entwicklung der Siedlung nach dem Krieg und die Gründe für den Abriss und Neubau
- Die aktuelle Situation der „Maikäfersiedlung“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Problematik des Wohnungsmarktes in München, die Relevanz des sozialen Wohnungsbaus und die Rolle der GWG. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte und Entstehung der „Maikäfersiedlung“. Es beleuchtet den geschichtlichen Hintergrund der Siedlung, den sozialen Wohnungsbau der damaligen Zeit und die Rolle der GWG in der Zusammenarbeit mit dem Architekten Guido Harbers.
Schlüsselwörter
Soziale Wohnungsbau, Volkswohnungen, „Maikäfersiedlung“, GWG, Guido Harbers, München, Architektur, Nachkriegszeit, Quartiersentwicklung, Neugestaltung.
- Quote paper
- Sina Schulze (Author), 2019, Die Quartiersentwicklung der Maikäfersiedlung in München, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504314