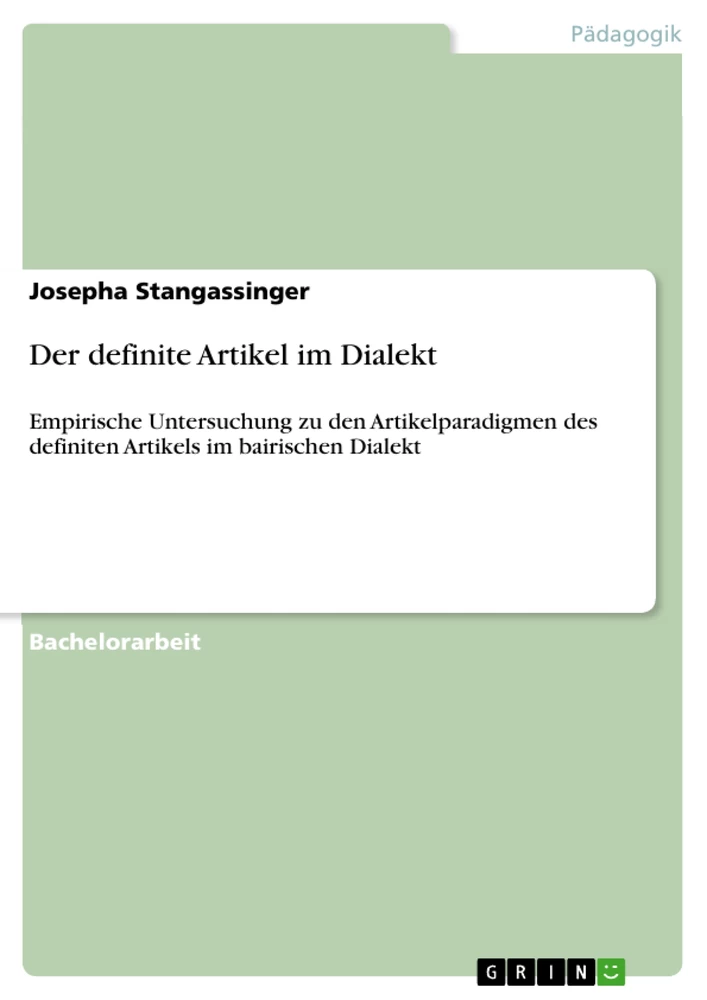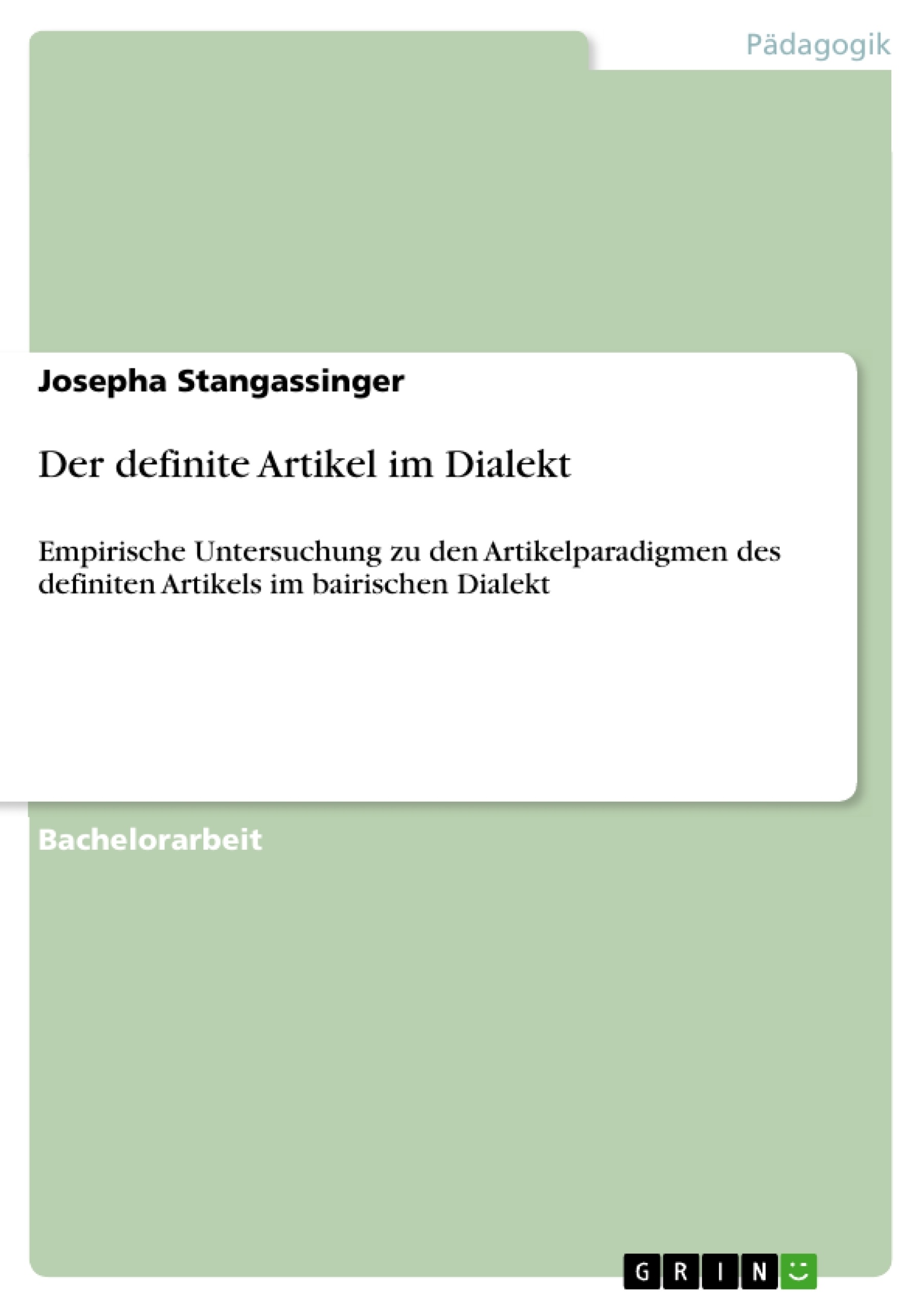Im Zuge des Seminars Grammatik der Dialekte und Umgangssprachen führten alle Studenten eine Dialektbefragung durch. Jeder sollte 4 Gewährspersonen aus ein und demselben Ort befragen, wobei 2 Probanden zwischen 20-30 Jahre und wiederum 2 Probanden über 60 Jahre alt sein sollten. Die insgesamt 68 Gewährspersonen, welche aus Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich kamen, stammen somit alle aus mittelbairischen oder südmittelbairischen Gebieten.
Die vorliegende Arbeit befasst sich schwerpunktmäßig mit den beiden Artikelparadigmen, DA-Paradigma und DE-Paradigma, des definiten Artikels im (mittel-) bairischen Dialekt. Während im Standarddeutschen nur ein Artikelparadigma existiert, haben sich in verschiedenen deutschen Dialekten aufgrund funktionaler Differenzierungen zwei unterschiedliche Artikelparadigmen herausgebildet. Diese Paradigmen bilden den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit, welche sich wie folgt gliedert: In Abschnitt 2 wird der theoretische Hintergrund, auf welchem diese Arbeit und die Erhebung basieren, erläutert. In Abschnitt 3 wird ein Überblick über den empirischen Teil gegeben. Des Weiteren werden die Ergebnisse in Abschnitt 4 mit Hilfe von Diagrammen dargestellt und präsentiert, und anschließend in Abschnitt 5 diskutiert und hinsichtlich der aufgestellten Hypothesen untersucht. Abschnitt 6 bildet mit dem Fazit den Abschluss der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1. Funktionen des definiten Artikels
- 2.2. Die Artikelparadigmen des definiten Artikels im bairischen Dialekt
- 2.3. Unterschiede zwischen den beiden existierenden Artikelparadigmen
- 2.3.1. Verwendung der Artikel bei Rufnamen
- 2.3.2. Funktion der Artikelparadigmen
- 2.3.3. Stellung der definiten Artikel
- 2.3.4. Gebrauchstypen der Artikelparadigmen
- 2.3.5. Akzentuierung der Artikel
- 2.3.6. Die Definitheitstypen
- 3. Empirischer Teil
- 3.1. Die Gewährspersonen
- 3.2. Das Untersuchungsgebiet
- 3.3. Beschreibung der Methode
- 3.4. Ablauf der Erhebung
- 3.5. Beschreibung der Items
- 4. Darstellung der Ergebnisse
- 4.1. Verwendung der Artikel bei Rufnamen
- 4.2. Funktion der Artikelparadigmen
- 4.3. Stellung der definiten Artikel
- 4.4. Gebrauchstypen der Artikelparadigmen
- 4.5. Die K-Definitheit
- 5. Diskussion der Ergebnisse
- 6. Fazit und Schlussworte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Artikelparadigmen des definiten Artikels im bairischen Dialekt. Ziel ist es, die Unterschiede zwischen den im bairischen Dialekt vorkommenden Paradigmen zu beschreiben und empirisch zu belegen. Die Arbeit basiert auf einer Dialektbefragung mit Gewährspersonen aus mittel- und südmittelbairischen Gebieten.
- Unterschiede zwischen den Artikelparadigmen (DA- und DE-Paradigma) im bairischen Dialekt
- Empirische Untersuchung der Verwendung des definiten Artikels in verschiedenen Kontexten
- Analyse der Funktion der Artikelparadigmen
- Beschreibung der Stellung der definiten Artikel im Satz
- Gebrauchstypen der Artikelparadigmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Hintergrund der Arbeit, der in einer Dialektbefragung im Rahmen eines Seminars entstand. Es wird die Auswahl der Gewährspersonen und das Untersuchungsgebiet (mittel- und südmittelbairische Gebiete) erläutert. Die Arbeit konzentriert sich auf die beiden Artikelparadigmen, DA- und DE-Paradigma, des definiten Artikels im bairischen Dialekt und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit. Es differenziert zwischen definiten und indefiniten Artikeln, beleuchtet die Entwicklung des definiten Artikels aus dem Demonstrativpronomen und erklärt dessen Funktion als Anzeige bereits bekannter Gegenstände. Anschließend werden die beiden Artikelparadigmen im bairischen Dialekt eingeführt, ohne jedoch auf Details einzugehen, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden. Die Unterscheidung zwischen Determinantien und Pronomen wird ebenfalls erläutert.
3. Empirischer Teil: Dieses Kapitel beschreibt den empirischen Teil der Untersuchung, beginnend mit der Beschreibung der Gewährspersonen, des Untersuchungsgebiets und der angewandten Methode. Es wird der Ablauf der Datenerhebung detailliert dargestellt, inklusive der Beschreibung der verwendeten Items (Fragen oder Sätze) der Befragung, welche die Grundlage der späteren Analyse bilden. Der methodische Ansatz wird im Detail erläutert, um die Reproduzierbarkeit und die Validität der Ergebnisse zu gewährleisten.
4. Darstellung der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Ergebnisse zu den verschiedenen Aspekten des definiten Artikels (Verwendung bei Rufnamen, Funktion der Paradigmen, Stellung im Satz, Gebrauchstypen) werden mithilfe von Diagrammen und Tabellen übersichtlich dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Visualisierung und einer klaren Präsentation der gewonnenen Daten, die die Grundlage für die anschließende Diskussion bilden.
5. Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel interpretiert die im vorherigen Kapitel präsentierten Ergebnisse. Die Ergebnisse werden im Kontext des theoretischen Hintergrunds diskutiert und hinsichtlich der zu Beginn aufgestellten Hypothesen untersucht. Die Diskussion beleuchtet mögliche Abweichungen und Einschränkungen der Ergebnisse und setzt sie in Beziehung zu anderen relevanten Studien und Forschungsergebnissen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zusammenfassend bewertet und kritisch reflektiert.
Schlüsselwörter
Definitartikel, bairischer Dialekt, Artikelparadigmen, DA-Paradigma, DE-Paradigma, Empirische Untersuchung, Dialektbefragung, Definitheit, Determinantien, Geographische Variation.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Artikelparadigmen des definiten Artikels im bairischen Dialekt
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Artikelparadigmen des definiten Artikels im bairischen Dialekt. Im Fokus stehen die Unterschiede zwischen den beiden im bairischen Dialekt vorkommenden Paradigmen (DA- und DE-Paradigma) und deren empirische Belegung.
Welche Methode wurde verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Dialektbefragung mit Gewährspersonen aus mittel- und südmittelbairischen Gebieten. Die Methode wird im Detail im empirischen Teil beschrieben, um Reproduzierbarkeit und Validität der Ergebnisse zu gewährleisten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Unterschiede zwischen den Artikelparadigmen, empirische Untersuchung der Artikelverwendung in verschiedenen Kontexten, Analyse der Funktion der Paradigmen, Beschreibung der Stellung der Artikel im Satz und die Gebrauchstypen der Paradigmen. Die K-Definitheit wird ebenfalls analysiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Empirischer Teil, Darstellung der Ergebnisse, Diskussion der Ergebnisse und Fazit. Die Einleitung beschreibt den Hintergrund und den Aufbau der Arbeit. Der theoretische Teil legt den Grundstein, der empirische Teil beschreibt die Methodik und Datenerhebung. Die Ergebnisse werden präsentiert und diskutiert, bevor ein Fazit gezogen wird.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die wichtigsten Ergebnisse beziehen sich auf die Unterschiede in der Verwendung der Artikelparadigmen (DA und DE) in verschiedenen Kontexten (z.B. bei Rufnamen, Satzstellung, Gebrauchstypen). Diese Ergebnisse werden durch Diagramme und Tabellen visualisiert und im Kontext des theoretischen Hintergrunds diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Definitartikel, bairischer Dialekt, Artikelparadigmen, DA-Paradigma, DE-Paradigma, Empirische Untersuchung, Dialektbefragung, Definitheit, Determinantien, Geographische Variation.
Wo wurde die Datenerhebung durchgeführt?
Die Datenerhebung fand in mittel- und südmittelbairischen Gebieten statt. Die genaue Auswahl der Untersuchungsgebiete und die Beschreibung der Gewährspersonen sind im empirischen Teil der Arbeit detailliert beschrieben.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Der theoretische Teil beleuchtet die Funktionen des definiten Artikels, die Entwicklung aus dem Demonstrativpronomen und die Unterscheidung zwischen definiten und indefiniten Artikeln. Die beiden Artikelparadigmen im bairischen Dialekt werden eingeführt, und die Unterscheidung zwischen Determinantien und Pronomen wird erläutert.
Wie werden die Ergebnisse präsentiert?
Die Ergebnisse werden übersichtlich mithilfe von Diagrammen und Tabellen dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf einer klaren Visualisierung der Daten, um die Interpretation und Diskussion zu erleichtern.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen, bewertet die gewonnenen Erkenntnisse und reflektiert kritisch die Methode und die Grenzen der Studie. Es bietet eine Schlussfolgerung zu den untersuchten Artikelparadigmen im bairischen Dialekt.
- Quote paper
- Bachelor Josepha Stangassinger (Author), 2016, Der definite Artikel im Dialekt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504110