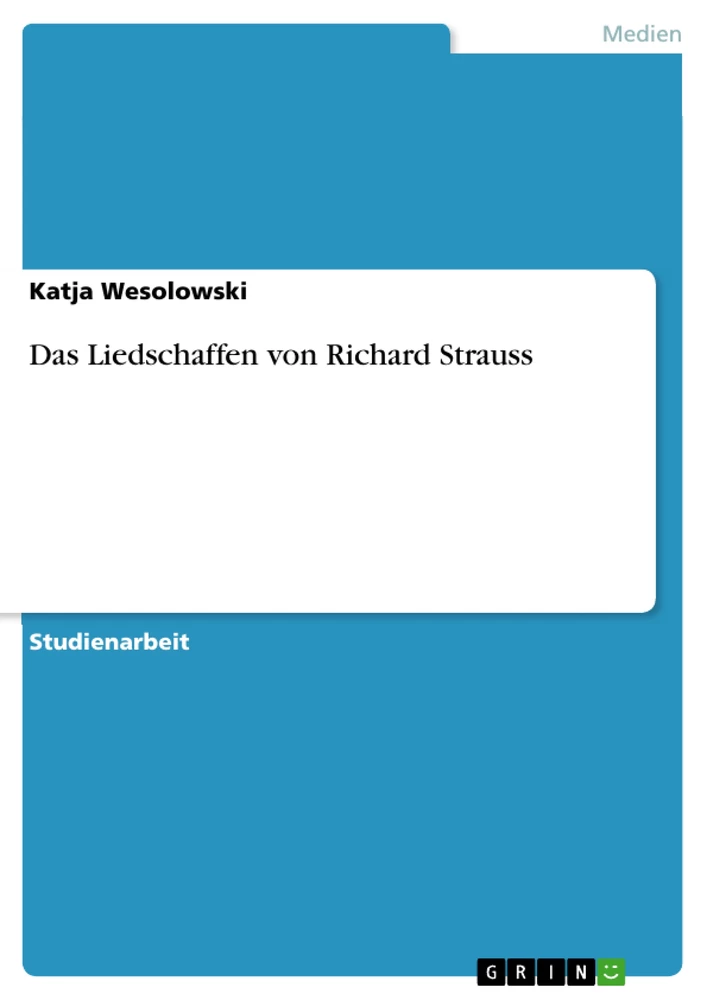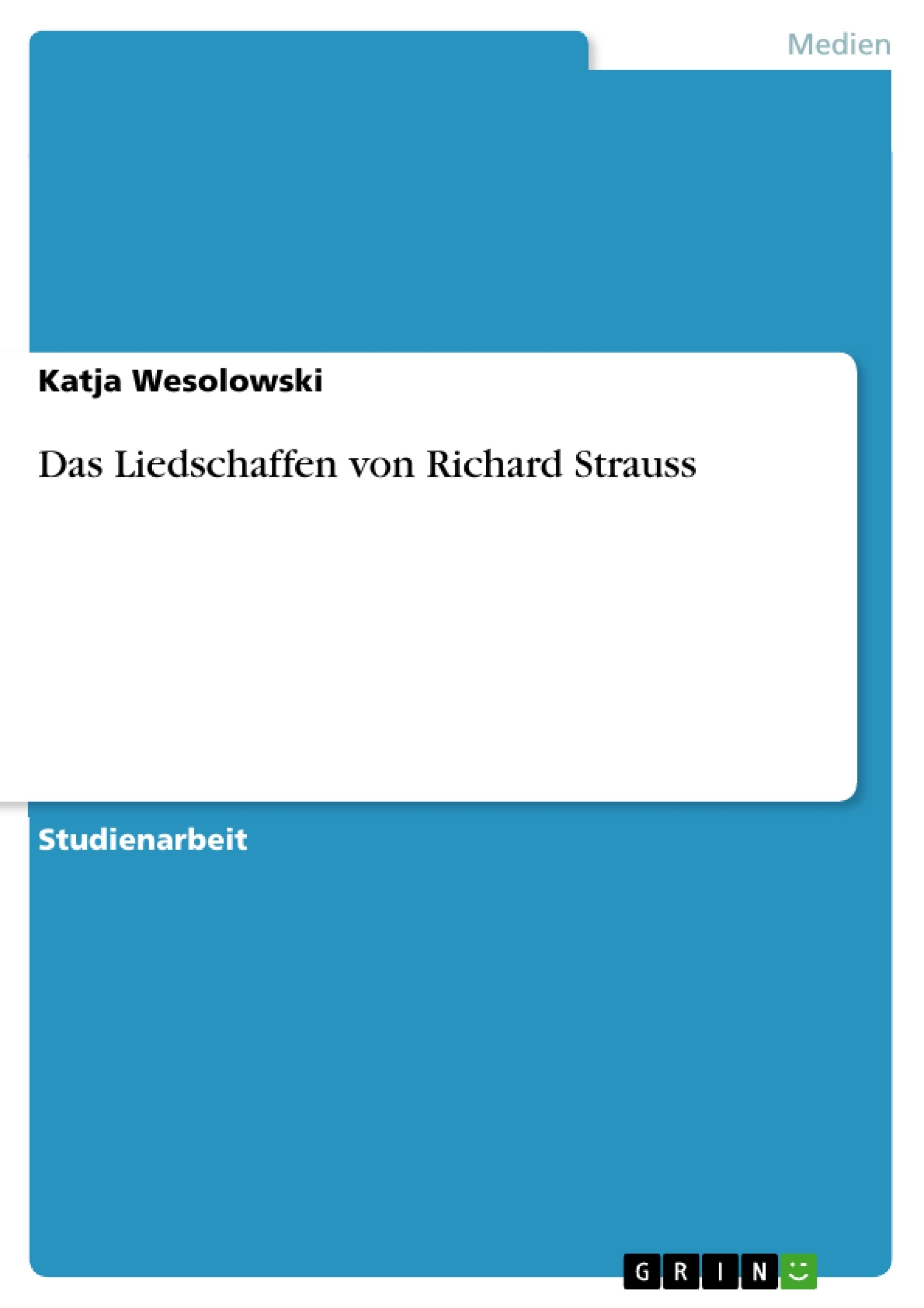I. Einleitung
Richard Strauss, geboren am 11.06.1864 in München, war Sohn eines Hornisten am Hoftheater. Er erhielt früh Unterricht in Klavier, Violine und Musiktheorie und komponierte schon in seiner Gymnasialzeit Lieder, Sonaten, Kammermusik - sogar eine Sinfonie. [...]
Möchte man den Komponisten Richard Strauss in die Musikgeschichte einordnen, so kann man von ihm sagen, dass er einer der führenden Repräsentanten deutscher Musik um und nach 1900 war. Ja man kann sogar behaupten, dass er vielleicht derjenige Komponist war, in dessen Musik sich das Lebensgefühl einer mitteleuropäisch-spätbürgerlichen Kultur, gemischt aus Pathos, Selbstgewissheit, Modernität und romantisch philosophischer Nostalgie, am deutlichsten widerspiegelt.
[...]
Neben seinem zweiten, mehr und mehr zentraler werdenden Schaffensgebiet, der Bühnenkomposition, tat sich ein drittes Schaffensgebiet Richard Strauss´ auf, das sich durch alle Lebensphasen zieht, die Liedproduktion. Neben Hugo Wolf und H. Pfitzner wurde Strauss zum Vollender des spätromantischen Kunstliedes, das – ähnlich wie bei Gustav Mahler – eine bedeutsame Erweiterung zum Orchesterlied erfuhr. Man kann sagen, dass das Lied im Gesamt-werk von Richard Strauss die Brücke von der Instrumentalmusik zur Oper bildete. In seiner Frühzeit schuf er mit einer schon erstaunlichen Beherrschung der instrumentalen Mittel eine seiner größten symphonischen Dichtungen, rang jedoch noch vergeblich mit der Oper. So bildeten die Lieder dabei eine Art Probebühne, auf der sich Strauss an den Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme versuchen konnte.
In der Zeit zwischen 1882 und 1905 entstanden in Berlin und München der größte Teil seiner Lieder, die unter den Opuszahlen 10 bis 56 veröffentlicht wurden. Kurz darauf, nach der Vollendung der Oper „Salome“ brach sein symphonisches Schaffen wie auch sein Liedschaffen mehr oder weniger ab. Erst 1919 widmet sich Strauss wieder mehr der Vertonung von Gedichten und Versen vor allem von Brentano, Arnim und Heine.
In seinen späten Lebensjahren, etwa nach 1935, kehrt Strauss schließlich noch einmal zum Lied zurück und widmet sich dabei insbesondere den großen deutschen Dichtern Goethe, Weinheber und Eichendorff. Abgesehen allerdings von einigen wenigen Ausnahmen, insbesondere den „Vier letzten Liedern“, ist Strauss’ Liedschaffen jedoch eher durch Objektivität als durch persönliche Bekenntnisse gekennzeichnet.[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Entwicklung des dt. Liedes bis zum Übergang ins 20. Jahrhundert
- III. Die Liedtexte und Dichter
- III. 1. Auswahl der Dichter
- III. 2. Textänderungen
- IV. Die Textvertonung; - vom spätromantischen Kunstlied zum Orchesterlied
- IV. 1. Form und Struktur
- IV. 2. Gestaltung der Singstimme
- IV. 3. Musikalische Ausdrucksmittel
- V. Die Aufführungen - Pauline Strauss als Liedinterpretin
- VI. Abgesang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Liedschaffen von Richard Strauss und analysiert dessen Bedeutung im Kontext der spätromantischen Musikentwicklung. Es soll der Frage nachgegangen werden, wie Strauss das Kunstlied weiterentwickelt hat und wie sich seine Musik in die Geschichte des deutschen Liedes einordnen lässt.
- Entwicklung des deutschen Liedes im 19. Jahrhundert
- Strauss' Liedvertonungen und seine Wahl von Texten und Dichtern
- Stilistische Merkmale von Strauss' Liedschaffen
- Bedeutung des Orchesters in Strauss' Liedkompositionen
- Strauss' Liedschaffen im Verhältnis zu seiner Opernproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Richard Strauss kurz vor und erläutert seine Bedeutung in der Musikgeschichte. Kapitel II beleuchtet die Entwicklung des deutschen Liedes vom Mittelalter bis zum Übergang ins 20. Jahrhundert. Dieses Kapitel bietet einen historischen Kontext für das Verständnis von Strauss' Werk. Kapitel III untersucht die Liedtexte und Dichter, die Strauss für seine Vertonungen wählte. Hier wird auf die Auswahl der Dichter sowie auf mögliche Textänderungen eingegangen.
Kapitel IV analysiert die Textvertonungen selbst, insbesondere den Wandel vom spätromantischen Kunstlied zum Orchesterlied. Es werden Form, Struktur, Gestaltung der Singstimme und die musikalischen Ausdrucksmittel beleuchtet. Kapitel V befasst sich mit den Aufführungen von Strauss' Liedern und der Rolle von Pauline Strauss als Interpretin.
Schlüsselwörter
Richard Strauss, deutsches Lied, spätromantische Musik, Kunstlied, Orchesterlied, Textvertonung, Pauline Strauss, Liedinterpretin.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das Lied im Werk von Richard Strauss?
Das Lied bildete für Strauss die Brücke von der Instrumentalmusik zur Oper und diente ihm als „Probebühne“ für die Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme.
Was ist der Unterschied zwischen Kunstlied und Orchesterlied bei Strauss?
Strauss vollendete das spätromantische Kunstlied und erweiterte es – ähnlich wie Mahler – zum Orchesterlied, wobei er die instrumentalen Mittel meisterhaft beherrschte.
Welche Dichter vertonte Richard Strauss bevorzugt?
In seiner frühen Phase nutzte er vielfältige Texte (Opus 10-56); später widmete er sich verstärkt Brentano, Arnim, Heine und in seinen letzten Jahren Goethe und Eichendorff.
Wer war eine zentrale Interpretin seiner Lieder?
Seine Ehefrau, die Sopranistin Pauline Strauss-de Ahna, war die wichtigste Interpretin seiner Lieder und prägte deren Aufführungsgeschichte.
Was sind die „Vier letzten Lieder“?
Dies ist ein berühmter Spätzyklus von Strauss, der im Gegensatz zu seinem sonst eher objektiven Liedschaffen als persönliches Bekenntnis gilt.
- Quote paper
- Katja Wesolowski (Author), 2004, Das Liedschaffen von Richard Strauss, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50403