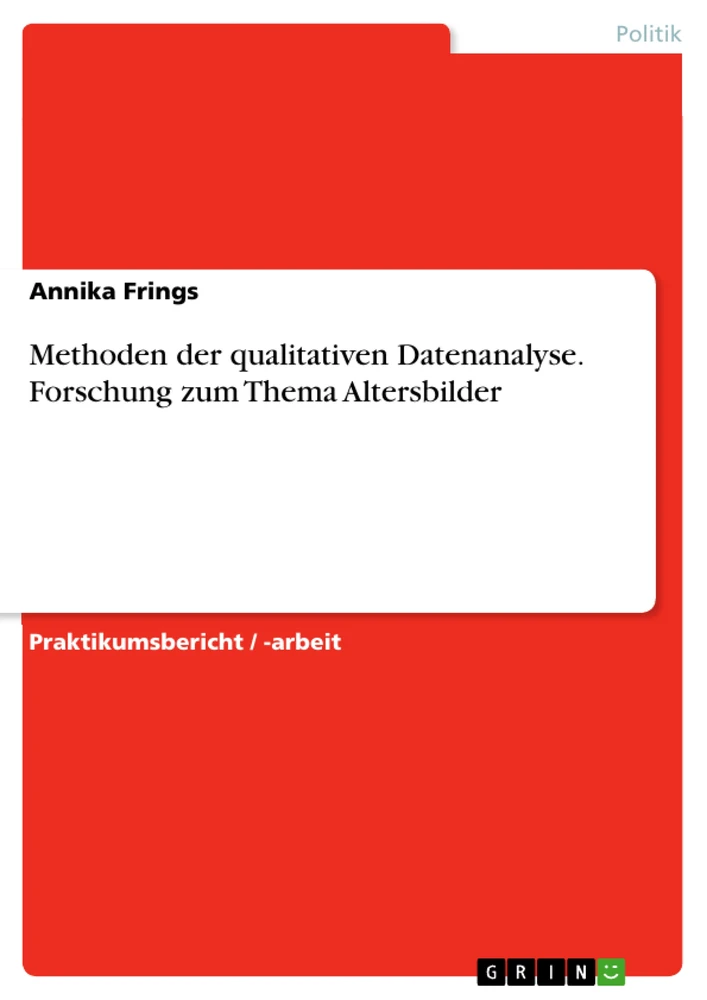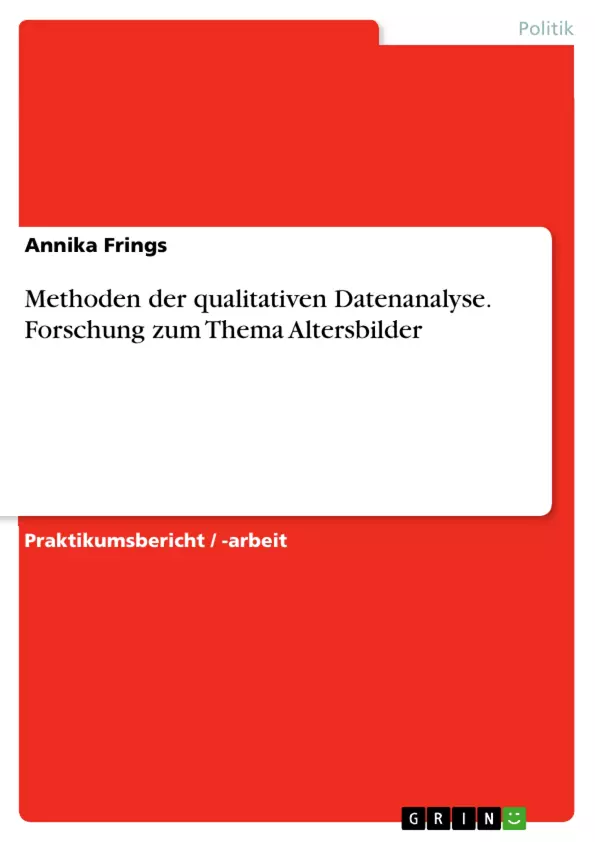Durch den demographischen Wandel und dem Anstieg der Lebenserwartung wächst der Anteil älterer Menschen an der Gesellschaft und die Bedeutung von Altersbildern nimmt zu. Die Lebenserwartung ist seit dem Jahr 1900 um mehr als 30 Jahre angestiegen. Bei den Altersbildern geht es nicht nur um die individuellen und gesellschaftlichen Vorstellungen des Altseins, sondern auch um den Prozess des Älterwerdens und den Vorstellungen von älteren Menschen als soziale Gruppe die in der Gesellschaft verbreitet sind. Allerdings werden diese Altersbilder der Vielfalt des Alters meist nicht gerecht, da sie Chancen und Stärken des Alters nicht betrachten.
Des weiteren unterscheidet man zwischen Altersselbstbildern, die sich auf das eigene Altern beziehen und Altersfremdbildern, die das allgemeine Bild des Alterungsprozesses und der alten Menschen betreffen, das im Umfeld und in den Medien vorherrscht. Es gibt in der Gesellschaft eine Vielzahl von teils polarisierenden Altersbildern, die sowohl positive als auch negative Assoziationen mit dem Alter vermitteln. Positive Assoziationen beziehen sich vor allem auf den großen Erfahrungsschatz und das angehäufte Wissen älter Menschen, dass diese an jüngere Generationen weitergeben können. Negative Assoziationen beziehen sich dagegen hauptsächlich auf deren nachlassende geistige und körperliche Leistungsfähigkeit.
Über das Verhältnis von Altersfremdbildern und Altersselbstbildern gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Die Kontaminationshypothese geht davon aus, dass das Altersselbstbild durch das Altersfremdbild beeinflusst wird, so können negative Altersfremdbilder dazu führen, dass ältere Menschen sich in diese fügen und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten unterschätzen. Die Externalisierungshypothese geht genau umgekehrt davon aus, dass die Selbstbilder in das allgemeine Bild vom Alter eingehen und dieses verändern. Die Vergleichshypothese wiederum besagt, dass das Altersselbstbild und das Altersfremdbild unabhängig voneinander sind. Im folgenden soll nun mit Hilfe eines Interviews herausgefunden werden, welche Altersbilder in der Gesellschaft verbreitet sind und welchen Einfluss diese auf die älteren Menschen selbst, sowie auf deren äußere Wahrnehmung haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemhintergrund
- 2 Forschungsdesign
- 2.1 Festlegung der Methode
- 2.2 Erarbeitung des Interviewleitfadens
- 3 Das Interview
- 3.1 Kontaktaufnahme und Durchführung des Interviews
- 3.2 Schritte der Auswertung des Interviews
- 4 Interpretation des Interviews
- 5 Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss gesellschaftlich verbreiteter Altersbilder und des Angebots von "Seniorentellern" auf das Selbst- und Fremdbild älterer Menschen. Ziel ist es, herauszufinden, ob und wie diese Faktoren das Selbstverständnis und die Wahrnehmung älterer Personen beeinflussen.
- Der demografische Wandel und die Bedeutung von Altersbildern
- Der Einfluss von Altersfremdbildern auf das Altersselbstbild
- Die Untersuchung der Assoziationen mit "Seniorentellern"
- Qualitative Datenanalyse mittels Leitfadeninterview
- Reflexion des Forschungsprozesses
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemhintergrund: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet den demografischen Wandel mit dem steigenden Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft. Es werden verschiedene Altersbilder – sowohl positive als auch negative – und deren Einfluss auf das Selbst- und Fremdbild älterer Personen diskutiert. Es werden verschiedene Hypothesen zum Verhältnis von Altersselbst- und Altersfremdbildern vorgestellt (Kontaminations-, Externalisierungs- und Vergleichshypothese), die den theoretischen Rahmen für die folgende Untersuchung bilden. Die zunehmende Lebenserwartung und die damit verbundene Bedeutung der Altersbilder für das gesellschaftliche Zusammenleben werden hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Forschungsfrage, wie gesellschaftliche Altersbilder und das Angebot von Seniorentellern das Selbst- und Fremdbild älterer Menschen beeinflussen.
2 Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Studie. Die Forschungsfrage wird präzise formuliert, und die Hypothese, dass ältere Menschen ihr Selbstbild negativ verändern und sich ausgegrenzt fühlen, wird aufgestellt. Als Forschungsdesign wird eine qualitative Fallstudie mit einem Leitfadeninterview einer Person über 60 Jahren gewählt. Die Entwicklung des Interviewleitfadens nach dem SPSS-Prinzip (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) wird detailliert erläutert. Es wird erklärt, wie die Fragen gesammelt, gekürzt, sortiert und zu Themenbündeln (Alter allgemein, Altersbilder, Seniorenteller) zusammengefasst wurden. Der Aufbau des Leitfadens mit Erzählaufforderungen, Kontrollstichpunkten und Hilfsfragen wird beschrieben.
3 Das Interview: Dieses Kapitel dokumentiert den Ablauf des Interviews. Es beschreibt die Kontaktaufnahme mit dem Interviewpartner und die Durchführung des Interviews im Arbeitszimmer des Befragten. Die Gewährleistung einer ruhigen und ungestörten Atmosphäre wird hervorgehoben. Die Verwendung eines offenen Leitfadens, der dem Befragten Freiraum für seine Antworten gibt, wird betont. Das Kapitel konzentriert sich auf die methodische Umsetzung des Interviews und den Kontext seiner Durchführung, um die Qualität der Daten zu gewährleisten. Die Bedeutung des Interviews als zentrale Methode zur Beantwortung der Forschungsfrage wird unterstrichen.
Schlüsselwörter
Altersbilder, Altersselbstbild, Altersfremdbild, demografischer Wandel, Seniorenteller, Qualitative Forschung, Leitfadeninterview, Fallstudie, Selbstwahrnehmung, gesellschaftliche Wahrnehmung, Lebenserwartung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss von Altersbildern und "Seniorentellern" auf das Selbst- und Fremdbild älterer Menschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss gesellschaftlich verbreiteter Altersbilder und des Angebots von "Seniorentellern" auf das Selbst- und Fremdbild älterer Menschen. Das zentrale Ziel ist es herauszufinden, ob und wie diese Faktoren das Selbstverständnis und die Wahrnehmung älterer Personen beeinflussen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den demografischen Wandel und die Bedeutung von Altersbildern, den Einfluss von Altersfremdbildern auf das Altersselbstbild, die Assoziationen mit "Seniorentellern", die qualitative Datenanalyse mittels Leitfadeninterview und die Reflexion des Forschungsprozesses.
Welche Methode wurde angewendet?
Es wurde eine qualitative Fallstudie mit einem Leitfadeninterview einer Person über 60 Jahren durchgeführt. Der Interviewleitfaden wurde nach dem SPSS-Prinzip (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) entwickelt. Das Interview war offen gestaltet, um dem Befragten Freiraum für seine Antworten zu geben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung und Problemhintergrund, Forschungsdesign (inkl. Methodenbeschreibung und Entwicklung des Interviewleitfadens), Das Interview (inkl. Ablauf und methodischer Umsetzung), Interpretation des Interviews und Reflexion. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Hypothesen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Hypothesen zum Verhältnis von Altersselbst- und Altersfremdbildern (Kontaminations-, Externalisierungs- und Vergleichshypothese). Eine zentrale Hypothese ist, dass ältere Menschen ihr Selbstbild durch gesellschaftliche Altersbilder negativ verändern und sich ausgegrenzt fühlen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Altersbilder, Altersselbstbild, Altersfremdbild, demografischer Wandel, Seniorenteller, Qualitative Forschung, Leitfadeninterview, Fallstudie, Selbstwahrnehmung, gesellschaftliche Wahrnehmung, Lebenserwartung.
Wo finde ich detaillierte Informationen zum Forschungsdesign?
Kapitel 2 ("Forschungsdesign") beschreibt detailliert das methodische Vorgehen, die Formulierung der Forschungsfrage und Hypothese, die Wahl der Methode (qualitative Fallstudie mit Leitfadeninterview) und die Entwicklung des Interviewleitfadens nach dem SPSS-Prinzip.
Wie wurde das Interview durchgeführt?
Kapitel 3 ("Das Interview") dokumentiert den Ablauf des Interviews, einschließlich der Kontaktaufnahme, der Durchführung im Arbeitszimmer des Befragten und der Gewährleistung einer ungestörten Atmosphäre. Die Verwendung eines offenen Leitfadens wird hervorgehoben.
- Arbeit zitieren
- Annika Frings (Autor:in), 2013, Methoden der qualitativen Datenanalyse. Forschung zum Thema Altersbilder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/504017