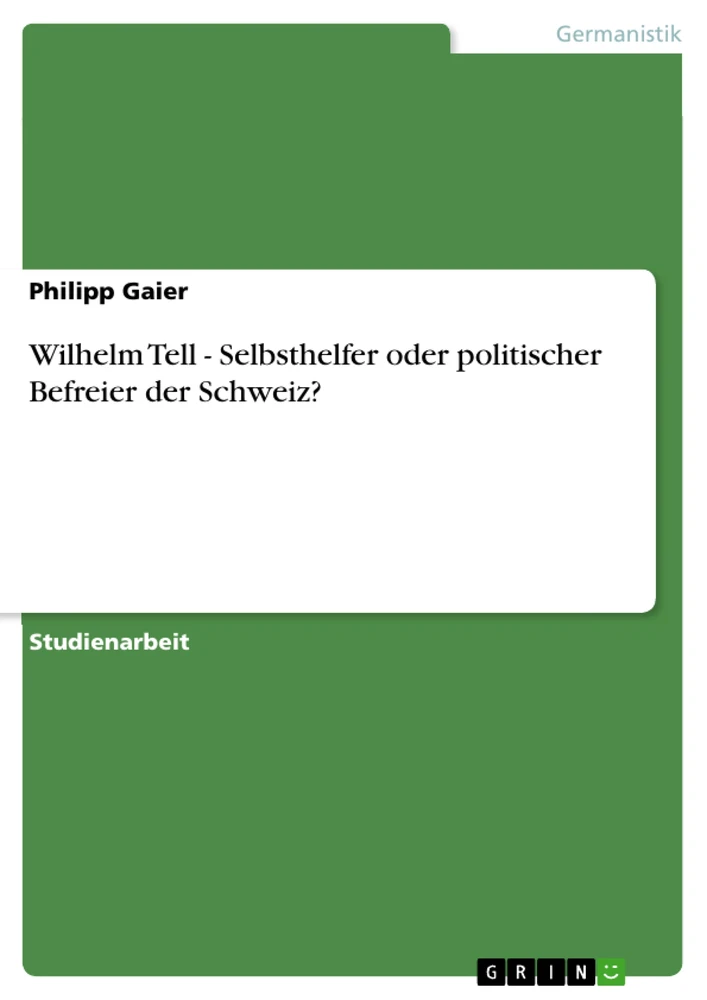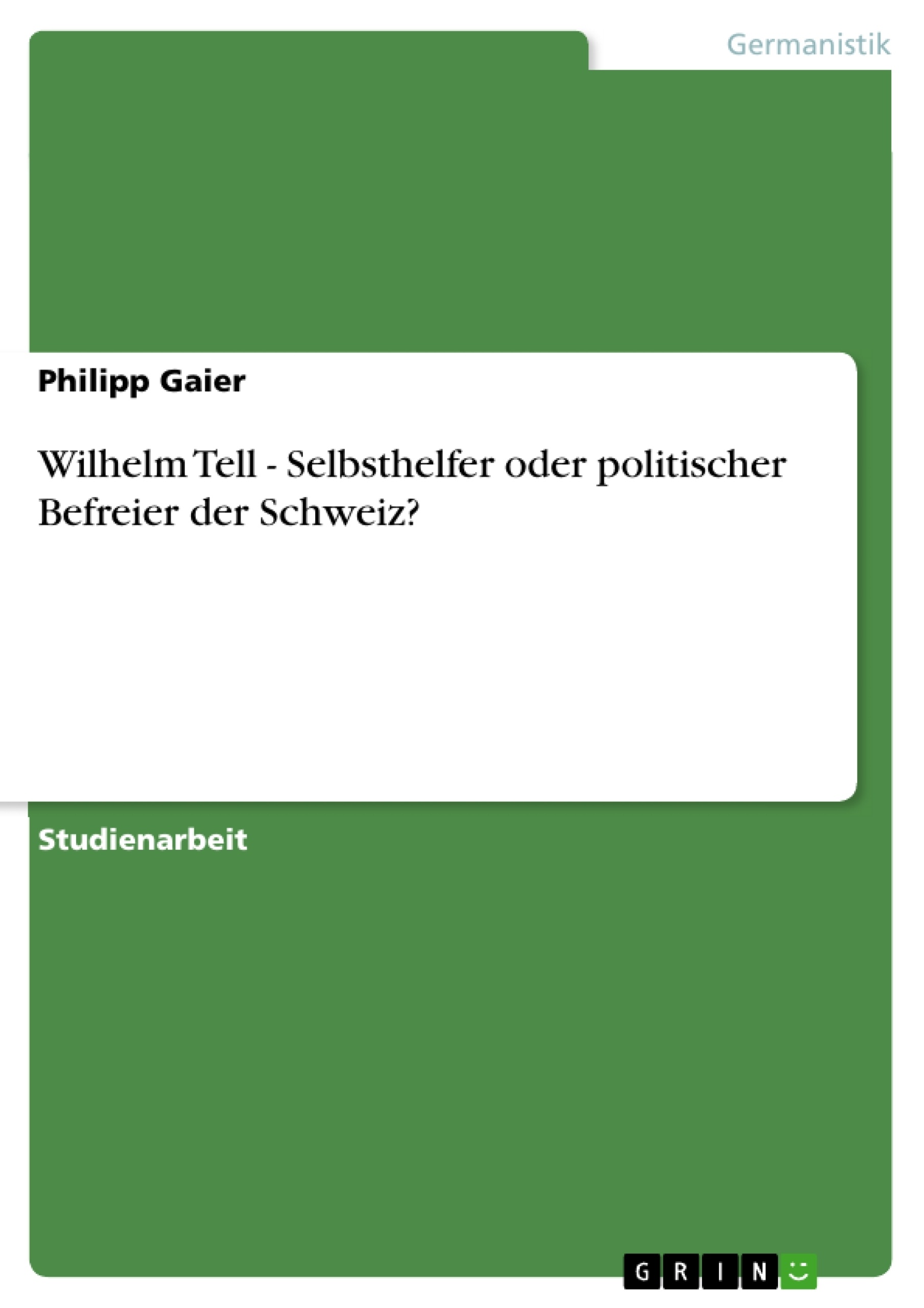Schon von Anfang an erfreute sich das Drama Wilhelm Tell einer außerordentlichen Beliebtheit beim Publikum. Den gelungenen Einstieg der Uraufführung in Weimar konnte nur noch eine Aufführung in Berlin am 4. Juli 1804 übertrumpfen. Die Kapazitäten der Theater schienen dem überdurchschnittlich starken Andrang nicht gerecht werden zu können, so dass einige Wiederholungen nötig waren, um die Neugierde des Publikums zu befriedigen. [Safranski, Friedrich Schiller, S. 505.] Begeistert äußerte sich auch August Wilhelm Schlegel zu Schillers Drama, der sich eine Aufführung "im Angesicht von Tells Kapelle am Ufer des Vierwaldstätter- Sees, unter freiem Himmel, die Alpen zum Hintergrunde" [Zit. nach Safranski, Friedrich Schiller, S. 505.] wünschte. Woher rührt diese allgemeine Verehrung des Stückes?
Seinen Ursprung hat der Wilhelm Tell-Stoff in einer Überlieferung des dänischen Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus aus dem 12. Jahrhundert. Bereits im 15. Jahrhundert galt die Geschichte des Wilhelm Tell als Inbegriff des Schweizer Befreiungskampfes gegen die Habsburger Fremdherrschaft und wurde mit der Gründung der Eidgenossenschaft verbunden. Mit den Befreiungskriegen der Jahre 1813-1815 und der Märzrevolution von 1848 wurde das Schillerdrama auch in Deutschland zum Sinnbild der Freiheit. Abgesehen von dem Verbot des Stückes für den Unterricht durch Adolf Hitler 1941 [Schulz, Wilhelm Tell, S. 217-226.], erfreut sich das Stück bis heute noch großer Beliebtheit, prägt es doch den deutschen Schulunterricht wie kein zweites Schillerdrama. Tell-Zitate sind im Alltagsleben tief verankert, so z. B. "Die Axt im Haus erspart den Zimmermann" oder "Früh übt sich, was ein Meister werden will". [Zymner, Friedrich Schiller, S. 148.] Entstammt schon der Ursprung des Tell-Stoffes einer Sage, so hat sich über die Jahrhunderte ein wahrer Mythos um den furchtlosen Mann gebildet, der mit einem Meisterschuss das Leben seines Sohnes, durch die Tötung des Gewaltherrschers Geßler die Eidgenossenschaft rettete. Eine Tat mit patriotischem Hintergrund? Schiller charakterisierte seinen Protagonisten folgendermaßen: "Die Rolle erklärt sich selbst: eine edle Simplicität, eine ruhige, gehaltne Kraft ist der Charakter; mithin wenige, aber bedeutende Gesticulation, ein gelassenes Spiel, Nachdruck ohne Heftigkeit, durchaus eine edle schlichte Manneswürde" [NA 32, S. 118. Zit. nach Benno v. Wiese, Friedrich Schiller, S. 770.]. Wird diese Beschreibung einem Mythos gerecht? Kann ein Mann mit diesen Eigenschaften ein Land retten? Wie kann eine gemäßigte Natur, wie sie Schiller dargestellt, eine derart tragende Rolle spielen?
Was die wahren Beweggründe für Tells Befreiungstat sind, und ob er tatsächlich der verehrte Volksheld mit den patriotischen Motiven ist, was angesichts des Schillerzitates beinahe unglaubwürdig erscheint, gilt es zu untersuchen. Dazu ist es erst einmal notwendig, den Gegensatz zwischen dem ruhigen, schlichten, fast schon primitiven Tell und dem heldenhaften Erlöser von der Tyrannei darzustellen, das heißt, eine Darstellung des Fremdbildes von Tell, da ihn die Eidgenossen als göttlichen Helden verehren, und des Selbstbildes, da er das zurückgezogene Leben eines fürsorglichen Familienvaters und des einzelgängerischen Jägers führt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Fremdbild des Wilhelm Tell
- Tells Selbstbildnis
- Jäger Tell
- Das unermüdliche Vertrauen in Gott und die Natur
- Die Folgen für Tells Handeln
- Der apolitische Tell
- Tells Naivität
- Die Apfelschuss-Szene und ihre Folgen
- Der innere Bruch und die Auferstehung Wilhelm Tells
- Der Bruch in der Handlung: Wie das Private öffentlich wird
- Der Tod Geẞlers
- Private oder politische Beweggründe ?
- Wird Tell seiner Rolle als Befreier des Landes gerecht (Fazit)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Figur des Wilhelm Tell im gleichnamigen Drama von Friedrich Schiller. Sie analysiert die Diskrepanz zwischen Tells Selbstbildnis als zurückgezogenem Jäger und dem Fremdbild des Helden, das ihn die Eidgenossen verehren lässt. Insbesondere wird die Frage behandelt, ob Tell ein politischer Befreier der Schweiz oder eher ein Selbsthelfer ist, der aus persönlichen Motiven handelt.
- Das Fremdbild des Wilhelm Tell als Held und Retter
- Tells Selbstbildnis als Jäger und Familienvater
- Die Rolle des Apfelschusses als Wendepunkt in Tells Entwicklung
- Die Frage nach Tells politischen Motiven für seine Taten
- Die Bedeutung von Natur und Gott in Tells Selbstbildnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Popularität des Dramas „Wilhelm Tell“ und die historische Bedeutung des Tell-Stoffes. Kapitel 2 untersucht das Fremdbild des Wilhelm Tell als Helden, das durch sein selbstloses Handeln und seinen Mut in der ersten Szene deutlich wird. Kapitel 3 beschäftigt sich mit Tells Selbstbildnis als Jäger und Familienvater. Hier werden seine tiefe Religiosität und sein Vertrauen in die Natur sowie die Folgen dieser Einstellungen für sein Handeln beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit der Apfelschuss-Szene und deren Folgen. Es wird untersucht, wie diese Szene zu einem inneren Bruch und einer Auferstehung des Wilhelm Tell führt und wie das Private durch Tells Handeln öffentlich wird.
Schlüsselwörter
Wilhelm Tell, Schiller, Dramatik, Heldenbild, Selbstbildnis, Apfelschuss, politische Motivation, Freiheit, Schweiz, Eidgenossenschaft, Natur, Gott, Tyrannei, Geẞler.
- Quote paper
- Philipp Gaier (Author), 2005, Wilhelm Tell - Selbsthelfer oder politischer Befreier der Schweiz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50399